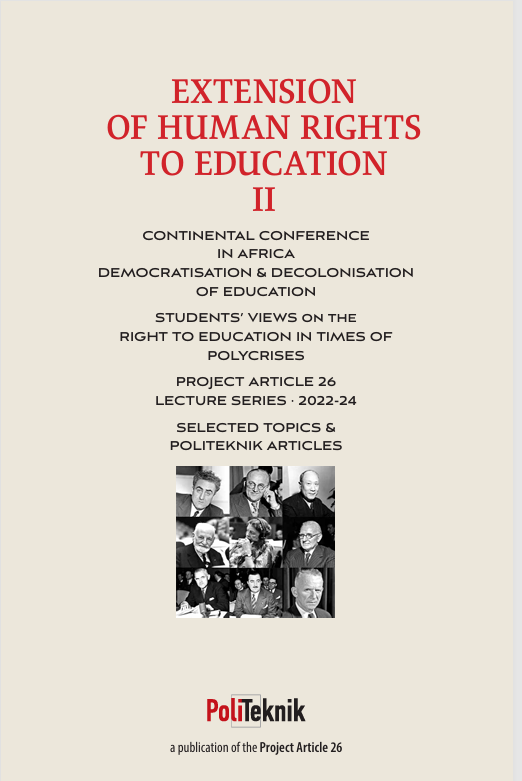Prof. Dr. Mirko Uhlig – Universität Mainz
Es ist durchaus pikant, dass Thomas de Maizière gerade im Luther-Jahr seine Überlegungen zum Wesen einer „Leitkultur für Deutschland“ in Thesenform präsentiert. Denn als gelungene Integrationsleistung kann die lutherische Reformation wohl nur mittels Verklärung gewertet werden. Wie dem auch sei. Fraglos leben wir in einer turbulenten Zeit, in der polternde Chauvinisten im In- wie Ausland Menschenrechte und demokratische Grundwerte nicht bloß in Frage stellen. Die Herausforderungen, vor welche uns die sogenannte Flüchtlingskrise spätestens seit Herbst 2015 im Alltag stellt, haben zu krassen Lagerbildungen innerhalb der Bevölkerung geführt. So scheint es zunächst durchaus legitim, wenn der amtierende Bundesinnenminister versucht, eine öffentliche Auseinandersetzung anzustoßen, in der geklärt werden soll, was denn die Grundlage eines gelingenden Zusammenlebens in Deutschland ist.
Dass dies allerdings unter Rückgriff auf eine Vokabel geschieht, die bereits vor einer Dekade mehr zur Polemisierung der Integrationsdebatten geführt hat als zu deren Differenzierung, erscheint auf den ersten Blick als unglücklich. Trotzdem – oder vermutlich gerade deshalb – wurde de Maizières Wunsch, seine Ausführungen kritisch und öffentlich zu kommentieren, durch Politiker, Wissenschaftler und Intellektuelle zeitnah nachgekommen. Dass in der anschließenden Debatte einiges von dem, was uns nach de Maizière „im Innersten“ zusammenhält, als ideologiebehaftetes Nationalklischee dekonstruiert wurde, hat wohl nur die Allerwenigsten überrascht. Natürlich erleichtert es auch die Demontage, wenn wie beispielsweise in der ersten These apodiktisch behauptet wird, es sei in Deutschland üblich, „zur Begrüßung die Hand“ zu reichen.[1] Allein die Erfahrungen, die ich in meinem Alltag mache, sei es in der Stadt oder auf dem Land, halten mir doch deutlich vor Augen, dass es sehr wohl gesellschaftsfähige Alternativen zum Händedruck in Deutschland gibt. Begrüßungen sind mehrdeutige Symbolhandlungen, die einerseits Zugewandtheit und Offenheit ausdrücken, für einige Menschen andererseits aber gewiss auch unangenehm konnotiert sein können, wenn ein fester Händedruck zum Beispiel als Dominanzgebaren empfunden wird. Die wirkliche Problematik der Thesen begründet sich meines Erachtens aber nicht durch solch eher triviale Beispiele, sondern durch die Art und Weise der Wortwahl. Es wird versucht, das oktroyierende Moment der Vokabel Leitkultur dadurch zu entschärfen, indem explizit betont wird, „leiten“ meine etwas anderes als „vorschreiben oder verpflichten“. Eher, so de Maizière, gehe es „um das, was uns leitet, was uns wichtig ist, was Richtschnur ist.“ Doch durch den massiven Einsatz der Personalpronomina „uns“ und „wir“ als quasi indirekte Imperative handelt es sich bei Thomas de Maizières Thesen offenkundig nicht um vorläufige Beobachtungen oder ethische Empfehlungen. Permanent wird den Lesern suggeriert, es bestehe ein breiter und unumstößlicher Konsens darüber, was zu einer spezifisch deutschen Identität gehöre und was nicht. Überhaupt: das Deutsche – was genau soll das sein? Aus wissenschaftlicher Sicht stellt der Versuch einer Homogenisierung menschlicher Denkinhalte bei geringer Datengrundlage generell eine tendenziöse Verkürzung dar, welche Einfallstore für Intoleranz und politische Hetze bietet. Das ist gewiss überspitzt, aber dem Bundesinnenminister zufolge existiert ein Fluchtpunkt abseits von „Sprache, Verfassung und Achtung der Grundrechte“, gewissermaßen ein unveränderlicher Identitätsnukleus, auf den all unsere unterschiedlichen Lebensstile zulaufen. Generell stimmen mich solch eher metaphysische Konzepte skeptisch, nach denen Entitäten top-down menschliches Handeln determinieren. Allein in der zeitlichen Rückschau wird schnell deutlich, dass die auch heutzutage noch häufig bemühten „deutschen Tugenden“ wie Verlässlichkeit, Arbeitseifer, Ordnungsliebe sowie Exaktheit populäre Selbstwahrnehmungen aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs sind – demnach „jüngere“ Konstruktionen und keine primordialen Wesenseinschreibungen. In vergleichender Perspektive bietet das 19. Jahrhundert, oft als das Zeitalter der nationalen Staatenbildung bezeichnet, eine Fülle verwirrender Beispiele, die auf alles Mögliche hinweisen, nur nicht auf eindeutige Essenzen. Geht man etwas weiter zurück und zieht beispielsweise die berühmten Völkertafeln aus dem 18. Jahrhundert heran – tabellarische Auflistungen vermeintlich ethnischer Merkmale –, wird man unter anderem mit dem ambivalenten Befund konfrontiert, dass der „Teutsche“ in der Fremdwahrnehmung als „wizige“, aber auch zügellose Person wahrgenommen wurde, die sich ihre Freizeit gerne „mit Trincken“ vertreibe.

Macht es demzufolge überhaupt Sinn, der Frage nach dem Wesen des Deutschen und einer deutschen Kultur ernsthaft nachzugehen? Meine Antwort lautet, für einen Kulturwissenschaftler sicherlich wenig überraschend, nein und ja zugleich. Nein, wenn angestrebt wird, eine empirisch konkret registrierbare Größe entdecken zu wollen, mit der ein über alle Zeiten hinweg stabiler Katalog deutscher Eigenarten erstellt werden kann – ein Programm übrigens, das in der Ethnologie und der Volkskunde um das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert durchaus ernsthaft betrieben wurde. Ja, insofern die alltäglich genutzte Fremd- und Selbstzuschreibung „Deutsch-sein“ als Fiktion beziehungsweise Narration begriffen wird, die, im jeweiligen Verwendungszusammenhang betrachtet, aufschlussreiche Rückschlüsse auf ganz konkrete gesellschaftliche Befindlichkeiten und Konstellationen erlaubt. Darüber hinaus eröffnet diese Perspektive weitere Erkenntnisräume etwa derart, Zuschreibungen der genannten Form als kognitive Bewältigungstechniken zu interpretieren, die dabei helfen können, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden, sich zu verorten und für andere sichtbar zu sein. Wie de Maizière ganz richtig betont, stellt dies eine conditio sine qua non demokratischer Praxis dar. Stereotype Fremd- beziehungsweise Selbstbilder und auch Vorurteile zu haben, schließt nicht per se aus, trotzdem ein toleranter aufgeklärter Mensch sein zu können. Immanuel Kant hat darauf aufmerksam gemacht, wie unverzichtbar Vorurteile, oder genauer gesagt: vorläufige Urteile, als Orientierungshilfen nicht allein im alltäglichen zwischenmenschlichen Umgang sind, sondern wie sehr sie auch die wissenschaftliche Tätigkeit prägen. Um Missverständnissen vorzubeugen sei aber schnell nachgeschoben, dass man sich – dem aufklärerischen Ethos nach – selbstredend nicht mit plumpen Vermutungen begnügen, sondern die Sachlage kritisch prüfen und sich um die Ausbildung begründeter Meinungen bemühen sollte.
Ebenso vieldeutig und somit prinzipiell missverständlich und missbräuchlich wie das Etikett „deutsch“ ist der bereits angeschnittene Begriff der „Kultur“. Innerhalb der Disziplin Kulturanthropologie/Volkskunde, der ich mich akademisch verpflichtet fühle, wird zwischen einem weiten und einem engen Kulturbegriff unterschieden. Unter letzteren fällt all das, was gemeinhin mit bildungsbürgerlichen Institutionen und Kanons assoziiert wird – zum Beispiel Opern, Theateraufführungen, „klassische“ Musik, Prosa sowie Poesie, die bildenden Künste und Museen. Neben einem ästhetischen Elitismus mag die enge Perspektive aber auch einen sogenannten ethnischen Essentialismus befördern. Besonders hartnäckig hält sich die Vorstellung, Kultur sei gleichbedeutend mit einer eindeutig identifizierbaren Menschengruppe zu verstehen, deren Mitglieder über Generationen hinweg dieselben Normen und Bedürfnisse teilen. Bisweilen bin ich überrascht, wenn ich in den Texten ansonsten bewundernswert scharfsinniger Autorinnen und Autoren der Gegenwart über ein Wort stolpere, das in der heutigen ethnologischen Theoriebildung längst keine Rolle mehr spielt: der Kulturkreis. Kreise zieht man bekanntlich um einen Mittelpunkt, sie definieren sich durch ein Innen und ein Außen, durch Be- und Abgrenzung, was mindestens zwei Fragen aufwirft: 1. Wer entscheidet darüber, welches Individuum zu einer Kultur gehört? 2. Läuft eine Geschlossenheitsrhetorik nicht Gefahr, empirisch Heterogenes und geschichtlich Kontingentes unangemessen zu vereinheitlichen und zu naturalisieren?
Vor diesem Hintergrund sollte auch die Rede beziehungsweise das Bild einer „Trägerschaft von Kultur“ kritisch gesehen werden. Nach den bisherigen Ausführungen dürfte es nicht verwundern, dass ich es aus meinem fachlichen Selbstverständnis heraus als äußerst problematisch erachte, von einer deutschen, türkischen, arabischen, bayerischen oder rheinischen Kultur zu sprechen, wenn unerwähnt bleibt, dass es sich dabei einerseits um Heuristiken handelt, also um Instrumente zur wissenschaftlichen Erkenntnissuche, andererseits um handlungsanleitende Auto- und Heterostereotype der Alltagsbewältigung. Der erklärte Anspruch, Träger einer Kultur sein zu können, mag das eben kritisierte Bild befeuern, bei Kultur handele es sich um eine vom Menschen losgelöste Kraft, die auf unser Denken und Handeln einwirke. Bemerkenswerterweise gelangte diese Idee im frühen 20. Jahrhundert zu hoher Popularität und wurde gar zeitweilig herrschende Lehrmeinung in der zeitgenössischen US-amerikanischen Ethnologie. Alfred L. Kroeber (1876–1960), dessen Vater nebenbei erwähnt gebürtiger Kölner war, nahm Anleihen an biologischen Konzepten seiner Zeit und entwickelte darauf aufbauend die einflussreiche Theorie von der Kultur als „superorganic“ (1917).
Unter diesen Vorzeichen scheint die titelgebende Frage aus Sicht der Kulturwissenschaften in eine Sackgasse zu führen. Wenn man aber darauf insistiert, dass tragen ja auch mittragen und/oder gestalten bedeuten kann, ließe sich mein Beitrag doch noch mit einem konstruktiven Gedankengang zum Abschluss bringen. Bei aller berechtigten Kritik am Konzept der Leitkultur, zumal wenn sie national(istisch) grundiert ist, sollte man die Konstruktion als solche meiner Ansicht nach nicht automatisch rundweg zurückweisen. Denn wenn, wie es der Philosoph Julian Nida-Rümelin seit längerer Zeit empfiehlt, Leitkultur eher im Sinne der Kantischen regulativen Idee diskutiert wird – und diskutierbar, also veränderbar bleibt –, die, wie es auch Thomas de Maizière formuliert hat, dem Individuum Orientierung ermöglichen kann, dann fällt es mir schon leichter, mich als mündiger Bürger einer Demokratie mit dem Terminus zu arrangieren. Apropos Nida-Rümelin: Eine an seinen Überlegungen (2006; 2016) angelehnte „humanistische Leitkultur“ böte die Möglichkeit, für die Idee zu sensibilisieren, dass eine demokratische Grundordnung – d.h. vor allem der Respekt der Menschenwürde, die Anerkennung der Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung aller Geschlechter und die Praxis der Deliberation – mit Augenmaß im Alltag eingeübt, gelebt und vorgelebt werden muss. In einem Utopia, in dem dies problemlos gelingt, würden Hilfsmittel wie „Leitkultur“ oder „Humanismus“ natürlich nicht gebraucht. Aber in einer Zeit, in der von manch staatlicher Seite Denkverbote erteilt werden und die Würde des Einzelnen immer häufiger bedroht wird, bedarf es womöglich noch solcher Schlagwörter, um uns über die Auseinandersetzung mit ihnen dafür zu engagieren, dass wir so leben können, wie wir möchten, ohne dass es auf Kosten unserer Mitmenschen geht.
Alfred L. Kroeber: The Superorganic. In: American Anthropologist 19 (1917). S. 163-213.
Julian Nida-Rümelin: Humanismus als Leitkultur. Ein Perspektivenwechsel. München 2006.
Julian Nida-Rümelin: Humanistische Reflexionen. Berlin 2016.
[1] De Maizières Ausführungen wurden zuerst in der „BILD am Sonntag“ veröffentlicht, können aber mittlerweile auf der Homepage des BMI unter www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2017/05/namensartikel-bild.html nachgelesen werden.