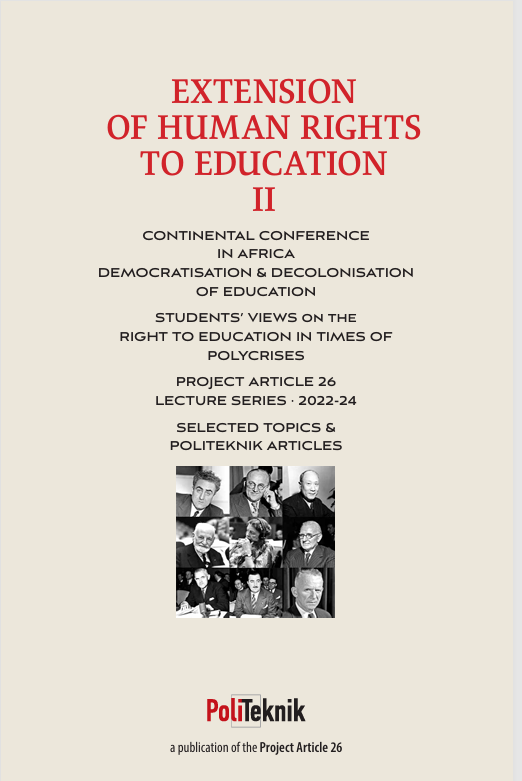Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba | Humboldt Üniversität zu Berlin
Eine unendliche Geschichte: Am Ende der alten Heimatwelten und an ihrem modernen Neuanfang vor rund 200 Jahren steht ein ganz unsentimentales Rechtskonstrukt: das Heimatrecht, das den Ortsgebürtigen Anspruch auf Wohnen und Heiraten wie auf Armenhaus und Friedhof gewährt. Es ist das Bürgerrecht einer bäuerlichen Welt, die ihre lokalen Ressourcen verteidigen muss, denn Äcker und Weiden, Wohnraum und Handwerk sind nicht beliebig vermehrbar. Daher wehrt sich die Gemeinschaft gleichsam genetisch gegen den Zuzug von Fremden und schafft zugleich soziale Konvention und lokale Kontrolle. Denn fremde Arme und Migranten wie abweichende Werte und Lebensstile sind in diesen normativen Lokalwelten unerwünscht – damals wie heute…
Am Ende des 18.Jahrhunderts jedoch beginnt die europäische Bewegung der Romantik nun Heimat als Erinnerung und Gefühl zu inszenieren. In einer sich dramatisch verändernden Welt zunächst der Aufklärung, dann der Massenwanderung in die Städte, schließlich der Industrialisierung werden von literarischen und künstlerischen Bewegungen sehnsuchtsvolle Erinnerungen an die „gute alte Zeit“ beschworen. Damit beginnt ein großes Programm der Ästhetisierung von Natur und Kultur, in dem Alphorn und Volkslied, Märchen und Tracht gepriesen, gesammelt und notfalls auch erfunden werden. Malerei und Literatur, Musik und Folklore liefern zum ersten Mal medial und massenkulturell wirksame Heimatbilder: Geschichte, Natur, Land und Volk eingeschmolzen in das Sentiment „Heimat“!
Danach kommt bekanntlich jene dunkle Zeit der nationalen und völkischen Aufladung. Die Heimatidee wird zunehmend in „Vaterland“ und „Volkstum“ übersetzt, wird als nationale Leitkultur in Schule und Kaserne, in Literatur und Musik vermittelt und wird dann als nationale Heimatverteidigung zum Leitmotiv des I. Weltkriegs gemacht. Auf diesem ideologischen Fundament kann auch der Nationalsozialismus aufsetzen mit seiner mörderischen rassischen Heimat, deren ethnische Stereotype und Ressentiments auch nach 1945 keineswegs völlig verschwinden.
Erst die 1960er Jahre bringen in der Heimatdebatte eine kritische Wendung, die nun von neuen sozialen Bewegungen der alten Heimattümelei in Verein, Museum und Politik entgegengesetzt wird. In Romanen werden schwierige Heimatgeschichten der NS-Zeit aufgearbeitet, auf Theaterbühnen und in Dialektstücken nicht mehr nur heile Dorfidyllen beschworen, traditionelle Blaskapellen zum Bayern-Brass umgemodelt. Eine junge und offene Heimatidee stellt sich der alten und engen entgegen – und dies nun auch in urbanen Räumen.
Dennoch bleibt der Heimatbegriff bis heute umkämpft. Wenn etwa die Gruppierung der „Identitären“ versucht, ihn erneut nach rechts zu entführen. Durch die wachsende Zahl von Migranten und Geflüchteten sei eine „Umvolkung“ im Gange, die das eigene Volk beschädige, entwurzle und verdränge.
Gegen solche biologistischen und rassistischen Positionen der Rechtspopulisten steht heute jedoch eine relativ stabile Front zivilgesellschaftlicher Initiativen und Positionen. Sie versteht Gesellschaft als ein offenes Heimatangebot „vor Ort“, als einen „shared space“, der immer wieder neu verhandelt werden muss: Beheimatung als ein permanenter Prozess der sozialen und kulturellen Integration von allen und für alle.
Entscheidend dabei ist, dass diese Zivilgesellschaft eine systematische Politik der Integration in Lebensstile betreibt, also der Einbindung in gemeinsame soziale Räume und Lebenswelten, in vielfältige Freizeitstile und Konsumformen. Sie rückt nicht mehr ethnische Herkunftsfragen und kulturelle Unterschiede nach vorn, sondern knüpft an alltäglichen und gemeinsamen Erfahrungen an: Konvergenz statt Differenz. Damit ermöglicht sie auch den Mobilen, Migranten und Geflüchteten einen Zugang zu einem gemeinsamen lokalen Alltag: Musik und Sport, Esskultur und Fest, Internet und Kino nicht nur für „Einheimische“.
Hier funktioniert Integration „von unten“. Und hier wird zugleich klar, dass unser Integrationsbegriff in der Tat neu zu füllen ist. Dass die neue soziale und kulturelle Heterogenität unserer Gesellschaft nicht nur die Migranten und Geflüchteten verkörpern, sondern längst wir selbst: in unseren immer mobileren und individualistischeren Gesellschaften.
Dies zeigt gerade der rechte Flüchtlingsdiskurs, der alle gesellschaftlichen Probleme auf „die Fremden“ projiziert. Tatsächlich jedoch geht es bei den aktuellen gesellschaftlichen Konflikten um uns alle und um die Grundfrage, in welcher Gesellschaft wir zukünftig leben wollen: in einer kulturell vielfältigen, sozial offenen, atmosphärisch toleranten Gesellschaft, wie sie vor allem in den Städten und bei den jüngeren Erwachsenen existiert; oder in einer kulturell homogenen, sozial verschlossenen und autoritär orientierten lokalen Gesellschaft, wie sie manche ländliche Regionen und ältere Menschen vorziehen.
Dieser Konflikt um „Heimat“ als Zukunftsvision oder Zukunftsangst ist in der Tat ernst zu nehmen, denn darin deutet sich nichts weniger an als eine soziale Spaltung der Gesellschaft. Denn dabei steht in Frage, wie wir als faktische Einwanderungsgesellschaften den sozialen und kulturellen Wandel aktiv politisch gestalten und wie wir nicht völkische Reinheit, sondern soziale Mischung und kulturelle Hybridität als Beheimatungswege in die Zukunft vermitteln können.
Hier muss – vor allem von Politik, Medien und Wissenschaft – ohne soziale Arroganz und moralische Überheblichkeit darüber verhandelt werden, welche Lebensstile und Freiheiten, welche Bilder und Identitäten, welche Bindungen und Traditionen nötig sind, um Gesellschaft als einen gemeinsamen Raum zu gestalten: als eine Heimat, in der nicht mehr Herkunft, Familienname oder Vermögen über die Lebenschancen und Lebensgestaltung der Einzelnen entscheiden, in der nicht Bilder der Differenz den Blick auf Gemeinsamkeiten verstellen, sondern die uns letztlich zum gemeinsamen „Fluchtpunkt“ für alle wird: eine in ihrer Vielfalt gelingende und sich deshalb selbst sichere Lebenswelt.