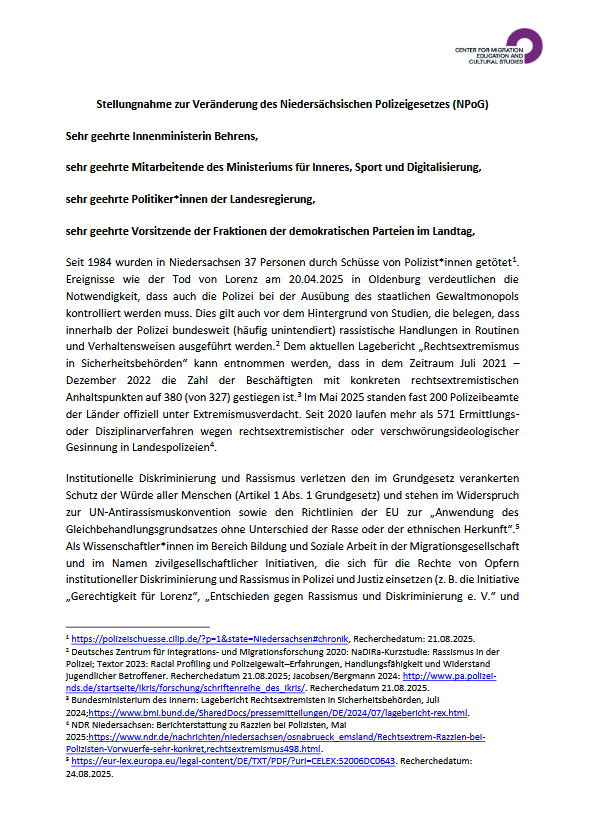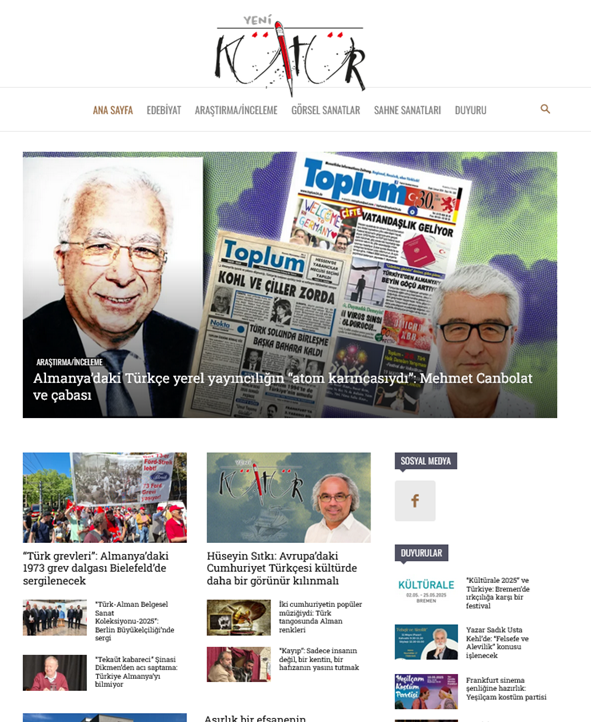Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor erhebliche Herausforderungen. Sie zwingt uns dazu, über das Alltagsleben noch einmal genauer nachzudenken und es gegebenenfalls umzugestalten, ja neu zu organisieren. Gerade in einer derartigen Situation wären naive Reaktionen und Spekulationen nicht nur problematisch, sondern auch verantwortungslos.
1. Die Corona-Pandemie bietet wichtige Anstöße für eine Neuvermessung des
urbanen Alltags
Um den Herausforderungen gerecht zu werden, die die Coronapandemie bedeutet, stehen auf den ersten Blick gleich zwei Schwierigkeiten im Wege. Erstens wissen wir bislang noch relativ wenig über die Eigenschaften der Pandemie selbst und zweitens wissen wir auch zu wenig über die Erfordernisse und Spielräume, die im urbanen Alltag im Umgang mit derartigen Herausforderungen vorhanden oder zumindest denkbar sind.
a) Was die erste Schwierigkeit betrifft, so resultiert sie daraus, dass wir über die medizinischen Aspekte dieser Pandemie noch nicht genug wissen, obwohl es ja durchaus schon vergleichbare Pandemien gegeben hat. Freilich hat sich hier die Kenntnislage zuletzt erheblich verbessert. Und gibt es nunmehr schon eine ganze Reihe von Erfahrungen, die darauf hinweisen, dass es vor allem darauf ankommt, unser Alltagsleben neu zu organisieren.
b) Und was die zweite Schwierigkeit betrifft, so geht es um so etwas wie eine Neuorientierung des urbanen Alltags. Eine solche Neuorientierung oder Neuvermessung stellt auch erst einmal eine erhebliche Herausforderung dar. Sie ist nicht nur ein komplexes, sondern vor allem auch ein voraussetzungsreiches Unterfangen. Das beginnt damit, dass das Alltagsleben weitgehend routiniert abläuft. Die Vorhaben, die dazu erforderlichen Schritte und die damit gesteckten Ziele werden in der Regel nicht weiter überlegt, sondern im Rahmen dessen, was üblich ist und tagtäglich praktiziert wird, erledigt.
Tatsächlich motiviert die Corona-Pandemie dazu, einmal genauer über den Alltag nachzudenken. Und da zeigt sich etwas, was vielleicht auf den ersten Blick überrascht, eine gewisse Konvergenz der Perspektiven. Wir verfügen aufgrund des bisherigen Pandemieverlaufs längst über vielfältige Erkenntnisse über die alltäglichen gesundheitlichen wie gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Und es sieht so aus, als ob sie in die gleiche Richtung zielen.
Die praktischen Auswirkungen der Pandemie fokussieren den Blick nicht nur auf das alltägliche Zusammenleben, sondern darüber hinaus hier auch auf ganz bestimmte Elemente – auf Elemente, die völlig unabhängig von der Debatte über die Pandemie in der Debatte über urbanes Zusammenleben seit je eine große Rolle spielen. Es sind Elemente, die bereits bei Erwing Goffman eine große Rolle spielen. Er beschreibt sie ganz unabhängig von irgendeiner gesundheitlichen Herausforderung . Ihm geht es um eine hier fundamentale Beobachtung, um das Phänomen“wohlwollend distanzierter Umgang miteinander”. Goffman hat sich bei seiner Analyse des urbanen Zusammenlebens immer wieder mit dem urbanen Quartier befasst, dessen sozio-kulturelle und funktionale Mischung beschrieben. Er hatte dabei eine Situation vor Augen, in der die Menschen einander nicht zu nahe treten, weil sie ja in einer Stadt einander notwendig fremd sind, in der sie aber einander auch nicht völlig gleichgültig gegenüber treten, weil sie ja im Blick auf die Arbeit, den Einkauf, die gesundheitliche Versorgung, die Bildung und vieles mehr aufeinander angewiesen sind. Und es hat sich gezeigt, dass so ein Verhalten auf einer wie selbstverständlich praktizierten sozialen Rahmung basiert, einer Art sozialer Logik. Sie liegt im Kern auch dem zugrunde liegt, was man heute in der Stadtentwicklungsdebatte die “Stadt der kurzen Wege” nennt. Damit, meine ich, werden gewissermaßen offene Türen eingerannt.
2. In der Pandemie bekommt das Stadtquartier den Charakter eines urbanen
Labors
Aus der Pandemie kann man lernen, dass diejenigen, die ihre Alltagsroutinen wohlwollend distanziert praktizieren, richtig liegen. Bei Goffman geht es um eine urbane Situation, in der jeder jedem fremd ist und gleichzeitig jeder auf jeden angewiesen ist, um seinen Alltag erfolgreich organisieren zu können. In der Pandemie geht es in einer hochinfektiösen Situation darum, miteinander wohlwollend distanziert umzugehen – einfach, weil auf diese Weise Ansteckungsrisiken deutlich reduziert werden, ohne dabei auf jeden Kontakt und auf einen sozialen Umgang miteinander verzichten zu müssen. Würdigt man das Stadtquartier in Zeiten der Pandemie als ein ausdrucksstarkes urbanes Labor, so kann man daraus eine ganze Reihe von Hinweisen ableiten. Es sind Hinweise, die zukünftig im urbanen Zusammenleben noch stärker als bisher beachtet werden sollten:”wohlwollend distanzierten Umgang miteinander”
Erstens kommt es mehr denn je darauf an, das urbane Zusammenleben nicht nur unter städtebaulichen Aspekten zu würdigen, sondern vor allem auch die zentralen Momente des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu berücksichtigen. Und es ist wichtig, dabei einer synchronen Perspektive zu folgen und immer wieder an die Situation im Quartier anzuknüpfen (Bukow, Yildiz 2020, 183). Ein gerade heute mehr denn je gebotener wohlwollend distanzierter Umgang miteinander setzt ein funktional wohlorganisiertes, ein dichtes und gemischtes Quartier voraus, wo man alle wichtigen Bedürfnisse (Arbeiten, Wohnen, Bildung, Kultur, Gesundheit, Freizeit usw) in einem überschaubaren Raum der kurzen Wege erledigen kann. Quartiere allerdings, die funktional entmischt sind (für jeden Schritt große Wege zurückgelegt und viel Zeit verbraucht, bloß um eine verfallene Infrastruktur und den Verlust an kommunalen Dienstleistungen usw zu kompensieren) und wo große sozio-kulturelle Homogenität herrscht (wo öffentliche Räume verschwunden sind und man sich nur noch mit seinesgleichen beschäftigt) erweisen sich einmal mehr als lebenswirklichkeitsfeindlich.
Zweitens kommt es mehr denn je darauf an, bei dem Umgang miteinander klar auf die jeweils relevanten Spielregeln zu achten. Und die Spielregeln unterscheiden sich in einer Stadtgesellschaft fundamental, ob es um funktionale Zusammenhänge wie Arbeiten oder Bildung, um private Zusammenhänge wie Leben in der Familie oder um zivilgesellschaftliche Zusammenhänge geht. Urbanes Zusammenleben funktioniert eben nur in der Lebenswelt der Familie oder des Milieus nach gemeinschaftlichen Regeln. Ansonsten ist die Stadtgesellschaft völlig anders als eine Gemeinschaft organisiert. In den Institutionen usw. folgt sie formalen Regeln. Hier funktioniert sie eben nicht wie eine bloß etwas zu groß geratene Familie, in der man quasiverwandt und einander hochvertraut ist und dementsprechend gegenüber“Fremden” ablehnend, ja feindlich gesonnen ist. Eine wohlwollend distanzierte Umgangsweise meint hier, das alltägliche Zusammenleben, formal routiniert zu organisieren und den anderen als einen von Vielen in seiner jeweiligen Verschiedenheit zu respektieren. Das Vertrauen, das urbanes Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht, entsteht hier eben gerade nicht aus Ähnlichkeiten oder aus Verwandtheit, sondern ist praktisch-vernünftig begründet, resultiert aus der Notwendigkeit, miteinander formal-rational umzugehen.
Und drittens kommt es darauf an, den Diskurs über das urbane Zusammenleben zu forcieren, genauer die Erfahrungsprozesse im Umgang mit der Pandemie immer wieder ins Gespräch zu bringen und ins Blickfeld zu rücken. Wie hat man selbst, wie haben andere die Situation bislang erlebt? Wie ist es zu Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch überhaupt gekommen? Was ist plötzlich fraglich und was ist anderseits plötzlich selbstverständlich geworden? Die besonders betont wohlwollenddistanzierte Umgangsweise miteinander hat zu vielen und intensiven Gesprächen motiviert, sogar zu neuen Redewendungen beigetragen (“bleib gesund”) und auch zu einem neuen Vertrauen untereinander. Dank der neuen Kommunikationstechniken, der Social Media und virtuellen Kommunikation konnten solche Diskurse sehr erfolgreich sein.
Die Pandemie hat auf diese Weise dem Quartier als Labor zu ganz besonderen Erkenntnissen verholfen. Die Pandemie hat die Bedeutung der formalen Strukturen im Quartier, die Unterschiede zwischen privaten und gesellschaftlichen Umgangsweisen und Routinen unterstrichen. Es ist deutlich geworden ,welche Rolle das Miteinander-Sprechen hat, wenn es darum geht, ein vertieftes Verständnis über die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit zu vermitteln. Der gemeinsame Erfahrungsaustausch unterstreicht die Rolle der Zivilgesellschaft.
3. Lehren aus der Pandemie bedürfen einer besonderen Sorgfalt
Es kommt nun mehr denn je darauf an, die Linien, die sich im urbanen Labor gegenwärtig abzeichnen, weiter zu vertiefen und daraus differenzierte Deutungsmuster zu entwickeln. Dabei ist unübersehbar, dass sich angesichts der geradezu existentiellen Herausforderungen, die eine Pandemie darstellt, auch schnell Kurzschlüsse einstellen. Es liegt immer nahe, naive Deutungsmuster zur Hand zu nehmen, einfach billigen Verschwörungstheorien zu folgen und Fake News zu glauben. Solche Reaktionen liegen schon immer nahe, wenn Irritationen, Konflikte oder Verwerfungen den Ablauf des Alltags ins Stocken bringen und sich jemand in seinen gewohnten, eingeschliffenen und häufig durchaus nützlichen Routinen unterbrochen sieht. In diesem Fall kommt noch hinzu, dass die Pandemie die Grundstruktur des urbanen Zusammenlebens pointiert unterstreicht. Auf diese Weise werden auch gleich noch diejenigen mobilisiert, die ohnehin schon etwas gegen das urbane Zusammenleben haben und sich familistisch-nationalistischen oder auch offen rassistischen Gesellschaftsmodellen verschrieben haben. Solche naiven Narrative versprechen nicht nur eine billige, sondern auch eine gefährliche “Reduktion der Komplexität”.
Literaturhinweis:
Bukow, Wolf-D.; Yildiz, Erol (2020): Von einer synchronen Quartierentwicklung zur Mobilitätswende. In: Wolf-D., Nina Berding (Hg.): Die Zukunft gehört dem urbanen Quartier. Springer VS S. 187ff.