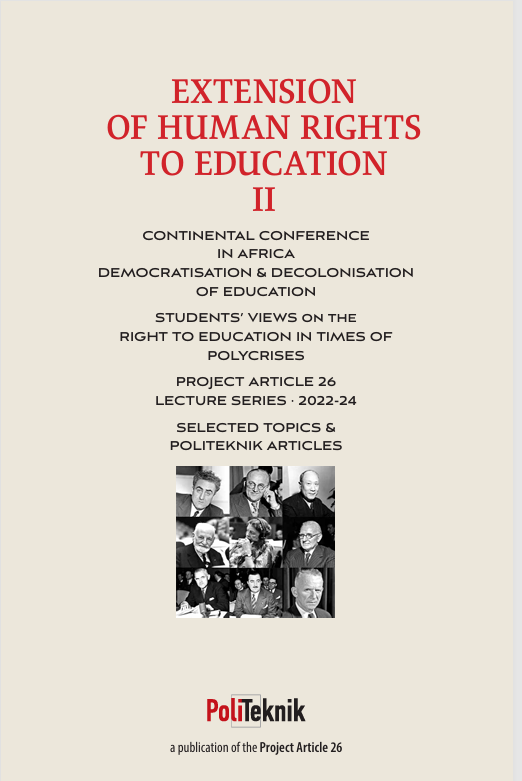Prof. Dr. Wolf D. Bukow – Universität Siegen
Das alltägliche Zusammenleben hat sich unter den Bedingungen fortschreitender Globalisierung und neuer technologischer Entwicklungen in vielerlei Hinsicht tiefgreifend verändert. Dies lässt sich schon an der weltweiten Kommerzialisierung des Alltagslebens ablesen. Es lässt sich vor allem aber – was das alltägliche Zusammenleben betrifft – an zwei Phänomenen erkennen, einerseits an einer radikal zunehmenden Mobilität und anderseits an einer immer fortschreitenden Diversität. Was die Mobilität betrifft, geht es von weltweit zunehmender Migration bis hin zu alltäglicher Pendler-Mobilität sowie einer immer begrenzteren Verweildauer vor Ort. Was die Diversität betrifft, so lässt sie sich zunehmend im sozialen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Zusammenhang beobachten. Längst wird von so etwas wie einer Super-Mobilität und einer Super-Diversität gesprochen. Beide Phänomene belegen jedenfalls, dass der urbane Alltag zu einem Fußabdruck globalgesellschaftlicher Wirklichkeit geworden ist (Berding, Bukow 2017). Beide Phänomene durchdringen immer mehr das Zusammenleben und tragen damit zu einem erheblichen gesellschaftlichen Wandel bei.
In einer Zeit wie dieser, in der ein so beträchtlicher, genauer ein so beschleunigter gesellschaftlicher Wandel stattfindet, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie mit den dadurch bedingten Veränderungen umgegangen wird. Wird der Wandel weiterhin als eine alle betreffende, als eine gemeinsame Herausforderung betrachtet, so bedeutet das, ihn weiterhin weitgehend wie selbstverständlich hinzunehmen, selbst wenn es Augenblicke der vorübergehenden Irritation geben mag. Wenn so reagiert wird, dann wird davon ausgegangen, dass sich letztlich alles weiterhin im Rahmen bewährter Routinen bewältigen lässt und das Zusammenleben grundsätzlich nicht gefährdet ist. Neue Sprachen und Lebensstile werden schnell alltäglich. Wird der beschleunigte Wandel dagegen als eine erhebliche Irritation betrachtet, dann ändert sich alles. Wenn so reagiert wird, dann wird befürchtet, dass die vorhandenen Routinen im Umgang mit Mobilität und Diversität partiell, generell oder sogar endgültig überfordert sind. Dann sieht man sich vor der Notwendigkeit einer mehr oder weniger umfassenden Neuorientierung. Neue Sprachen oder Lebensstile werden zu einer Bedrohung. Im ersten Fall wird einfach weiter auf die praktische Vernunft des Zusammenlebens und auf die ordnende Kraft einer bewährten Stadtgesellschaft vertraut – etwa nach dem Motto “es ist schon immer gut gegangen”. Es herrscht so etwas wie ein in der urbanen Wirklichkeit verankertes Grundvertrauen, was eine konstruktive Sicht der Dinge erlaubt. Das schließt durchaus kritisches Nachfragen mit ein, aber hier wird nichts grundsätzlich in Frage gestellt, sondern als praktische Herausforderung betrachtet. Im zweiten Fall wird ein völlig anderer Weg eingeschlagen, weil das Grundvertrauen in das Zusammenleben und die ordnende Kraft der Stadtgesellschaft verloren gegangen ist. Ohne ein ausreichendes Grundvertrauen wird plötzlich überdeutlich, dass sich ein gesellschaftlicher Wandel in sozialer und kultureller, in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht oft nur scheibchenweise, partiell, ungleichzeitig und ohne innere Konsistenz vollzieht, ja sich mitunter zunächst sogar im Verborgenen abspielt. Aus dieser Perspektive wird jeder soziale Wandel schnell zu einem Bedrohungsszenarium. Wie selbstverständlich verbietet sich der Rückgriff auf bewährte kollektive Routinen und eine pragmatische Umgangsweise. Es entsteht eine nachhaltige Verunsicherung, die noch dadurch verstärkt wird, dass man nicht mehr an eine von allen geteilte gesellschaftliche Wirklichkeit glaubt.
Tatsächlich haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten beide Umgangsweisen quer durch alle Schichten und Milieus zu geradezu konkurrierenden Modellen entwickelt:
a) Die einen bewegen sich auf der Basis einer von allen geteilten, globalisierten Wirklichkeit mehr oder weniger souverän und eher fraglos durch den Alltag Sie versuchen sich immer wieder neu zu arrangieren und effektiv zu platzieren. Sie lernen immer wieder aus der Alltagspraxis, entwickeln ein flexibles, je nach den lokalen Bedingungen durchaus differenziertes Weltbild. Die urbane Wirklichkeit, die ordnende Kraft der Stadtgesellschaft mit ihren Systemen (Arbeit, Wohnen, Verwaltung, Bildung…) bleibt für sie der entscheidende Möglichkeitsraum. Von dort her ist ggf. auch ein Engagement für eine emanzipatorische oder nachhaltigere Entwicklung zu erwarten.
b) Die anderen halten dieses ganze Vorgehen für problematisch, weil sie die erlebte Alltagsdynamik längst für beunruhigend, für befremdend, für aufoktroyiert und problematisch, für unvorteilhaft oder sogar statusgefährdend, also für schon im Ansatz falsch halten. Fast automatisch entstehen hier diffuse Ängste und es beginnt die Suche nach besonderen, “außeralltäglichen” Narrativen. Je nach der Bezugsgruppe sind es dann ggf. nostalgische, restaurative oder auch magische oder spekulative oder populistisch-radikale Deutungsmuster. Dass solche Deutungsmuster nicht aus dem Alltagsablauf entwickelt, sondern gleichsam von außerhalb abgerufen werden, macht die Dinge nicht einfacher. Es entstehen Zweifel, Realitäts-, Glaubwürdigkeits- und Legitimationsprobleme. Das wiederum verstärkt das Gefühl, überfordert zu sein. In einer solchen Situation liegt eine “Reduktion von Komplexität” nahe.
Während sich das erste Modell in die Logik urbanen Zusammenlebens (Bukow 2015) einfügt, wirft das zweite Modell erhebliche Probleme auf, die sich besonders dann einstellen, wenn man tatsächlich versucht, die Komplexität der Situation gemäß individueller Motivationslage zu reduzieren. Sehr schnell kommt es dann dazu, sich auf ganz bestimmte Wandlungseffekte zu konzentrieren und sie zur Bedrohung zu erklären. Dann kann man sie selektieren, isolieren und je nach dem skandalisieren. Auch hier ist der Umgang mit der Sprache ein gutes Beispiel. Dient die neue Handykommunikation dem eigenen Netzwerk, wird sie offensiv genutzt, dient sie Newcomern wie Flüchtlingen, so wird sie als Beleg für Integrationsresistenz skandalisiert. Am einfachsten lässt sich eine solche Reduktion von Komplexität zurechnungslogisch, ethnisierend organisieren: Die ausgemachten Wandlungseffekte werden verabsolutiert, um dafür bestimmte Personen und ihre individuelle Orientierung verantwortlich machen zu können. Dann kann man die so personalisierten Effekte ganzen Gruppen zuschreiben, sie insgesamt problematisieren und zum Schluss gruppenspezifisch als Fremde skandalisieren. Am Ende geht es fast immer darum, entsprechend konstruierte Gruppen ein- bzw. auszugrenzen, auf- bzw. abzuwerten, zu privilegieren bzw. zu diskriminieren, – also um so etwas wie Fundamentalismus auf technologisch höchstem Niveau. Ein erfolgreicher Umgang mit zunehmender gesellschaftlicher Vielfalt sieht anders aus.
Tatsächlich fragt sich, warum es überhaupt immer mehr zu dieser problematischen Strategie kommt, zu einer oft nur sehr selektiven, hier aber gleichzeitig oft sehr grundsätzlichen Ablehnung von Mobilität und Vielfalt. Es sind vor allem zwei zunehmend übliche Tendenzen, die dazu den Weg bereiten.
a) Die erste Tendenz besteht darin, den gesellschaftliche Wandel vor allem und völlig einseitig unter dem Vorzeichen von Einwanderung zu diskutieren (Reduktion der Mobilitäts- und Diversitätseffekte auf Einwanderungseffekte). Die Einwanderung ist zwar ein Indikator dafür, was fortschreitende Globalisierung alles impliziert, wer und was alles betroffen ist und was hier erforderlich ist, um das Zusammenleben zu sichern. Aber es muss allen klar sein, dass Einwanderung hier tatsächlich nicht mehr als ein Indikator ist. Alle sind mobil, der eine bringt neue Ideen aus dem Urlaub mit, der andere lernt sie über Nachbarn kennen, die eingewandert sind. Wieder andere übernehmen sie aus Kontakten in sozialen Netzen oder über die Medien generell. Letztlich sind alle, die Newcomer wie die schon länger vor Ort Verweilenden an dem massiven Wandel des urbanen Zusammenlebens aktiv beteiligt. Die eigentliche Herausforderung hat also gar nicht mit Einwanderung, sondern vielmehr damit zu tun, dass der urbane Alltag tatsächlich mehr und mehr – und zwar für alle – zu einem Fußabdruck globalgesellschaftlicher Wirklichkeit geworden ist und dass wir damit tagtäglich immer wieder neu umgehen müssen. In dieser Situation wird die gesellschaftliche Platzierung zu einem zentralen Thema für alle.
b) Die zweite Tendenz besteht darin, die zunehmenden Mobilitäts- und Diversitätserfahrungen zu verabsolutieren und dabei auszublenden, dass Mobilität und Diversität schon immer zu den Kernherausforderungen des Zusammenlebens gehören (Reduktion einer althergebrachten Herausforderung auf ein aktuelles Ereignis). Tatsächlich handelt es sich ja bei beiden Phänomenen um Themen, die Gesellschaften von Beginn an begleitet haben. Genauer gesagt: Tatsächlich waren die beiden Phänomene Anlass dafür, ein spezielles Gesellschaftsformat, nämlich die Stadtgesellschaften, überhaupt erst zu erfinden. Es ist kein Zufall, dass dieses Gesellschaftsformat heute zum global dominierenden Format avanciert ist. Im Grunde geht es also gar nicht darum, sich völlig neuen Herausforderungen zu stellen, sondern althergebrachten Herausforderungen zeitgemäß neu zu begegnen – Herausforderungen, die bislang unbekannte Dynamik zeigen. Es kommt dann darauf an, die Routinen im Umgang mit einem ständigen gesellschaftlichen Wandel immer wieder neu auszurichten, neu zu akzentuieren, sich darauf im urbanen Zusammenleben neu, dh. zeitgemäß und bewusster als bisher einzustellen. In diesem Augenblick wird eine faire und gerechte gesellschaftliche Platzierung erneut zu einem für alle bestimmenden Thema.
Für einen erfolgreichen Umgang mit der zunehmenden Mobilität und Diversität kommt es einerseits darauf an, die Stadtgesellschaft als Möglichkeitsraum zu stärken, sich für ihre Potentiale einzusetzen und den globalisierten Alltag sozial adäquat in den Blick zu nehmen und anderseits darauf an, die durch die beiden Tendenzen erzeugte Verschiebung der Blickrichtung zu dekonstruieren. Es geht dann darum, den von der praktischen Vernunft geleiteten Umgang mit Mobilität und Diversität im urbanen Zusammenleben als eine gemeinsame Herausforderung aller ernster als bisher zu nehmen und von dieser Basis aus das Zusammenleben der “Vielen als Viele” raum-, zeit- und situationsangemessen zu diskutieren.
Worum es bei einem konstruktiven Zusammenleben der “Vielen als Viele” geht, das lässt sich besonders gut an dichten und gemischten urbanen Quartieren erkennen, wo der gesellschaftliche Wandel face-to-face bis in die Vielfalt der Sprachen und Lebensstile hinein lebendig wird. Hier, wo es um den tagtäglichen Umgang miteinander und immer wieder neu um eine erfolgreiche Platzierung geht, hier ist der Umgang mit Mobilität und Diversität eine alltägliche Trivialität, aber natürlich auch eine alltägliche Herausforderung für die gesellschaftliche Konstruktion geteilter Wirklichkeit. Das Quartier ist dabei so etwas wie ein Testlabor für praktisches Zusammenleben genauso wie für die Konstruktion geteilter Wirklichkeit, z.B. für informelle Bildung. Alle müssen sich tagtäglich immer wieder neu arrangieren, immer wieder neue Erfahrungen verarbeiten. Was gestern noch als fremd oder ungewöhnlich empfunden wurde, ist heute im Quartier neu, morgen schon trivial und übermorgen selbstverständlich und zu einem festen Bestandteil einer geteilten Alltagswelt geronnen. Die Alltagsroutinen werden entsprechend ständig neu ausgerichtet, – auf mehr Mobilität und Diversität ein- und umgestellt. Das ermöglicht jedem, auch einem selbst, mehr Diversität und eigene Identität in Anspruch zu nehmen.
Am Quartier ist aber auch zu erkennen, wozu es führt, wenn man sich aus der Dynamik des urbanen Alltagslebens ausklammert, eigene Verhaltensweisen, Sprachgewohnheiten oder was auch immer für unveränderlich und allein richtig erklärt und sich von davon abweichenden Verhaltensweisen distanziert, Sprachgewohnheiten und Lebensstile anderer problematisiert und skandalisiert. Das leistet der Segregation und Exklusion zusätzlich Vorschub. Loic Wacquant spricht hier sogar von einer fortgeschrittenen Marginalisierung (Wacquant 2018:247ff). Im Schatten der oben skizzierten beiden Tendenzen nimmt genau dies zu und wird oft genug von einer populistischen Öffentlichkeit und Politik – von einem Regime der Marginalisierung – gezielt unterstützt.
Bei dem Umgang mit Mobilität und Diversität stellt offenbar die Sprache ein besonders plastisches Thema dar. In Stadtgesellschaften ist es ein geradezu klassisches Thema. Vor diesem Hintergrund ist sofort klar, welche Bedeutung der Umstellung des Bildungssystems auf Mehrsprachigkeit zukommt, auch wenn dies bislang erst im Kita-Bereich gelungen ist, aber auch schon im Primarbereich vorbereitet wird. Die Debatten im Umfeld des Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration unterstreichen das. Mit der Einführung der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem will man der urbanen Diversität, hier der sprachlichen Diversität, die in vielen Ländern schon immer aber eben auch in Deutschland seit der letzten großen Einwanderungswelle endlich bewusst geworden ist, endlich gerecht werden (Kane, Storch 2017: 8).
“Integration heißt explizit nicht die eigenen Werte zu verlassen oder mitgebrachte sprachliche Fähigkeiten zu verlieren.” (Ebd.S.9)
Mit diesem Konzept, nach dem die Haus- oder Familiensprache und die Verkehrssprache gleichberechtigt nebeneinander gefördert werden, wird der sprachliche Diversität gezielt Rechnung getragen. Aber es bleibt nicht dabei, bloß der Tatsache der Mehrsprachigkeit Rechnung zu tragen, sondern es wird auch die Quartiersituation, in der sich ja die Mehrsprachigkeit vollzieht und in der sie oft routinemäßig umgegangen wird, gleichzeitig quasi automatisch mit berücksichtigt. Und das ist didaktisch sogar zentral. So wie die Mehrsprachigkeit im Quartier unter dichten und gemischten Bedingungen praktiziert wird, so muss das Bildungssystem die Mehrsprachigkeit in dichten und gemischten Klassen organisieren. Und das gilt auch schon für Newcomer im Bildungssystem, also für gerade eingewanderte Kinder und Jugendliche. Auch hier ist jede Segregation oder Marginalisierung, wie sie immer wieder in sogenannten Vorbereitungsklassen praktiziert wird, kontraproduktiv.
Die eigentliche Pointe dieses Mehrsprachigkeitskonzepts besteht also darin, dass das Bildungssystem hier die urbanen Gegebenheiten systematisch reflektiert und im System abbildet und damit die Logik des urbanen Zusammenlebens gezielt stärkt. Damit wird das Vertrauen in die ordnende Kraft der Stadtgesellschaft ganz entscheidend gefördert. Zu Recht wird darauf verwiesen, dass das erstens der sozialen Integration im Milieu dient, zweitens aber auch indirekt dem Erwerb der Verkehrssprache und damit der Inklusion in die Arbeitswelt. Aus kanadischen Studien wissen wir, dass damit gleichzeitig auch die entsprechenden Menschen als Gesellschaftsmitglieder anerkannt werden, da die Sprache ein zentrales Element innerhalb jeder Persönlichkeit darstellt. Wenn also ein Bildungssystem auf Mehrsprachigkeit umstellt, so ist das ein zentraler Baustein für die Inklusion der “Vielen als Viele”, weil damit den betreffenden Bevölkerungsgruppen ein Recht auf ein faires und gerechtes Zusammenleben innerhalb des Quartiers und damit der Stadt eingeräumt wird. Zugleich wird damit ein Beispiel dafür gegeben, wie sich gesellschaftliche Systeme ausrichten müssen, um der Bevölkerung gerecht zu werden. Sie müssen sich immer wieder neu auf den urbanen Alltag als einem Fußabdruck gesellschaftlicher Wirklichkeit einstellen, um einer inklusiven Stadtgesellschaft gerecht werden zu können.
Literatur
Bukow, Wolf-Dietrich (2015): Mobilität und Diversität als Herausforderungen für eine inclusive city. In: Erol Yildiz und Marc Hill (Hg.): Nach der Migration. Postmigrantische Perspektiven jenseits der Parallelgesellschaft. Bielefeld: Transcript, S. 105ff.
Berding, Nina; Bukow, Wolf-Dietrich; Cudak, Karin (Hg.) (2017): Die kompakte Stadt der Zukunft. Auf dem Weg zu einer inklusiven und nachhaltigen Stadtgesellschaft. Wiesbaden: Springer VS
Wacquant, Loic (2018): Die Verdammten der Stadt: Eine vergleichende Soziologie fortgeschrittener Marginalität. Wiesbaden: Springer VS
Kane, Cissé Fatou, Storch, Anne (2017): Sprache, Migration, Gastfreundschaft. In: ZMI. Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration, Köln