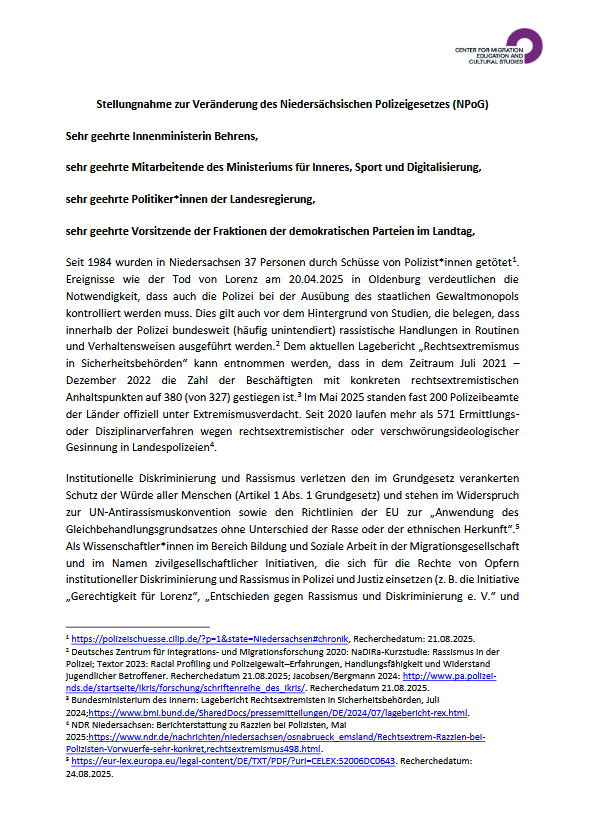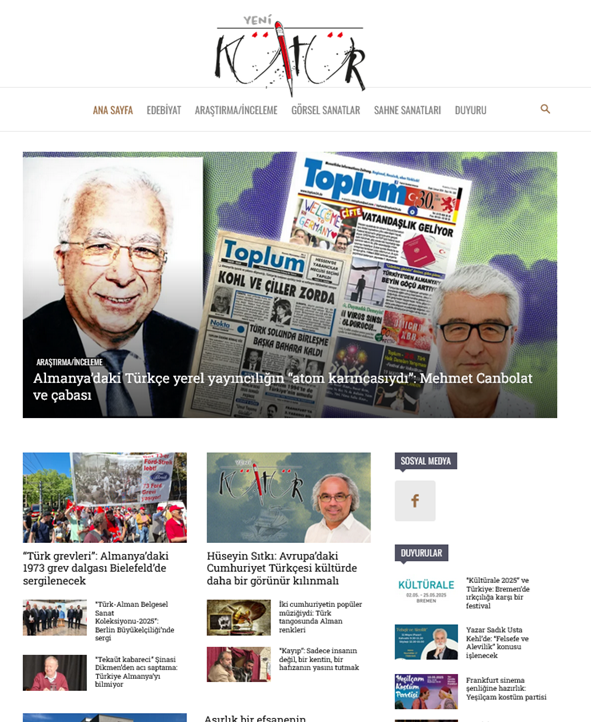Prof. Dr. Eva Borst | Üniversität Mainz
Es zählt schon immer zu den Aufgaben einer kritischen Wissenschaft, mit begrifflicher Anstrengung zur Entschleierung von Ideologien beizutragen, sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen und Widersprüche herauszuarbeiten. Dazu gehört auch, dass sie sich mit ideologisch aufgeladenen Wörtern beschäftigt, die, einmal ausgesprochen, tief in unserem Innern verankerte Emotionen ans Tageslicht zu holen vermögen, während freilich die Quelle der Emotionen im Dunkeln bleibt und sie daher politisch instrumentalisierbar sind. Zu diesen emotional hochaufgeladenen Wörtern gehört der Begriff „Heimat“, der entweder Vertrautheit oder Abwehr erzeugt, je nach dem, welche intellektuellen oder affektiven Erfahrungen mit diesem Begriff verbunden sind. In Deutschland zumal ist der Begriff „Heimat“ scheinbar irreversibel beschädigt. Er lässt uns ratlos zurück, verzweifelt und voller Unbehagen. Heimat klingt falsch, weil sie so vertraut ist mit dem Völkischen, diesem Irrwitz, der gnadenlos alles zerstört, was nicht passt und das Fremde in unbewohnbare Regionen verbannt, heimatlos macht, was niemals zuvor eine Heimat hatte. In ihrem Namen werden Verbrechen begangen, zu ihrer Verteidigung Menschen vertrieben.
Das Wort Heimat ist in unserer Erinnerung dunkel, ja unheimlich fast durch seine faschistische Inbesitznahme. Unheimlich ist aber auch die innerhalb nur eines Jahres zur neuen Größe im (partei)politischen Geschäft geronnene Formel von der Heimat, die zwar scheinbar inhaltslos daherkommt, dafür aber um so mächtiger an den altbekannten Assoziationen eines trüben Dualismus rührt, der den Widerspruch in sich trägt, ihn aber über propagandistische Steuerungs- und Manipulationsmechanismen nivelliert.
Wer an heimatliche Gefühle appelliert und zugleich die neoliberale Globalisierung preist, führt etwas im Schilde, das womöglich für die Bevölkerung wenig zuträglich sein wird, betrachten wir etwa die auf die Welt ausgeweiteten hegemonialen Bestrebungen der Bundesrepublik im Poker um Rohstoffe, um freien Zugang zu Handels- und Versorgungswegen und zur Verteidigung des Wohlstandes sowie zur Durchsetzung des Freihandels, ausdrücklich niedergelegt in den jüngst veröffentlichten Militärdoktrinen im „Weißbuch der Bundeswehr“ (2016). So verwundert es auch kaum, dass das für dieses Szenarium erforderliche Pendant zur angstbesetzten Globalisierung das der Heimat ist. Heimat verspricht in anachronistischer Abkehr von der Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen und der Pluralität menschlicher Erfahrungen den angestammten Menschen eine Bindung an ihresgleichen, sie verspricht Schutz und Vertrautheit in einer Gemeinschaft Gleichdenkender, die sich im globalen Wettbewerb zu behaupten hat. Systematisch wird der Begriff in einem geradezu atemberaubenden Tempo salonfähig gemacht, bis dahin, dass Deutschland nunmehr ein Heimatministerium sein eigen nennen kann, nicht ohne Stolz von den politischen Vertreter*innen medial in Szene gesetzt. Der Begriff wird auf diese Weise gezielt ohne jegliche Reflexion auf seine verheerende Wirkung im Nationalsozialismus mitten in die Gesellschaft geholt und von den sich jenseits jeglichen Populismus wähnenden Parteien CDU und SPD gleichermaßen in Anspruch genommen und die Grenzen zu rechtspopulistischen, rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Bewegungen aufgeweicht. Es ist also abwegig zu meinen, der Begriff sei im politischen Spektrum nur in der rechten Ecke zu verorten.
Wessen Schutz aber dient diese Form der Heimat, die just in dem Moment beschworen wird, in dem sich Deutschland für Kriege im Ausland rüstet? Welche Vertrautheit soll hervorgerufen, welche Gefühle entfacht werden? Zu welchem Zweck? Ganz offensichtlich scheint es sich zunächst um eine Beruhigungspille im allgegenwärtig zu befürchteten nationalen Aufstand gegen die neoliberale Ausplünderung weiter Teile der Bevölkerung zu handeln. Strategisch jedoch bedarf es eines inneren emotionalen Zusammenhalts gegen Bedrohungen von außen. (vgl. Weißbuch 2016) Heimat will schließlich verteidigt sein.
Wenn wir den Begriff der „Heimat“ inhaltlich nicht verloren geben wollen, und es wäre töricht, seine inhaltliche Ausgestaltung denjenigen zu überlassen, die mit den Begriff ihre eigenen barbarischen Zwecke verfolgen, wie können wir ihn so fassen und ausdifferenzieren, dass er nicht sogleich Assoziationen an die Scholle hervorruft? „Im Großen und Ganzen,“ so steht es im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, „haben der Zusammenbruch des sozialistischen Projekts als eines praktischen Versuchs, Heimat aufzubauen, und die damit einhergehende Erstarkung eines konservativen Heimat-Diskurses […] dazu geführt, dass die Linke aufgehört hat, die Dialektik um Heimat auch nur zu denken. Zurück bleibt meist Abwehr“ (Weber 2004).
Abwehr, verstanden als psychoanalytische Kategorie, bedeutet die Verdrängung von etwas ins Unbewusste, das nicht zum Vorschein kommen darf, von dem man aber ahnt, dass es im Innern wirkt und im ungünstigsten Falle das Gegenteil dessen heraufbeschwört, wogegen man sich wehrt: Hass schon gegen den Begriff der „Heimat“, aus Angst, man könne selbst heimatliche Gefühle angesichts eines bestimmten Erlebnisses oder einer beeindruckenden Begegnung entwickeln.
Damit aber wird eine anthropologisch nachgewiesene Eigenschaft des Menschen verleugnet, der angesichts seiner Fragilität eine Existenz in gesicherten sozialen Verhältnissen anstrebt. Ein in der kritischen Pädagogik und Bildungstheorie kaum ausgeleuchteter Aspekt ist der des Umgangs mit Emotionen, bezieht sich Gesellschaftskritik doch eher auf die gesellschaftlichen und materiellen Bedingungen des Menschen sowie auf seine Rationalität. Wo er aber seine emotionale Heimat finden, wie er sie also angesichts eines alles in Regie nehmenden Neoliberalismus begründen könnte, ist bisher kaum Gegenstand kritischer Erziehungswissenschaft.
Es nützt wenig, sich dem Begriff zu entziehen und der Selbsttäuschung zu verfallen, man habe mit den Inhalten, die er ausdrückt, nichts zu tun. Zudem ist nicht zu übersehen, dass der zum Zwecke seiner Reanimation in Zirkulation gebrachte Begriff Resonanzen in der Bevölkerung erzeugt, weil er reale Bedürfnisse anspricht und Menschen zu mobilisieren vermag. Dass diese Mobilisierung gegenwärtig im Namen rechtspopulistischer Bewegungen wie etwa PEGIDA gut funktioniert, sollte für eine kritische Pädagogik Anlass sein zu fragen, um welche Bedürfnisse es sich handelt. Wie hängen sie mit der Lebenswirklichkeit von Menschen zusammen, wie kann ihre Indienstnahme durch Herrschaft verhindert werden? Es kommt also darauf an, die vielfältigen Bedürfnisse zu ermitteln, die mit Heimat assoziiert werden, den Begriff weit zu fassen sowie seine Unverfügbarkeit für politische Instrumentalisierung zu festigen.
Mehr noch als der vor einigen Jahren von der Bertelsmannstiftung initiierte und an das Nationalgefühl appellierende Schlachtruf „Du bist Deutschland“, gemahnt der Begriff „Heimat“ an ein Gefühl der Zugehörigkeit, das nicht so ohne weiteres abzulegen ist. Die Distanzierung von Deutschland als Teil des Selbst mag einfach sein, nicht so aber eine Abkehr von der Heimat, denn sie entbehrt der Abstraktion, weil sie in jeder und jedem von uns wohnt: als Bedürfnis, als Sehnsucht, als Identität und Gefühl. Im Unterschied zu den abstrakten Kategorien ‚Vaterland‘ und ‚Nation‘, die mit der Lebenswirklichkeit von Menschen nichts zu tun haben, ist Heimat uns nicht äußerlich. Weder können die nationalstaatliche Herkunft und die ethnische Zugehörigkeit noch die regionale und familiäre Abkunft noch die Klassenzugehörigkeit Heimat begründen. Sie alle führen in die Sackgasse mythischer Verklärungen, derer wir schon so viele hatten, die soziale Diskriminierung und Ausbeutung zur Folge haben und Menschen nach ihrer Zugehörigkeit zu Klassen, Ethnien und Geschlecht selegieren.
Heimat lässt sich recht eigentlich nur im Widerspruch konkretisieren. Der Begriff erklärt sich über die historisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, er kann nur antidiskriminierend verstanden werden und muss politische und soziale Gerechtigkeit in einem sehr umfassenden Sinne miteinbeziehen. Das heißt, wer von Heimat spricht, kann nicht umhin, die materiellen Bedingungen, also die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse zu analysieren, unter denen ein Gedanke an Heimat überhaupt erst möglich werden kann. Aber Heimat bedeutet mehr als ein nur ein materiell abgesichertes Leben. Heimat bedeutet auch ein Gefühl, das ernst zu nehmen ist. Oder in den Worten Horkheimers: „Längst könnte es lauten: le planète natal, der Planet, auf dem wir geboren sind. Wird der Gedanke einer solchen Heimat einmal in die Herzen aufgenommen sein, dann könnte jene Solidarität entstehen, die der menschlichen Situation gemäß ist […]. (Horkheimer1985, S. 323)
Wir sind immer nur beides zugleich: heimatlich verbunden mit Personen, Orten und Sprachen, die wir lieben. Weil Heimat aber nie vollständig uns umhüllen kann, wie es uns der verführerische Mythos und seine Repräsentant*innen weis machen wollen, weil immer auch etwas Fremdes in uns ist, sind wir zugleich Heimatlose. Heimat ist gekennzeichnet von Friktionen, die sich an der Schnittstelle von Heimat und Heimatlosigkeit zeigen. Dieser Hiatus ist die notwendige Leerstelle, über die sich Heimat als ein menschenfreundliches Projekt konstituieren kann. Heimat ist, so gesehen, eine konkrete Utopie, die jeweils im schon Seienden wenn auch nur in der Vorstellung und verschoben in die Zukunft da ist. Heimat ist Hoffnung oder in den Worten Ernst Blochs: „Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ (Bloch 1993, S. 1628)
Es ist demnach völlig abwegig, Heimat als einen geschlossenen Begriff zu identifizieren, der über keinerlei inhaltliche Interpretationsspielräume verfügt, weil Heimat sich erst in gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen konstituiert. Sehnsüchte nach Vertrautheit, nach Geborgenheit und sozialer Sicherheit entsprechen menschlichen Bedürfnissen und müssen namhaft gemacht werden können, ohne sogleich Stigmatisierung zu fürchten.
Wie also sollten wir das Wort Heimat fassen? Ohne Ausgrenzung und ohne primitiven Parolen auf den Leim zu gehen? Mit welchen äquivalenten Formulierungen kann das Wort Heimat übersetzt und ausdifferenziert werden, damit es nicht ideologisch missbraucht werden kann? Auf das Wort gänzlich zu verzichten hieße, das Elend der Heimatlosen, der Vertriebenen, der Geflüchteten nicht mehr beim Namen nennen zu dürfen: dass sie nämlich ihre Heimat verloren haben, die ihnen von ihren Regierungen versagt bleibt.
Kann das Exil zugleich zur Heimat werden? Und was bedeutet Heimat für diejenigen, die auf die kruden Parolen der Rechten nicht hereinfallen wollen, aber dennoch ein wohliges Gefühl der Nähe im Gedenken an so etwas wie Heimat haben? Wie vielgestaltig kann Heimat sein?
Welche Antworten kann die Pädagogik auf die Grundfragen und Grundprobleme geben, die sich mit der erneuten Instrumentalisierung des Heimatbegriffes stellen? Wie wäre ein gesellschaftspolitischer Bildungsprozess anzulegen, der einerseits die hinter der Anziehungskraft des Heimatbegriffes stehenden Bedürfnisse kritisch aufgreift, andererseits seine politische Indienstnahme angreift? Welche Umorientierungen sind in der Theorie und in der Praxis der Pädagogik erforderlich, um das hinter dieser Kategorie sich verbergende gesellschaftliche Problem angemessen bearbeiten zu können?
Der Prozess der Erziehung und Bildung des Menschen nämlich kann als Vorgang eines beständigen Wechsels zwischen Beheimatung und Freisetzung begriffen werden. Keine Pädagogik ist denkbar, die nicht zunächst den Menschen in einer gesellschaftlichen Gruppe zu beheimaten versuchte. Ohne die Soziabilisierung des Menschen ist eine Grundlegung der menschlichen Persönlichkeit nicht möglich. Zugleich ist das Ziel der Pädagogik die Freisetzung des Menschen aus Abhängigkeitsverhältnissen jeglicher Art, d. h. dass die für die Subjektwerdung in der primären Sozialisation erforderliche Beheimatung, das „Verhaftetsein“ des Menschen in seiner unmittelbaren vertrauten Lebenswelt (Heydorn) überwunden werden muss, damit er in die Lage versetzt wird, seine Lebensbedingungen in Selbstbestimmung zu gestalten. Doch stellt diese Ermächtigung zur Selbstbestimmung wiederum eine höhere Stufe der Beheimatung dar, insofern der Mensch durch die Distanzierung von den Bedingungen seiner Lebenswelt diese überhaupt begreifen und in ihnen handlungsfähig werden kann.
Wenn wir über den Begriff „Heimat“ nachdenken, so müssen wir das in aller Differenziertheit tun. Dazu gehört erstens die ideologiekritische Auseinandersetzung mit seinem nationalen und faschistischen Erbe, aber auch mit der sich heute ausbreitenden Instrumentalisierung zur Abwehr von Fremdem und Fremden. Darüber hinaus gilt es, den Begriff gewissermaßen quer zu seinem allgefälligen Gebrauch zum Zwecke der Herrschaft nach der verwehrten oder der entfremdeten Heimat zu befragen, seine Ausschlusskriterien offen zu legen und Menschen an der Diskussion zu beteiligen, denen so etwas wie Heimat im nationalen Diskurs erst gar nicht zugestanden wird und die unter der unvergleichlichen sozialen Kälte eines autoritären Neoliberalismus leiden: Arme, Menschen ohne Obdach, Migrant*innen, Geflüchtete u.v.a.m.
Literatur:
Weißbuch (2016): Zur Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr.
Weber, Klaus (2004): Heimat, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, hrsg. von Wolfgang Haug, Bd. 6.1, Hamburg.
Bloch, Ernst (1993): Das Prinzip Hoffnung. Werkausgabe Bd. 5, Kapitel 43-55, 4. Aufl., Frankfurt am Main [1959].
Horkheimer, Max (1985): Der Planet – unsere Heimat, in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, hrsg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt am Main [1968], S. 319-323.