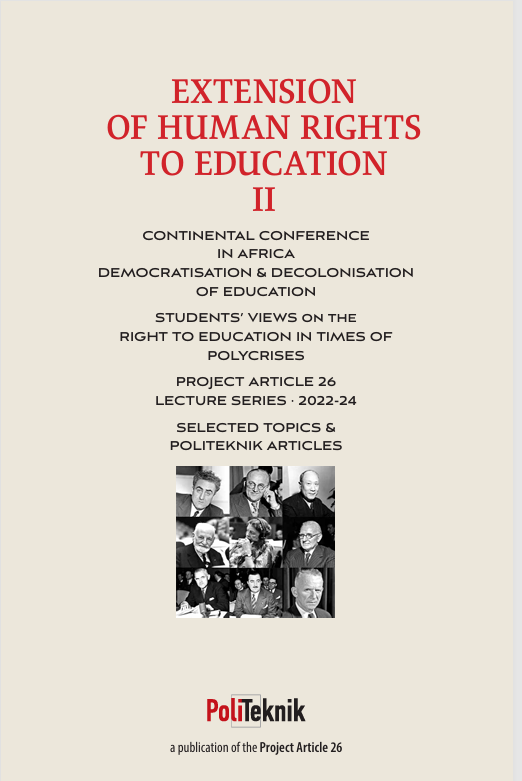Torsten Bultmann | Politischer Geschäftsführer des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi).
Seit dem späten 19. Jahrhundert übt eine spezifische Lobby maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Bildungspolitik aus, die der frühere hessische Wissenschaftsminister Ludwig von Friedeburg als »die Gymnasialfraktion« bezeichnet hat. Sie managet die Verteilung von Bildungschancen nach Prinzipien der Auslese und der Begrenzung von Klassenprivilegien über die strikte Drosselung des Zugangs zur gymnasialen Oberstufe, welche wiederum das traditionelle Monopol einer Verleihung der ›allgemeinen Hochschulreife‹ hat – und damit den Zugang zu den wichtigsten gesellschaftlichen (Führungs-)Positionen vermittelt. Das ist der entscheidende politische Impuls dafür, um entgegen allen sachlichen Argumenten und positiven internationalen Erfahrungen, die für eine integrierte und inklusive öffentliche Erziehung sprechen, an einem ›gegliederten‹ Schulsystem festzuhalten. Dass dieses im Kern eine soziale Selektion stabilisiert, muss folglich nicht erläutert werden.
Die Frage ist, wie lange das noch funktioniert? In allen kapitalistischen Ländern legitimiert das Bildungssystem soziale Ungleichheit, indem diese mit Bildungsunterschieden begründet und diese wiederum auf amtlich bescheinigte Unterschiede an ›Begabung‹ und ›Eignung‹ der jeweiligen Individuen zurückgeführt werden. Die Macht- und Eigentumsverhältnisse, die Ungleichheit hervorbringen, werden so entpolitisiert. Das ist jedoch nur die eine Seite. Gleichzeitig dient öffentliche Bildung der gesellschaftlich notwendigen Qualifikation von Arbeitskräften zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Produktionspotentials. Im Kapitalismus der letzten 150 Jahre bedeutete dies eine ständige konkurrenzgetriebene Modernisierungsdynamik, welche sich auch in einer Verlängerung und Intensivierung von Bildungszeiten sowie in einer Erhöhung des durchschnittlichen gesellschaftlichen Qualifikationsniveaus auswirkte. Vor dem Hintergrund, dass so eine dominante Ideologie der Selektion und der Zugangsbeschränkung zu höherer Bildung auch in Widerspruch zu gesellschaftlichen Entwicklungserfordernissen geraten konnte, war die administrative Begrenzung von Bildung daher zu unterschiedlichen Zeiten auch immer auf unterschiedliche Weise politisch umstritten.
Den größeren Teil des 19. Jahrhunderts hatten bspw. die humanistischen (d.h. altsprachlichen) Gymnasien mit Griechisch und Latein als Kernfächern das Monopol, die ›Hochschulreife‹ und damit eine Studienberechtigung zu erteilen. In dem Maße wie ein modernisiertes bürgerliches Erwerbsleben – kurz: die industrielle Entwicklungsdynamik – stärkere Kenntnisse in Naturwissenschaften und – vor allem – neuen Fremdsprachen erforderte, entstanden zu diesem Zweck – anfänglich zweitklassige – sog. Realgymnasien und Oberrealschulen, denen zunächst die Zertifizierung der ›allgemeinen Hochschulreife‹ verweigert – und nach langen Glaubenkriegen zunächst als fachgebundene, d.h. auf bestimmte Fächer eingeschränkte Hochschulreife zugestanden wurde. Ihre Gleichstellung erfolgte erst um die folgende Jahrhundertwende. Die ›Gymnasialfraktion‹ hatte es immerhin geschafft, den Streit auf die Frage des Umfangs gymnasialer Bildung zu begrenzen, ohne dass das Gymnasium als Institution selbst in Frage gestellt wurde. Nachdem es schließlich etwa in den 1950er Jahren in Westdeutschland nur 5 Prozent eines Altersjahrganges auf eine Hochschule schafften (heute: etwa 50 Prozent), stimmte auch die Wirtschaftslobby, die aufgrund des Mangels an akademischen Fachkräften um ihre internationale Konkurrenzfähigkeit fürchtete, in das Lamento einer ›Bildungskatastrophe‹ ein und forderte den Ausbau der Hochschulen. Deren soziale Öffnung wurde durch eine kurzzeitige starke Vermehrung der AbiturientInnenzahlen – bis Mitte der 70er auf zunächst ca. 20 Prozent – gewährleistet.
Wir erkennen an diesen Beispielen ein typisches Muster deutscher Bildungsreformen: gedanklich zwei Schritte vor – praktisch sofort wieder anderthalb ängstlich zurück. Die Schleusen ›nach oben‹ werden ein wenig geöffnet, gleichzeitig wird das Minderheitenprivileg höherer Bildung beibehalten, ebenso wie das gegliederte Schulsystem und der Grundgedanke der ›begabungsorientierten‹ Selektion insgesamt. Andere Industriestaaten führten im gleichen Zeitraum eine Einheitsschule ein. Der kürzlich verstorbene Siegener Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck hat diesen Sonderweg deutscher Bildungsreformen einmal als Strategie defensiver Modernisierung bezeichnet.
Die spannende Frage ist nun, ob wir aktuell wieder an einem solchen Scheitelpunkt stehen, wie er möglicherweise mit der Situation in den 60er Jahren vergleichbar ist? Das im internationalen Vergleich extrem selektive deutsche Bildungssystem mit der durch es gewährleisteten Produktion von drei schematischen Qualifikationsstufen wurde jahrzehntelang durch die sozialen Hierarchien und vorherrschenden Normalbiographien der traditionellen industriegesellschaftlichen Arbeitsteilung stabilisiert. Vereinfacht gesprochen produzierte diese die Unterscheidung in subalterne ausführende Tätigkeiten für eine gesellschaftliche Mehrheit (traditionell: die Arbeiterklasse), etwas weniger mittlere Büro-, Techniker- und Verwaltungsberufe und noch weniger hohe Leitungsfunktionen, die über das Wissenschaftssytem ausgebildet wurden. Leitbild für alle Hierarchiestufen war dabei der vollerwerbstätige männliche Familienernährer. Im Rahmen dieser Arbeitsteilung erschien es vordergründig funktional, dass nur eine soziale, männlich dominierte Minderheit an den Hochschulen ausgebildet wurde. Heute liegt die Studierendenquote im Durchschnitt der OECD bei etwa 60 Prozent pro Altersjahrgang.
Für die gegenwärtigen epochalen Umbrüche der gesellschaftlichen Arbeitsorganisation stehen in der öffentlichen Debatte überwiegend ideologisch vernebelnde Begriffe (›Informationsgesellschaft‹, ›Wissensgesellschaft‹) zur Verfügung. Weitgehend unbestritten ist allerdings, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Qualifikationen künftig wissensintensiv und wissenschaftsbasiert sein werden. Vor diesem Hintergrund wird in der Präambel des wissenschaftspolitischen Programms der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2009) zu Recht betont, dass einem internationalen Trend zufolge »das Hochschulstudium zur Regelausbildung für eine wachsende Mehrheit junger Menschen wird«. Damit ist sowohl die soziale Öffnung der Hochschulen als auch die Integration verschiedener Bildungsstufen, d.h. deren Durchlässigkeit ›nach oben‹, auf die Tagesordnung gesetzt. »Im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit der geringsten Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen«, beklagen etwa Industrieverbände und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2008 in einem gemeinsamen Memorandum. Die Wirtschaftsverbände sorgen sich natürlich um ihre internationale Konkurrenzfähigkeit. Aus dieser Perspektive kann durch die Schulstrukturen bedingte Unterqualifikation zu einem realen Problem werden. Das dürfen wir gerne als interessenbornierten Standpunkt betrachten. Ungeachtet dessen gilt jedoch: Die Problematik eines völlig veralteten Bildungssystems lässt sich nicht mehr aussitzen; dessen Funktionsweise steht im Ganzen zur Disposition, ein bloßes Herumflicken – wie etwa die kurzfristige Steigerung der Abiturientenzahlen – bei Konservierung der alten gegliederten Schulformen würde die Probleme nicht lösen.
Die hektischen Schulreformen, die derzeit stattfinden, sind sicher von Taktik und Inkonsequenz geprägt. Die teilweise Abschaffung der Hauptschule in einzelnen Bundesländern durch ›mittlere‹ integrierte Hybridgebilde – Stadtteilschule, Sekundarschule, Realschule plus etc. – beruhen in der Regel auf dem Kompromiss der geschilderten typisch deutschen Garantie des gleichzeitigen Fortbestandes der traditionellen Gymnasien neben den neuen Formen. Der politische Gedanke des längeren gemeinsamen Lernens in integrierten Schulformen ist jedoch nicht mehr aus der Welt zu bekommen und kann grundsätzlich – genügend öffentlichen Druck vorausgesetzt – auch die neuen Zwitterformen überwinden helfen. Zumal dann, wenn die makroökonomisch erforderliche Steigerung des Qualifikationspotentials mit den vorherrschenden Halbheiten nicht hinreichend gelingt. Es ist schließlich kein Zufall, dass derzeit gerade die Industrielobby Druck in Richtung stärkerer Integration organisiert. Anfang 2011 führten etwa die Bertelsmann Stiftung und Roland Berger Strategy Consultants (in Kooperation mit den Massenblättern BILD und Hürriyet) eine Online-Bürgerbefragung von fast 500.000 Beteiligten durch, deren Ergebnissen zufolge sich nur noch 32 Prozent der Befragten für eine Verteilung auf verschiedene Schulformen nach der vierten Klasse (45 Prozent nach der sechsten und 23 Prozent nach der zehnten Klasse) aussprachen. Im Februar 2010 veröffentlichten dann die Unternehmerverbände (BDA und BDI) ihr neues hochschulpolitisches Leitbild. Dessen Kerngedanke ist der Ausbau der Hochschulen (auch unter finanziellen Gesichtspunkten) bei ihrer gleichzeitigen Öffnung zur beruflichen Ausbildung in den Betrieben. Eine Berufsausbildung soll künftig ohne weitere formale Hürden als Berechtigung gelten, sich auf einen Studienplatz zu bewerben.
Mit einer sozialen Erweiterung des Rechtes auf Bildung und einer entsprechenden Stärkung der Bildungsteilnehmer und -teilnehmerinnen als Rechtssubjekte sind diese Ansätze nicht zwangsläufig verbunden, da etwa über die Vergabe von Studienplätzen künftig vollständig die Hochschulen selbst entscheiden sollen. Es handelt sich folglich in den wirtschaftsnahen Reformkonzepten in erster Linie um eine Modernisierung von Ausleseverfahren nach top-down-definierten Bedarfskriterien. Allerdings soll die soziale Basis der Auslese ›nach oben‹ gegenüber der traditionellen Schulformselektion erheblich verbreitert und damit das durchschnittliche gesellschaftliche Qualifikationsniveau angehoben werden. Das Ganze hätte positive und negative Nebeneffekte; positiv: die gesellschaftliche Vermehrung besserer Bildungschancen; negativ: die Verstärkung der Konkurrenz um höhere berufliche Positionen mit akademischer Qualifikation
Gelungen ist dies alles bisher nicht. Das deutsche Bildungssystem wird folglich weiterhin gesellschaftlich dysfunktional und instabil bleiben, öffentlich umstritten und von kontroversen Reformdebatten geprägt sein. Keine Tür ist dabei allerdings endgültig zugeschlagen. Dadurch kann auch grundsätzlich die Resonanz für emanzipatorische Reformkonzepte jenseits einer technokratisch-neoliberalen Mainstreampolitik verbessert werden.