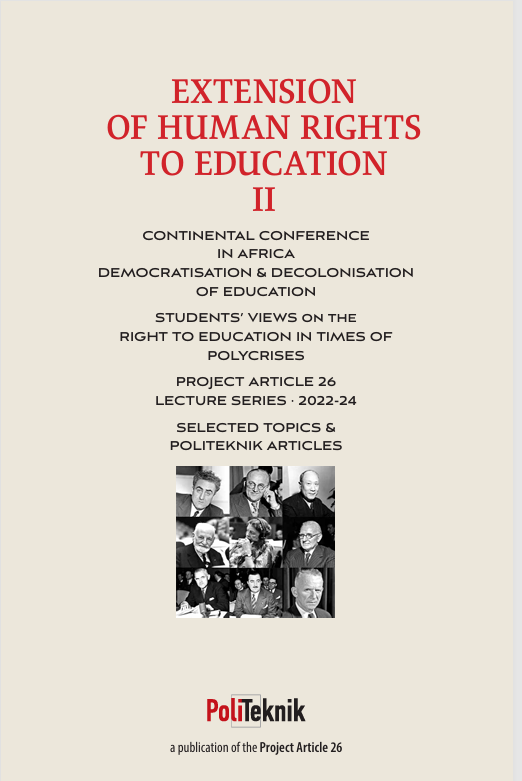Karl Brenke
Deutsches Institut für Wirtschaft
Den Meinungsumfragen zufolge schien alles in den eingefahrenen Bahnen weiterzulaufen. Noch kurz vor der Auszählung der Stimmen hatten die Demoskopen ein zwar knappes, aber doch eindeutiges Votum der britischen Bevölkerung für den Verbleib in der EU vorausgesagt. Als ich das im Fernsehen hörte, habe ich mich schlafen gelegt. Ich hatte die Nacht im spanischen Baskenland verbracht und wurde morgens von einer Gruppe fröhlich durch die Straße ziehender Jugendlicher geweckt. Als ich die hörte, war mir schon im Halbschlaf klar, dass die Briten für den BREXIT gestimmt haben mussten. Und dass sich manche Leute auch anderenorts darüber freuten, liegt daran, dass Stimmungen gegen eine als übermäßig wahrgenommene Zentralisierung politischer Entscheidungen überall in der EU verbreitet sind – in manchen Regionen wohl in besonderem Maße.
Eine solche Stimmung war auch die Triebfeder dafür, überhaupt ein Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU abzuhalten. Hinzu kommt, dass die Briten schon immer recht kritisch gegenüber der EU eingestellt waren – was sich daran ablesen lässt, dass sie wenig bereit waren, die üblichen Zahlungen in die Gemeinschaftskasse zu leisten. Sie hatten daher einen Zahlungsnachlass vereinbart; gleichwohl sind sie Nettozahler. Gewachsen ist die Distanz in der Bevölkerung gegenüber der EU noch dadurch, dass im Zuge der EU-Erweiterungsrunden von 2004 und 2007 zahlreiche Migranten aus Ost- und Südosteuropa ins Land kamen. Das führte zu einer verstärkten Konkurrenz in manchen Segmenten des Arbeitsmarktes: bei einigen Dienstleistungen (etwa im Gesundheitswesen), im handwerklichen Bereich sowie generell bei den eher einfachen Jobs. Vermehrte Konkurrenz zog einen Druck auf die Löhne und verschlechterte Beschäftigungschancen für die betroffenen heimischen Arbeitskräfte nach sich – was von denen natürlich nicht gern gesehen wurde. Überdies kam es auch zu Zuwanderungen in die Sozialsysteme. Trotz alledem: Womöglich hätte das Referendum einen zwar ebenfalls knappen, aber ganz anderen Ausgang genommen, wenn nicht eine weitere Entwicklung hinzugekommen wäre: die Asylwanderungen auf dem Kontinent, insbesondere nach Deutschland. Als der Zustrom nach Deutschland immer gewaltiger wurde, forderte die Bundesregierung eine gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber auf die Staaten der EU. Dem abschreckenden Beispiel der Politik der offenen Grenzen wollten die Briten aber nicht folgen – wie manche Regierungen anderer EU-Länder auch nicht. Zudem wurde in der Forderung wohl nicht selten auch als ein weiterer Beleg für eine deutsche Dominanz innerhalb der EU angesehen.
Die britische Regierung und die EU werden nun in Verhandlungen über den Austritt treten. Die EU hat deutlich gemacht, dass es keine Mitgliedschaft im gemeinsamen Binnenmarkt geben wird, wenn nicht die sog. anderen „Freiheiten“ erfüllt sind – also neben dem freien Warenverkehr auch die Freizügigkeit für Dienstleistungen, für den Kapitalverkehr und für Arbeitskräfte. Dass auf dieser Maximalposition beharrt wird, ist insofern verständlich, weil sich auch andere Staaten, die nicht zur EU zählen, an entsprechende Vorgaben halten – etwa die Schweiz oder Norwegen. Andererseits werden manche der „Freiheiten“ mitunter selbst innerhalb der EU nicht so genau genommen; beispielsweise ist es für EU-Bürger kaum möglich, in Dänemark ein Ferienhaus oder in Polen einen Acker zu kaufen.
Das Vereinigte Königreich wird die Bedingungen insbesondere mit Blick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht akzeptieren und somit zähneknirschend aus dem EU-Binnenmarkt ausscheiden. Man wird neue Handelsvereinbarungen mit der EU oder einzelnen ihrer Mitgliedsstaaten treffen müssen. Das kostet Zeit, und die nun folgenden zwei Jahre bis zum endgültigen EU-Austritt sind dafür eigentlich zu knapp bemessen. Auf jeden Fall werden sich für die Briten aber Handelsbeschränkungen mit Partnern in der EU ergeben. Das wird die Wirtschaftsleistung in UK auf jeden Fall dämpfen, denn der Export in den EU-Raum wird schwieriger und auf die Exporteure kommen somit höhere Kosten zu. Offen ist indes, wie weitgehend die Handelsbeschränkungen ausfallen werden. Die EU befindet sich bei den kommenden Verhandlungen in einer Zwickmühle. Einerseits besteht ein Interesse an einem möglichst „harten“ BREXIT, um andere Mitgliedsländer davon abzuhalten, dem britischen Beispiel des Austritts zu folgen. Da der internationale Handel keine Einbahnstraße ist, würde aber andererseits durch eine zu weitgehende De-Liberalisierung auch die Wirtschaft innerhalb der EU erheblich geschädigt. Immerhin verzeichnen insgesamt die anderen EU-Länder im Austausch mit UK einen deutlichen Außenhandelsüberschuss. Wegen der besonders engen Handelsbeziehungen wären vor allem Irland, kleinere Länder wie Malta und Zypern, die Niederlande, Belgien, Schweden und nicht zuletzt Deutschland betroffen. Für Deutschland ist UK das drittwichtigste Abnehmerland seiner Waren – und die Exporte dorthin sind doppelt so hoch wie die Importe von dort.
Mit dem Regierungswechsel in den USA ist ein weiterer Faktor hinzugekommen, der bei den anstehenden Verhandlungen von EU und UK beachtet werden muss. Denn die Regierung Trump hat in ihren ersten Verlautbarungen Zeichen gesetzt, die als protektionistische Bestrebungen gedeutet werden können. Wenn nun zwischen der EU und UK – also innerhalb Europas – größere Handelsbarrieren aufgebaut werden, könnte das von der US-Regierung als ein willkommenes Argument verwendet werden, um auch im Handel zwischen den USA und der EU zusätzliche Handelshemmnisse zu schaffen. Zugleich könnten die USA den Güteraustausch mit UK intensivieren – quasi als Gegengewicht zu den transatlantischen Beziehungen zur EU. Die Briten würde es freuen, da sie dann mögliche Lieferausfälle wegen des Wegfalls der EU-Binnenhandels teilweise kompensieren könnten.
Die US-Regierung hat durchaus ein Interesse, die EU und insbesondere Deutschland unter Druck zu setzen. Denn die großen Defizite der USA im Warenhandel mit der EU – neben denen im Austausch mit China und Japan – werden von Trump und seinen Mitstreitern als Ursache für den Niedergang der amerikanischen Industrie und den damit einhergehenden Arbeitsplatzverlusten angesehen. Deutschland ist speziell deshalb ins Schussfeld geraten, weil seine Währung als faktisch unterbewertet angesehen wird. Wäre Deutschland nicht Teil der Eurozone, hätte es also noch die D-Mark, dann müssten die deutschen Exporteure ganz anders kalkulieren: Bei einem höheren Außenwert der deutschen Währung würde die preisliche Wettbewerbsfähigkeit schwinden und es könnte weniger exportiert werden. Weil die Unternehmen von Ländern außerhalb der EU preislich günstiger wären, könnten sie auch vermehrt ihre Waren in Deutschland absetzen. Das Verhalten Deutschlands wird also als unfair angesehen.
Neu sind diese Vorwürfe nicht, und sie sind auch nicht falsch. Allerdings wurden sie bisher vor allem innerhalb der EU selbst erhoben – etwa in Frankreich oder in Italien. Denn tatsächlich hat sich Deutschland nach der Einführung des Euro gegenüber den anderen Staaten der Währungsunion dadurch Vorteile verschafft, dass die Löhne lange Zeit hinter dem Zuwachs an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zurückblieben. Das schwächte auch die Binnennachfrage in Deutschland und somit die Möglichkeiten von Unternehmen aus anderen Teilen der Eurozone, Waren nach Deutschland zu liefern. Wegen des in einer Währungsunion nicht stabilitätsgerechten Verhaltens türmte sich der deutsche Handelsüberschuss viele Jahre immer mehr auf; in der weltweiten Finanzkrise und einige Zeit danach nahm er ab – inzwischen wächst er aber wieder kräftig. Das kann durchaus als unfaires Verhalten und auch als wirtschaftliche Dominanz Deutschlands in der EU verstanden werden – zumal seitens der diversen EU-Administrationen nur hin und wieder einmal mahnend der Finger gehoben wird. Nicht auszuschließen ist, dass sich all dies auch bei den anstehenden Präsidentenwahlen in Frankreich bemerkbar machen könnte.
Ein zunehmender Protektionismus und eine De-Liberalisierung des internationalen Handels wäre historisch gesehen ein Rückfall. Denn freier Handel fördert den Wettbewerb, steigert somit den Wohlstand und treibt Innovationen an. Es muss beim Handel allerdings fair zugehen: Man darf sich nicht versuchen abzuschotten oder eigene Unternehmen bevorzugen, und man darf auch nicht versuchen, sich über die Wechselkurse Vorteile zu verschaffen. Denn unfaires Verhalten wird – beim Sport wie in der Wirtschaft – über kurz oder lang immer Gegenreaktionen der Konkurrenz hervorrufen.