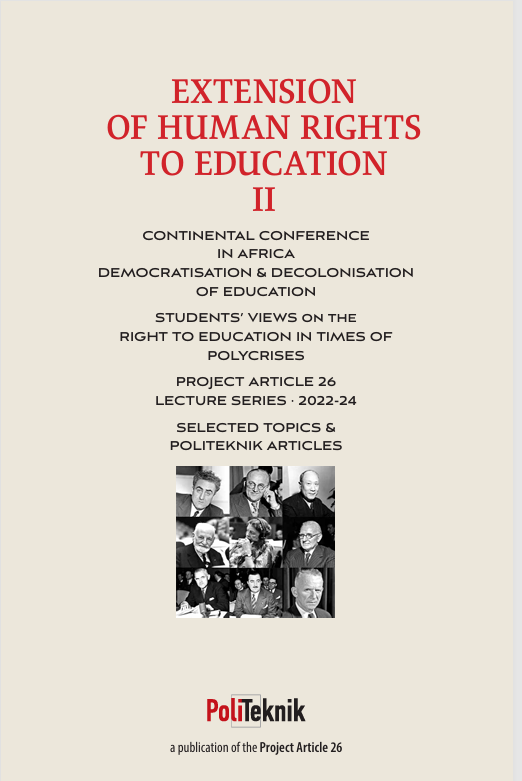Wolfgang Kaschuba
Humboldt-Universität zu Berlin
In diesen Wochen im Januar 2016 sind Stefano und Abdullah ziemlich unruhig. Nicht nur deshalb, weil in der Winterpause nicht nur wieder einmal der Winter pausiert, sondern auch die Bundesliga. Und meine beiden Freunde wüssten zu gerne, ob der unerwartete Höhenflug von Hertha BSC vor Weihnachten auch im neuen Jahr weitergeht. Nein, unruhig macht sie vor allem auch die Frage, wie es in Berlin insgesamt weitergeht mit den vielen Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan, die auch in diesem Januartagen immer noch ankommen. Das bleibt das Thema, das die Stadt und das aus auch Stefano und Abdullah beschäftigt: Wie wird dieses Jahr, wie wird diese Sommer hier Berlin, wenn so viele Neue und so viel Neues in die Stadt einziehen?
Dabei kennen sich beide mit dem Neu-Sein selbst noch gut aus. Abdullah kam als junger Mann 1970 als Gastarbeiter aus Izmir nach Berlin: fremd und eingeschüchtert, mit nur wenig Deutschkenntnissen und Berufserfahrungen. Heute ist er der Wirt eines Speiselokals in Kreuzberg. Und Stefano verließ in den 1980er Jahren sein süditalienisches Dorf Richtung Stuttgart, um später in West Berlin und nach einigen anderen Berufstationen schließlich als Taxifahrer heimisch zu werden.
Beide haben also „Fremdheit“ erlebt. Beide kennen die Erfahrung, dass vor allem älteren Menschen in Deutschland offenbar Herkunft und Muttersprache so wichtig sind, dass sie immer noch an jenen Satz glauben: „Deutscher wird man nicht, Deutscher ist man“. Also allein durch Geburt und Abstammung. Und die lassen sich bekanntlich ja nicht nachträglich korrigieren.
Beide sind dennoch Deutsche geworden. „Neue“ Deutsche eben, wie so viele in diesem Deutschland, das seit mehr als 100 Jahren schon ein klassisches Einwanderungsland ist, das dies jedoch bis vor wenigen Jahren noch hartnäckig verleugnet hat. Hunderttausende Polen nach 1900 im Ruhrgebiet, 12 Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene nach 1945 allein in Westdeutschland und fast 10 Millionen „Gastarbeiter“ in den 1960er und 1970er Jahren: Das sind nur die nackten Zahlen der großen Einwanderungsbewegungen des 20.Jahrhunderts. Und schon sie zeigen, wie viele Deutsche also „migrantischen Hintergrund“ besitzen und welch enormes Maß an Migrationserfahrung bereits in Deutschland vorhanden ist.
Man hätte diese Erfahrung, dieses Wissen sehr viel früher nutzen können, um in Situationen wie der heutigen nicht wieder die Fehler von gestern zu machen: Flucht und Einwanderung nämlich nicht wieder in bedrohlichen Bildern von „Flutwellen“ und „Lawinen“ zu diskutieren, das Einheimische nicht „biodeutsch“ gegen das Fremde zu setzen, die Lager und Heime nicht als Getto zu betreiben und Integration nicht als Einbahnstraße zu verstehen. Damit sind wir schon früher nicht gut gefahren und tun dies auch heute nicht.
Das sehen auch Abdullah und Stefan so, weil sie sich durchaus noch an das eigene frühere Leben in den Wohnheimen und Nissenhütten am Stadtrand erinnern können. Aber sie sehen zugleich heute eben auch Gefahren für die gesellschaftliche Situation in Deutschland wie für ihre eigene – Gefahren, die sie mit diesen großen Flüchtlingszahlen in Zusammenhang bringen.
Einige Gründe dafür liegen auf der Hand. Denn Restauration und Taxibetrieb sind schon mal zwei Arbeitsfelder, die klassische Einstiegsjobs für Einwanderer verkörpern. Abdullah und Stefan müssen da zwar wohl nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten, aber sie sehen verstärkte Konkurrenz voraus. Ähnlich wie auf dem Wohnungsmarkt: Beide wohnen mit ihren Familien zur Miete. Und der Druck wird dort gerade im unteren Marktsegment sicherlich zunehmen, wenn zu den Hunderttausenden Familien und Singles, die auf Sozialmiete angewiesen sind, und zu den 180.000 Studierenden in der Stadt Berlin noch 60-80.000 Flüchtlinge hinzukommen. Und auch was da „religiös“ ankommt, ist ihnen nicht so ganz klar. Beide gehen selbst eher entspannt mit ihrer muslimischen und katholischen Glauben um, der sie jedenfalls selten in die Moschee oder die Kirche führt. Ob die Flüchtlinge, die Neuen damit ähnlich umgehen, wissen sie jedoch nicht.
So fragen die beiden also mit vielen anderen: Was machen wir nur mit so vielen neuen Flüchtlingen in Deutschland? Und das ist insofern bemerkenswert – und damit verlassen wir die beiden –, als dieses „wir in Deutschland“ nun plötzlich und fast hinter unserem Rücken zu einer neuen Integrationsformel geworden ist. „Wir in Deutschland“: Das meint nun diejenigen, die „schon immer“ oder jedenfalls „schon früher“ da waren. Und zwischen dem „Immer“ und dem „Früher“ wird der Graben offenbar zunehmend kleiner, weil beides nun eher die Alteingesessenen meint, die nun ein wenig zusammenrücken – auch gegen die Neuen.
Dieser Reflex ist nicht ungewöhnlich. Das war auch früher schon so: Erst als die noch fremderen Gastarbeiter zum Ende der 1950er Jahre in Deutschland ankamen, wurden die Flüchtlinge und Heimatvertriebene von 1945 – wie etwa auch meine Eltern – allmählich als zugehörig akzeptiert. Und erst da begann auch eine Zeit, in der hier geborene Kinder wie ich nicht mehr explizit auch als „Flüchtlinge“ beschimpft und ausgegrenzt wurden. Meine Eltern wie ich, wir waren damals jedenfalls auch froh darüber, dass wir nun nicht mehr die Außenseiter waren. Und auch wir waren den italienischen, türkischen und spanischen Arbeitern damals dafür einerseits dankbar. Andererseits aber mussten auch wir befürchten, dass die Einheimischen angesichts dieser weiteren Zuwanderung dies als „Überfremdung“ betrachten und auch gleich uns ältere „Neue“ auch wieder ausschließen könnten.
Dies ist heute nicht viel anders. In allen Gesellschaften und besonders auch in der deutschen ist das Schubladendenken in Begriffen von Herkunft und Sprache, Religion und Pass noch keineswegs abgebaut. Wer türkisch oder arabisch spricht, wird fast automatisch verdächtigt, deshalb auch nicht korrekt deutsch sprechen zu können. Fremd klingende Namen erschweren den Zugang zu Jobs wie Wohnungen deutlich – selbst noch im selbst ernannten Weltstädten wie Berlin. Und Beziehungen und Heiraten „quer“ zu ethnischen Grenzen oder sexuellen Orientierungen sind nach wie vor alles andere als unkompliziert – in dieser Hinsicht sind sich allerdings biodeutsche und migrantische Milieus noch recht ähnlich. Dies zeigen jedenfalls die Befunde unserer Forschungen in den letzten Jahren sehr deutlich.
Dennoch hat sich viel verändert. „Gesellschaft in Deutschland“ meint heute eine sehr viel offenere Landschaft, in der die Neuen heute und im Unterschied zu den Flüchtlingen 1945 wie den Gastarbeitern der 1960er Jahre auch viele offene Türen finden. Gerade in den Städten haben wir längst Bevölkerungsmischungen, die sich weniger am Unterschied in Herkunft und Pass aufhalten, als vielmehr nach Gemeinsamkeiten in den privaten Interessen und Lebensstilen fragen. Vor allem in den jüngeren Generationen spielen Musik- und Modegeschmack, Internetwelten und Netzwerke, Esskultur und Selfie mittlerweile die Rolle von tatsächlich „Identität“ stiftenden gemeinsamen Alltagsstrukturen. Denn es ist eben diese offene Kultur des Alltags, die uns – ganz anders als noch in den 1960er Jahren – heute immer wieder neu in Kontakt zu einander bringt und verbindet.
Natürlich kann diese Kultur umgekehrt auch trennen. In Einwanderungsgesellschaften sind Konflikte ebenfalls Alltag. Das hat damals die Gastarbeitergeneration häufig genug erlebt. Und Konflikte gibt es auch heute. Manchmal noch in durchaus extremer Form: PEGIDA- Anhänger kennen zwar kaum eine Kirche von innen, vor der sie das christliche Abendland verteidigen wollen, und sie haben auch zwar noch kaum einen Flüchtling leibhaftig gesehen. Doch ihre Ängste und Vorurteile wollen sie auf jeden Fall schon einmal zu Protokoll geben und ausleben – gerne auch aggressiv.
Dagegen sollten wir mehr als bisher tun: unsere gemeinsame Einwanderungsgesellschaft in die Mitte unseres Deutschlandbildes rücken und die hartleibigen Biodeutschen an dessen Rand. Aber wir sollten darüber nicht vergessen, dass uns in den letzten Jahren bereits gemeinsam eine ganze Menge „Deutschland“ auch ganz gut gelungen ist. – Deshalb – das geht im Flüchtlingsdiskurs gerne unter – wollen wohl auch so viele Menschen zu uns kommen.