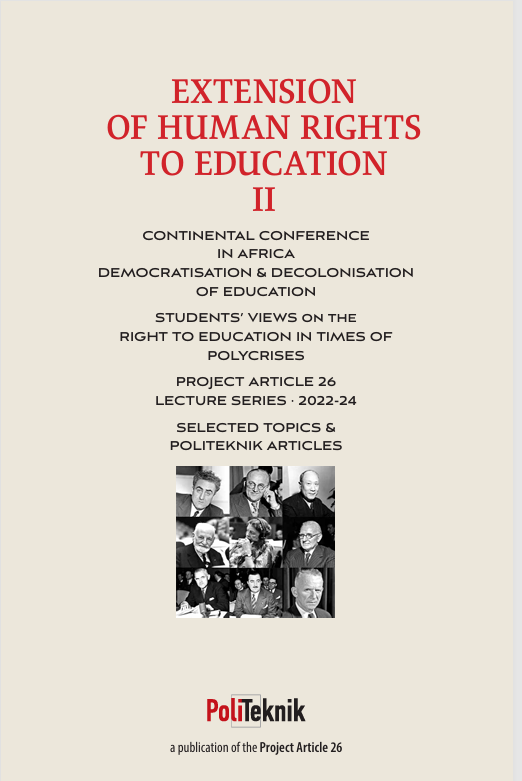Prof. Dr. Ernst Apeltauer
Universität Flensburg
Ich bin ein Deutscher: aufgewachsen mit Grimms Märchen und Elvis Presley,
Karl May und General Eisenhower, Wagner und James Dean.
Botho Strauss, Herkunft 2014, 66
Einleitung
Die Bezeichnung interkulturelle Kommunikation bezieht sich auf Begegnungen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Mit Kultur wird dabei auf Lebensformen verwiesen, die explizit oder implizit sein können. Dazu gehören Traditionen, Werte, Normen, Denkautomatismen (z. B. Vorurteile) und Rituale. In manchen Kulturen werden Gefühle durch Gestik und Mimik verstärkt (z. B. in Italien), in anderen werden Gestik und Mimik nur zurückhaltend gebraucht (z. B. in Schottland). Wie wir etwas wahrnehmen und ausdrücken, wird von unseren kulturspezifischen Programmierungen beeinflusst. Nicht nur Wahrnehmungen, auch Erwartungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen sowie unser alltägliches Verhalten ist geprägt durch Automatismen, die wir im Laufe der Sozialisation entwickelt haben.
Kulturen sind aber keine einheitlichen, statischen Gebilde. Jede Kultur weist viele Varietäten auf, „gleichzeitige Ungleichzeitigkeiten“ wie Cees Noteboom einmal sehr treffend formuliert hat. Lebensformen oder Einstellungen, die in Großstädten nicht mehr existieren, können 50 Kilometer außerhalb (in Kleinstädten oder Dörfern) noch gefunden werden. So war es in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in deutschen Großstädten beispielsweise schon üblich, dass Pärchen auch ohne Trauschein zusammen lebten. In Kleinstädten und Dörfern hingegen wurden Mieter zur selben Zeit noch darauf hingewiesen, dass Damen- oder Herrenbesuch nach 22 Uhr verboten ist. Kurz: Je nach Zeit und Ort, nach Bezugsgruppe und Schicht finden wir unterschiedliche Ausprägungen einer Kultur, die durch aktuelle Interaktionen noch zusätzlich verändert werden können, wie neuere Forschungsergebnisse zeigen. Demnach kann kulturelle Zugehörigkeit nicht immer als etwas Gegebenes betrachtet werden. Auch sie kann durch Aktualisieren und Aushandeln verändert werden. Im Unterricht werden sich deutsche Kinder (mit Deutsch als Muttersprache) und Kinder von Zuwanderern (mit Deutsch als Zweit- oder Drittsprache) oft kaum unterscheiden. In Konfliktfällen könne aber Gräben plötzlich sichtbar werden, die zuvor überdeckt waren oder ignoriert wurden. In solchen Fällen können auch situationsspezifische kulturelle Mischformen entstehen. Kurz: Kultur ist kein homogenes, klar abgrenzbares Phänomen, sondern etwas Vielgestaltiges, Oszillierendes, das sich täglich verändert und das doch gleichzeitig über eingeübte Rituale und Automatismen unser Wahrnehmen, Empfinden (z. B. Scham), Denken (z. B. Stereotype) sowie unsere Erwartungen und unser Alltagsverhalten beeinflusst. Je vielgestaltiger eine Gesellschaft wird, je mehr neue Mitglieder aus anderen Kulturen zuwandern und ihren Beitrag zur Entwicklung und Veränderung einer Kultur und Gesellschaft leisten, desto vielfältiger werden auch kulturelle Gegebenheiten und Bezugsgruppen, an denen sich einzelne Individuen orientieren. Es entsteht das, was Verdovec „Superdiversity“ genannt hat. Wer heute durch Innenstädte in Berlin, Paris, London oder Istanbul geht, kann diese Superdiversity nicht mehr übersehen. Dagegen wird man in nahe gelegenen Kleinstädten oder Dörfern noch auf ältere (homogeneren) Formen stoßen, die von der dort wohnenden Bevölkerung vielleicht noch für „das Normale“ gehalten werden, während die hybriden Formen in den Großstädten von solchen Menschen häufig als bedrohlich erlebt werden.
Neben der Bezeichnung interkulturelle Kommunikation gibt es auch die Bezeichnung cross cultural communication. Vertreter dieser Richtung beschäftigen sich mit Themen wie Geschäftsbesprechung und wie diese in ausgewählten Kulturen ablaufen. Aus solchen Beschreibungen werden dann Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Bezeichnung cross cultural communication wird vor allem in der business communication verwendet. In Pädagogik und Lehrerausbildung spricht man dagegen von interkulturellerKommunikation bzw. vom „Ausbildungsziel interkulturelle Kompetenz.“ Im einen Falle wird das Überbrückende (cross) betont, im anderen Falle eher Gegensätze (inter). Als Merkmale interkultureller Kompetenz (und als Ausbildungsziele) gelten „gute Sprachkenntnisse“ sowie „aktives und passives Beherrschen der nonverbalen Kommunikationsformen der fremden Kultur.“ (Eppenstein 2007, 31) Solche Ausbildungsziele lassen sich leichter formulieren als erreichen. Wer würde z. B. von sich behaupten wollen, dass er alle Formen nonverbaler Kommunikation in Deutschland oder der Türkei „aktiv und passiv“ beherrscht? Da Kulturen weder homogene noch statische Gebildes sind, muss gefragt werden: Alle Formen aller Regionen? Sätestens an dieser Stelle dürfte deutlich werden, dass die Formulierung von Eppenstein wenig durchdacht ist.
Verbale und nonverbale Kommunikation
People typically gesture when they speak,
not when they are silent.
Marianne Gullberg
Gewöhnlich gilt Sprache als das wichtigste Medium zur Verständigung, auch über Kulturgrenzen hinweg. Experten gehen jedoch davon aus, dass ca. 70 % – 80 % der „face to face communication“ über nonverbale Kanäle (visuelle, auditive, haptische und/oder olfaktorische) abgewickelt werden und dass in Zweifelsfällen, wenn verbale und nonverbale Botschaften widersprüchlich sind, den nonverbalen Botschaften mehr Gewicht beigemessen wird.
In Fällen, in denen ein Gesprächspartner etwas nicht oder nicht ganz verstanden hat, wird entweder nachgefragt oder es wird die gehörte Äußerungen paraphrasiert, um den Gesprächspartner so indirekt aufzufordern, die Paraphrase zu bestätigen oder zu korrigieren. Da aber beide Vorgehensweisen den Kommunikationsfluss unterbrechen, wird in vielen Fällen nur eine Verlagerung der Aufmerksamkeit vom verbalen auf den nonverbalen Bereich erfolgen, z. B. auf den Ton, mit dem etwas gesagt wird oder auf die begleitende Gestik. Manchmal hilft eine solche Verlagerung, um gehörte Äußerungen eines Gesprächspartners besser verstehen zu können. Wenn verbale und nonverbale Botschaften aber nicht übereinstimmen, können dadurch beim Zuhörer Unsicherheiten entstehen, durch die der Fortgang der Interaktion erschwert wird.
Was für die intrakulturelle Kommunikation (d. h. die Kommunikation zwischen Mitgliedern einer kulturellen oder subkulturellen Gruppe) gilt, gilt in verstärktem Maße für interkulturelle Kommunikation, weil sich Sprachen, Kommunikations- und Interaktionsformen unterscheiden und dadurch auch mehr Irritationen und Missverständnisse entstehen können. Nehmen wir z. B. den verbalen Bereich. Jemand ist krank. Dann wünscht man ihm in Deutschland gute Besserung. In der Türkei gibt es das Äquivalent geçmiş olsun. Aber jeder in der Türkei Aufgewachsene weiß auch, dass man dem Kranken nach überstandener Krankheit nochmals gute Besserung zu wünschen hat. Wird es unterlassen, gilt das als unhöflich. Wenn ein Fremder (Deutscher) das gelernt hat, kann er es dennoch vergessen, weil er es noch nicht automatisiert hat. Erst wenn die sprachliche Formel wiederholt gebraucht wurde, wird sie allmählich automatisiert und Teil eines Rituals werden.
Bei der Vorbereitung auf Auslandsaufenthalte genügt es daher nicht, dass Ausdrucks- und Verhaltensweisen bewusst gemacht und isoliert vermittelt werden. Es genügt nicht, dass man weiß, welche Unterschiede es zwischen Kulturen gibt. Es muss auch gelernt werden, wie man in diesen anderen Kontexten zu handeln hat und dass die Verständigung in diesen Kontexten nicht nur mit Hilfe der fremden Sprache (oder einer Ersatzsprache wie „broken English“), sondern auch durch begleitende, wohl abgewogene Mimik, Gestik und Körperhaltung erfolgt. Fremdsprachenunterricht konzentriert sich i. d. R. auf die Vermittlung sprachlicher Ausdrucksfähigkeiten, auf Wortschatz und Grammatik und vernachlässigt nonverbalen Aspekte der Verständigung, obwohl sie für eine genauere Interpretation (oder Kalibrierung) von Äußerungen oft von großer Bedeutung sind.
Gesten und Anzeichen
In der nonverbalen Kommunikation werden drei Bereiche unterschieden: 1. Ein symbolischer und 2. ein redebegleitender gestischer Bereich sowie 3. Anzeichen.
1. symbolische Gesten
Als symbolische Zeichen gelten Gesten (auch Embleme genannt), die über eine konventionelle Bedeutung verfügen und zielgerichtet (intentional) gebraucht werden. Beispielsweise wird die Ringgeste (Daumen und Zeigefinger bilden einen Ring, die anderen Finger sind gestreckt) in Mitteleuropa dazu verwendet, um etwas positiv zu bewerten. Eine Lehrkraft in Deutschland kann zu einem Schüler sagen: Sehr gut. Sie kann die Äußerung durch die Geste unterstreichen oder die Geste alleine verwenden. Schüler werden sie verstehen. In anderen Regionen der Welt wird dieselbe Geste zum Ausdruck von o.k. oder von Null bzw. wertlos verwendet. In der Türkei wird die Geste als obszönes Zeichen gedeutet (vgl. Morris u. a. 1980, 99 ff.). Will man in der Türkei oder in Griechenland mit einer Geste zum Ausdruck bringen, dass etwas gut oder hervorragend ist, wird die Handbörse gebraucht (die Fingerspitzen werden an den Daumen gelegt und zeigen nach oben). In Süditalien wird die gleiche Geste dazu verwendet, um nachzufragen (z. B. auch nach dem Befinden). Und in Nordwest-Frankreich wird die Geste als Ausdruck für Angst gedeutet (Morris u. a. 1980, 43 ff.).
Solche Gesten (bzw. Embleme) haben also konventionelle Bedeutungen und können sprachliche Äußerungen ersetzen. Sie erscheinen uns aufgrund unserer eigenkulturellen Erfahrungen allgemein verständlich. Sie werden aber – je nach Region – höchst unterschiedlich gedeutet. Allerdings lassen sich emblematische Gesten wie Vokabeln lernen, wodurch Missverständnisse in diesen Bereichen verringert werden können.
2. Redebegleitende Gesten
2.1 redebegleitende Gesten des Sprechers
Gesten, die ein Sprecher parallel, zuweilen auch vor- oder nachlaufend zu Äußerungen produziert, gelten als redebegleitend Redebegleitenden Gesten können kulturspezifisch überformt sein, sie können aber auch nicht konventionalisiert sein. Auffallend sind z. B. Gesten wie die sich öffnende Handbörse bei gestikulierenden Italienern, die im Takt der Rede verwendet wird oder die in Deutschland zunehmend häufiger zu sehende Faust, von der Daumen und kleiner Finger abgespreizt werden, eine Geste, die in Schulterhöhe oder in Höhe des Gesichts oder beim Ohr produziert wird und mit der z. B. „wir telefonieren“ oder „wir bleiben in Kontakt“ oder „hab ich so gehört“ übermittelt werden kann.
Redebegleitende Gesten übermitteln oft gleiche (oder ähnliche) Bedeutungen wie die verbalen Aussagen. Es gibt aber auch Fälle, wo durch Gesten oder Intonation zusätzliche Informationen (z. B. über räumliche oder zeitliche Verhältnisse) gegeben werden oder von den verbalen Botschaften abweichend Informationen (z. B. Ironiesignale). Schließlich gibt es auch Taktgesten (z. B. Handgesten; eine ähnliche Funktion kann das Heben und Senken des Kopfes haben), die das Segmentieren von Äußerungen für den Zuhörer erleichtern können.
Wie grundlegend das Gestikulieren für die menschliche Kommunikation ist, wird deutlich, wenn ein Stotterer eine Hemmung durch Gesten (z. B. eine Taktgeste mit der Hand oder durch Aufstampfen mit dem Fuß) überwindet oder es zum Abbruch des Gestikulierens und Sprechens kommt, weil eine Hemmung nicht überwunden werden kann. Neurokognitive Untersuchungsergebnisse lassen vermuten, dass das Gehirn Sprechen und Gestikulieren in ähnlicher Weise verarbeitet und dass Sprechen und Gestikulieren auf einer kognitiv-begrifflichen Ebene gemeinsam konzipiert werden.
Vergleichende Untersuchungen haben gezeigt, dass in Frankreich, Holland und Schweden mit Gesten vermehrt auf Handlungen (bzw. Verben) verwiesen wird, in Japan hingegen eher auf nominale Ausdrücke. Kurz: „Speakers of different languages have different gestural repertoires partly for linguistic reasons.” (Gullberg 2008, 283)
2.2 redebegleitende Hörer-Gesten
Gesten werden auch von Hörern redebegleitend gebracht, z. B. um Rückmeldungen (feedback) zu geben. Ob man zur Bestätigung mit dem Kopf nickt oder den Kopf von einer Schulter auf die andere wiegt (wie in Indien), ob man bei Nichtverstehen z. B. ein hm (im deutschen Kulturraum mit steigender Intonation) hören lässt oder die Augenbrauen hebt oder vielleicht den Kopf etwas in den Nacken hebt (wie im türkischen Kulturraum), hängt also von der jeweiligen Bezugskultur und Region ab. Und da Formen der Rückmeldung ebenfalls hochgradig automatisiert sind, werden wir bei Stress oder Müdigkeit solche Rückmeldungen von Mitgliedern einer anderen Kultur u. U. übersehen oder falsch deuten.
3. Anzeichen und Verhalten
Während Gesten gut sichtbar sind und auf Videoaufnahmen auch eingefroren werden können, sind Intonation, Rhythmus und andere „Anzeichen“ (z. B. Körperhaltung, Körperdistanz, Blickverhalten u. ä. m.) schwieriger zu erfassen und zu beschreiben. Und doch können uns solche Anzeichen Hinweise auf die Gestimmtheit (bzw. Befindlichkeit) eines Gesprächspartners geben, die für die Interpretationen seiner Äußerungen wichtig sein können, ob sie z. B. als „ernst gemeint“ oder als „nicht ernsthaft“ oder gar als „Täuschungsversuch“ zu klassifizieren sind. Zu den Anzeichen gehören Phänomene, die wir i. d. R. nicht willkürlich beeinflussen, z. B. tiefes Durchatmen nach bestandener Prüfung oder rot werden aus Scham oder zunehmend hektisches Gestikulieren bei Aufregung oder Unsicherheit.
Wir wollen diese Zusammenhänge einmal am Beispiel des Blickverhaltens erläutern. In Deutschland werden Kinder dazu erzogen, dem Gesprächspartner in die Augen zu sehen, vor allem dann, wenn der Eindruck entstanden ist, dass das Kind die Unwahrheit sagt. Ein Kind lernt also, jemandem in die Augen zu sehen, um seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Folglich wird das Kind sich auch später als Erwachsener so verhalten.
In der traditionellen (ländlichen) türkischen Gesellschaft ist der Blickkontakt anders geregelt. Älteren Menschen gegenüber hat man den Blick zu senken und ein Mann sollte, wenn er eine fremde Frau begrüßt, ihr nicht in die Augen sehen. Man kann sich unschwer vorstellen, was passiert, wenn sich so erzogene Menschen aus Deutschland und der Türkei begegnen. Der eine versucht, dem anderen in die Augen zu schauen. Der Andere versucht, dem auszuweichen. Bei beiden wird das Verhalten des Anderen Irritationen auslösen.
Gehen wir nun davon aus, dass eine Studentin in Deutschland in ihrem Vorbereitungskurs für den Aufenthalt in der Türkei gelernt hat, ihr Blickverhalten bewusst zu steuern und so den anderen kulturellen Regeln anzupassen. Das wird von einem türkischen Gesprächspartner wahrscheinlich positiv registriert werden. Doch da Blickverhalten hochgradig automatisiert ist, wird sich das Blickverhalten der Studentin ab und an auch wieder verselbständigen. Und gerade dieser Wechsel zwischen korrektem und inkorrektem Blickverhalten wird auf Seiten des türkischen Gesprächspartners Irritationen auslösen. Durch das vorbereitende interkulturelle Training kommt es also zu Verhaltensänderungen, die letztlich Irritationen verstärken, statt sie abzumildern. Ein Abbau solcher Irritationen setzt voraus, dass dieses wechselnde Blickverhalten bewusst wahrgenommen und thematisiert wird und dass der betroffene Gesprächspartner (in diesem Falle die Studentin) sich auf ein solches „Klärungsgespräch“ einlässt und nicht abblockt, weil sie denkt, dass ihr Gesprächspartner sie „anmachen“ will.
Neben diesem eher regelorientierten Verhalten gibt es aber auch spontanes, emotional gesteuertes Blickverhalten, z. B. beim Flirten. In der Forschung geht man davon aus, dass solches Verhalten nicht (oder nur wenig) kulturspezifisch ist und man mit ihm daher auch kulturelle Grenzen leichter überwinden kann. Tatsächlich konnte Ekman zeigen, dass Einwohner Neu-Guineas in den Gesichtern von US- Amerikanern besser „lesen“ konnten als US-Amerikaner umgekehrt (vgl. Ekman 2010). Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass Japaner in Gesichtern von Europäern besser lesen können als diese umgekehrt in japanischen Gesichtern (vgl. Argyle 1979, 80 f.). Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass in der japanischen Kultur Gestik und Mimik einen höheren Stellenwert haben als in europäischen Kulturkreisen. Jedenfalls scheint es nonverbale Bereiche zu geben, die über Kulturgrenzen hinweg leichter gedeutet werden können und solche, die schwieriger einzuordnen sind.
Solche Phänomene und Zusammenhänge werden heute gewöhnlich in Kursen zur interkulturellen Kommunikation thematisiert und es wird versucht, die Teilnehmer solcher Trainingskurse mit Interaktionübungen „umzuprogrammieren“. Wie sich solche „Vorbereitungskurse“ in der Praxis längerfristig auswirken, darüber ist wenig bekannt. Gemessen werden meist nur Kurzzeitwirkungen (d. h. Veränderungen am Ende der Veranstaltung). An der „kulturellen Programmierung“ wird man damit aber allenfalls an der Oberfläche kratzen.
Wie sehr uns kulturelle Programmierungen durchdringen, lässt sich anhand des Körperrhythmus zeigen. Wir wissen heute, dass Kinder bereits vor der Geburt, vor allem aber während des ersten Lebensjahres Sprach- und Körperrhythmus von der Mutter übernehmen. Wenn eine Mutter sich mit ihrem Kind beschäftigt, es z. B. windelt, so redet sie mit ihm und bewegt sich in einem bestimmten Rhythmus. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte nachgewiesen werden, wie Kleinkinder ihre spontanen und noch unkoordinierten Bewegungen allmählich diesen „vorgelebten“ Rhythmen anpassen, d. h. ihre Bewegungen mit denen der Betreuungsperson synchronisieren. Beiläufig werden dabei auch der typische Sprachrhythmus und die typische Sprachmelodie erworben.
Wie stark solche Programmierungen wirken, mag folgende Anekdote verdeutlichen. Während eines Beschneidungsfestes in Deutschland spielte eine türkische Musikkapelle. In einer Tanzpause eilten einige türkische Kinder auf die Tanzfläche und fingen an zu tanzen. Ein etwa gleich altes deutsches Mädchen ging ebenfalls auf die Tanzfläche. Es merkt aber rasch, dass die Musik irgendwie anders war und ihre eigenen Bewegungen nicht mit denen der anderen Kinder übereinstimmten. Ihre Bewegungen verlangsamen sich, bis sie schließlich stehen blieb und den anderen zusah, ehe sie traurig vom Platze ging. Ihr Körperrhythmus hatte nicht zu dieser „fremden“ Musik und zu diesem „fremden“ Rhythmus gepasst.
Es gibt „interkulturelle Experten“ (z. B. Agar), die behaupten, dass sie ihren Körperrhythmus beliebig verändern können. Nach unseren eigenen langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen bei Auslandsbesuchen mit Studierenden bin ich dagegen überzeugt, dass unser jeweiliger Körperrhythmus (ähnlich wie Blickverhalten oder Körperdistanz) tief programmiert und darum nur schwer veränderbar ist. Zwar können wir unser Verhalten kurzzeitig bewusst steuern und so vielleicht auch versuchen, den eigenen Körperrhythmus zu verändern. Längerfristig werden i. d. R. aber „eingefahrene Automatismen“ wieder die Oberhand gewinnen, allenfalls wird ein ambivalentes Verhalten entstehen, das oben im Zusammenhang mit dem Blickverhalten der deutschen Studentin geschildert wurde.
Was können wir aus all dem lernen? Bei Begegnungen und Gesprächen mit Menschen (nicht nur aus erkennbar andren ethnischen Gruppen oder Kulturen sondern auch aus unserer eigenen, zunehmend diverse werdenden Kultur) sollten wir lernen, mit Irritationen zu leben, uns in Geduld üben und mehr Toleranz entwickeln. Das könnte uns helfen, uns in einer „superdiversity“ Gesellschaft zu verständigen, ohne dass gleichzeitig irgendwelche Alarmsirenen in unseren Köpfen (oder Herzen) ausgelöst werden, uns Stress verursachen und eine Verständigung unnötig erschweren.
Literatur
Argyle, Michael 19792: The Psychology of Interpersonal Behavior; Harmondsworth: Penguin
Apeltauer, Ernst 1995: Nonverbale Aspekte interkultureller Kommunikation. In: Rosenbusch,
Heinz, S./ Schober, Otto Hrsg.: Körpersprache in der schulischen Erziehung;
Baltmannsweiler: Schneider, 100 – 166.
Eckman, Paul 2012: Gefühle lesen, Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren;
Heidelberg: Spektrum
Eppenstein, Thomas 2007: Interkulturelle Kompetenz – Zumutung oder Zauberformel?
In: Zacharaki, Ionna/ Eppenstein, Thomas/Krummacher, Michael Hrsg. 2007:
Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen; Schwalbach/Ts:
Wochenschau Verlag, S. 29 – 43.
Gullberg, Marianne 2008: Gestures and Second Language Acquisition. In: Robinson, Peter/
Ellis, Nick eds.: Handbook of Cognitive Linguistics and Second Langauge Acquisition;
New York, London: Routledge, 276 – 306.
Morris, Desmond/Collett, Peter/ Marsh, Peter/ O´Shaughnessy, Marie 1980: Gestures; New
York: Stein & Day