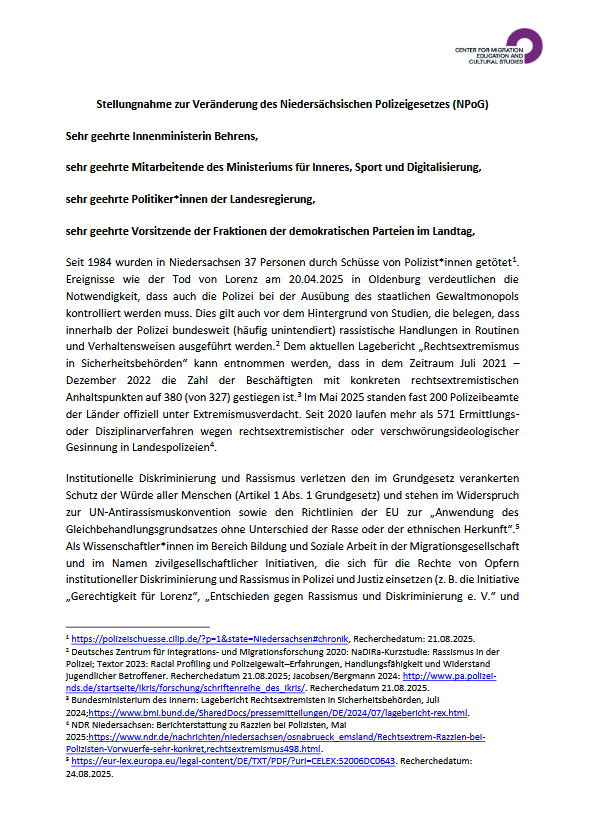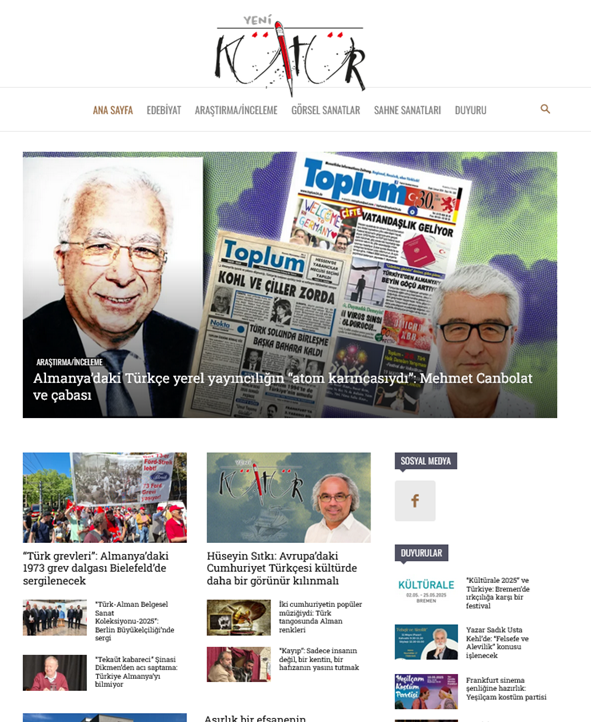- Zwei Jahre vor seinem Tod veröffentlichte der französische Philosoph Michael Serres ein kleines Büchlein mit dem Titel „C’était mieux avant“, das in der deutschen Übersetzung den Titel erhielt: Was genau war früher besser?Ausnahmsweise eine Übersetzung, die den Inhalt besser getroffen hat als die ursprüngliche Überschrift. Denn Serres war bestimmt kein blinder Befürworter der Gegenwart, allzumal der Moderne, wohl aber ein kritischer Beobachter allzumal aktueller kommunikativer Prozesse in den sozialen Systemen.
Nüchtern gesagt rechnet Serres in diesem Büchlein mit all jenen Klagen ab, die der Vergangenheit nachweinen, das frühere Leben als ein besseres loben, nicht zuletzt als besonnener oder gar tugendhafter. Mithin in einem Muster, das bekanntlich schon Rousseau gewählt hatte, um sein ziemlich grausames Experiment an dem kleinen Emile zu entwerfen; dem Aufklärer der Aufklärung ging es schließlich darum, durch eine der Natur verpflichtete Erziehung einen Zustand wieder zu erreichen, der angeblich in der Antike gegeben war. Zumindest wenn man davon absieht, dass dort Sklaverei herrschte, die Mehrzahl von Menschen von demokratischer Mitwirkung ausgeschlossen war, um von den kriegerischen Auseinandersetzungen ganz zu schweigen, die die Welt in ihrem Tagesgeschehen durchaus beherrschten.
Kurz: die Welt der Vergangenheit war selten edel und gut; das Argument von Serres hatte schon immer seine Berechtigung. Und, ja, manchmal darf und sollte man den lebenden Zeitgenossen vertrauen, ebenso sogar ein wenig Hoffnung auf die Zukunft haben. Fortschritt könnte durchaus möglich sein – vielleicht kommt es auf uns selbst an, um entsprechende Initiativen zu ergreifen und zu verwirklichen.
- Was das nun mit der PoliTeknik, ihrem zehnjährigen Jubiläum und den nicht nur achtundreißig Ausgaben dieser Zeitschrift sowie einem längst weltweiten Umfeld zu tun hat, in welchem es um die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung geht? Einiges. Zunächst einmal allerdings, dass man, dass ich Michel Serres in einem Punkt widersprechen muss – um ihm dann doch beizupflichten. Auch wenn seine Diagnose zutrifft, dass es in der Vergangenheit keineswegs besser gewesen ist, gleich welchen Bezugspunkt man wählt, so lässt sich eine Beobachtung kaum vermeiden: Bis in die neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, selbst noch in den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts waren die öffentlichen, die akademischen, manchmal sogar die privaten Kommunikationsprozesse offener und differenzierter als dies heute der Fall ist. Zwar darf man sich nichts vormachen: Die politischen Verhältnisse waren eher starr, allzumal in Deutschland, nach der langen Zeit der Kohlregierung breitete sich nach einem kurzen Zwischenspiel die bleierne Ruhe der Merkel-Ära aus, der im Nachhinein wohl attestiert werden muss, dass wohl so jede notwendige Entwicklung versäumt wurde; gleich in welchen Bereich wir sehen, der das Leben der weiten Kreise der Bevölkerung berührt. Die nötigen Veränderungen in Sachen Bildung, Gesundheit, Umwelt, im Blick auf die Infrastrukturen einer Gesellschaft, die Ermöglichung von Prozessen der Demokratisierung – all das ist weitgehend ausgesessen worden, um endgültig ein Modell der politischen und sozialen Ökonomie durchzusetzen, das – ein wenig unglücklich – mit dem Begriff des Neoliberalismus bezeichnet wird, als marktradikaler Kapitalismus besser getroffen wird, das vor allem mit einer weitreichenden Durchsetzung von individualisierenden, als Singularisierung sogar gefeierten Konsumkultur verbunden ist – die sich bei näherer Betrachtung dann doch als Wiederkehr nicht nur einer ungebremsten Klassengesellschaft mit allen diese ideologisierenden, daher von den Betroffenen selbst gläubig gefeierten Elementen erweist, sondern vor allem mit Akten systematischer Verblendung und Entmündigung einhergeht, die man für kaum möglich gehalten hätte..
Dennoch gilt zugleich: Die in diesen Jahrzehnten geführten politischen Diskurse verdienten diesen Namen eher als das Geschehen heute. Weil in ihnen Kontroversen ausgetragen wurden, der Widerspruch nicht bloß erlaubt, sondern gefordert wurde, um die Auseinandersetzung nicht still zu stellen, sondern so in Gang zu halten, dass mehr Einsichten möglich wurden, dass vor allem Entscheidungen doch immer noch revidiert wurden. Das Denken wurde als Prozess gefordert und gefördert, auch wenn manche damals schon beklagte, dass zu viel geredet und zu wenig getan worden sei. Gegenwärtig beobachten wir hingegen eine Erstarrung der Positionen, eine Hypermoralisierung, etwa in den Feststellungen von Identität und deren Festsetzung, ein Überschwang an Aufmerksamkeit und Sensibilität, der nicht zu Aufmerksamkeit und Sorge um andere führt. Eine Erstarrung, die gleichsam von vornherein das Bessere weiß. In fataler Mischung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Tugend, einerseits, in der Behauptung von Partikularem, andererseits, das mit Abschottung, manchmal schon mit Ablehnung, zuweilen einem schier fassungslos stimmenden Hass einhergeht.
Statt die Frage darnach aufzuwerfen, ob und wie es uns allen gemeinsam gelingen kann, in kluger, abwägender, prüfender Absicht Entwicklungen voranzutreiben, mit welchen möglichst viele Menschen, vielleicht – diese Hoffnung auf Utopie sei erlaubt – alle, zugleich jede und jeder Einzelne erleben können, was ein gutes Leben bedeuten könnte.
Also: Serres kritisiert zurecht jene, die nur in der Vergangenheit das Bessere suchen und finden wollen. Nur für die jüngere Gegenwart hat er gleich doppelt unrecht, verfehlt eine Dialektik: Da, eben vor wenigen Jahrzehnten, also noch kürzlich war eine Denk- und Redefreiheit gewonnen, die nun zu verschwinden droht. Insbesondere etwa an den Universitäten, den Hochschulen und in den Schulen. Da macht sich Besserwisserei breit, verbunden mit schrecklichstem Tugendterror – was immer darauf hinausläuft, dass die Vielfalt des Denkens nicht nur im Allgemeinen, sondern auch noch in jeder Einzelnem und jedem Einzelnen verloren geht. Die einen sagen dann, dass man nichts mehr sagen dürfe, die anderen beklagen, dass sie schon selbst die Schere im Kopf einsetzen; mit politischen Lagern hat das übrigens schon nichts mehr zu tun, sondern mit höchst eigenartigen Glaubensbekenntnissen, ironischerweise in einer säkularisierten Gesellschaft. (Wobei, um die Ironie des Geschehens zu steigern, das Problem sogar in dieser Säkularisierung und dem damit einhergehenden Glauben in die Eindeutigkeit von Rationalität liegen könnte; im Verlust der Mehrdeutigkeit, wie man mit Thomas Bauer festhalten möchte.)
- Noch einmal: was hat das mit der PoliTeknik und den von ihr initiierten Projekte zu tun? Mit Zeynel Korkmaz und all seinen Mitstreitern – und, der Vorbehalt sei nicht verschwiegen, viel zu wenig Mitstreiterinnen? So ziemlich alles! Die PoliTeknik ist eine Zeitschrift, die diesen – in der nun etwas zurückliegenden Vergangenheit möglich gewordenen – offenen, kritischen, kontroversen Diskurs weiterführt, Überlegungen sichtbar macht, weniger als Positionen, sondern als Denkanstöße – denen man nicht immer folgen muss. Aber darin liegt gerade die Bedeutung eines solchen Mediums: Dass sie an Dialektik, an Spannungen, Widersprüchen festhält, sozusagen den Zwang ausübt, sich eben nicht dem einen oder dem anderen Gedanken zu beugen, sondern auf die Nebensätze, die Seitenbemerkungen und die Relativierungen achten lässt. Weil es um diese meist eher geht, als um das, was in der Hauptsache vermeintlich eindeutig erscheint.
So gesehen ist die PoliTeknik ein vielleicht nur kleiner, aber wichtiger Leuchtturm in einer Gesellschaft, die eben zu erstarren droht – obwohl sie vielleicht doch viel offener ist, als dies zuweilen erscheint. Die zu erstarren droht, weil in ihr auf das Selbstdenken verzichtet wird, weil manche auch schon Sorgen haben, dass sie mit eigenen, ungewöhnlichen Gedanken, mit Ideen und Vorschlägen zwischen die Mahlsteine derjenigen geraten, die sich schon immer als die Besseren gefühlt haben; wobei irritierenderweise die alten Unterscheidungen zwischen links und rechts nicht mehr so recht funktionieren, das Denken und Reden in Offenheit daher erst recht notwendig wird.
- Die PoliTeknik ist ein Medium, das Bildung ermöglicht; Bildung als einen Vorgang der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit anderen Positionen und Ideen, immer in der Absicht, einander kennen zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, gemeinsam zu lernen und sich zu entwickeln. Das nun aber zeichnet ganz besonders das von ihr, das von Zeynel Korkmaz initiierte Projekt zur Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung aus. Ich will gar nicht verhehlen, dass es mich lange Zeit ein wenig irritiert hat, weil es in ihm zu allererst darum ging und immer noch geht, eine Kommunikationsstruktur herzustellen. Partner zu finden, die in das Gespräch um die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung einzutreten. Mir schwebt eher vor, Positionen, auch kontroverse und dialektisch widersprüchliche einzubringen und vorzutragen, möglicherweise – so viel Selbstkritik muss sein – mit dem Gestus desjenigen, der es ein wenig besser weiß. Man verzeihe mir dies – es handelt sich um das, was man déformation professionelle nennt, eine Haltung, zu der man als (nunmehr länger: ehemaliger) Hochschullehrer unvermeidlich kommt. Man muss ja etwas beibringen, selbst wenn man den Studierenden die größtmögliche Freiheit einräumen möchte.
Aber: Das Projekt zur Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung bietet zunächst eine Plattform, auf der möglichst viele Stimmen zu hören sind, sozusagen polyphon. Eine Technik des Gesprächs, wobei allein schon dies verblüfft: dass und wie Menschen inzwischen aus allen Weltteilen offensichtlich in der Lage sind, bei allen Unterschieden in ein gemeinsames Gespräch über Bildung einzutreten, Verständigung miteinander, Verständnis füreinander zu erzielen.
Gewiss ein mühsamer Prozess. Der einen auch demütig werden lässt und vorsichtig gegenüber den schnellen Positionierungen, die man gemeinhin in Gesprächen nicht nur über Bildung erlebt. Das von der PoliTeknik, von Zeynel Korkmaz initiierte Projekt stellt sich – wenigstens für mich – längst als ein idealer Bildungsraum dar, in welchem Menschen miteinander kommunizieren, ein gemeinsames Ziel verfolgen – einen universellen Humanismus ermöglicht, der den schwierigen Bedingungen der Gegenwart und den jeweils gegebenen Herausforderungen sich nicht verweigert, aber doch die Gemeinsamkeit ermöglicht. Ein zutiefst menschliches Projekt, das Hoffnung macht in einer Zeit, die manchmal ein wenig aussichtslos erscheint – aber dann eben für Überraschungen sorgt, die wie kühne Träume erscheinen, aber wirklich werden. Dass eben doch etwas besser werden könnte als in der Vergangenheit oder in der Gegenwart.
Michael Winkler