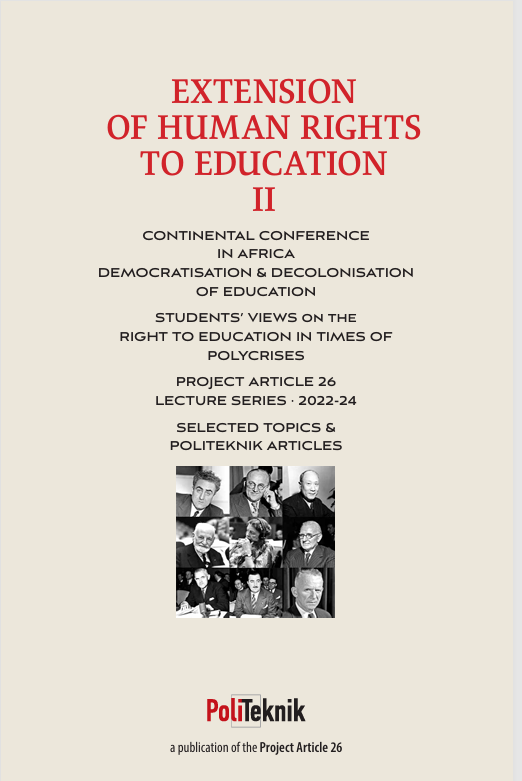- Eine Diskothek – möglicherweise in Bochum. Oder in Istanbul. Vielleicht in Paris und Wien, nicht ganz ausgeschlossen: Mailand. Ziemlich knapp bekleidete junge Frauen – da war doch kürzlich noch etwas los wegen Emanzipation versus Übergriffigkeit, #metoo. Oder so. Ebenfalls knapp bekleidete Jungs, Körpernähe, manchmal weite Distanz, Schweißdampf, ach ja, anderes ist zu riechen.
Partystimmung. Zwischendurch Gegröle. Ach, Schöne, tschüss. Nur eben nicht auf Deutsch, nicht auf Türkisch, aber ja doch: auf Italienisch. Auf Italienisch. Auf einer Diskoparty! Nächtliches Freizeitvergnügen. Top – und in Bochum wie in Wien mit dem Wort bedacht, das längs in jedem zweiten Satz kommt: Geil.
Ein Sommerhit des Jahres 2018, schon vorher erfolgreich. Ausgekoppelt aus der spanischen Thriller-Serie Haus des Geldes. El Profesor, gelobt als geniales Verbrechergenie, stimmt es an, am Abend vor dem großen Coup. Digital aufgepeppt vom französisches DJ und – Professionen gibt es inzwischen! – Remixer Florant Hugel. Irgendwie passt das alles: Haus des Geldes, Raubüberfall, elektronische Aufbereitung, Disco-Sound. Wie heißt es da in der zweiten Strophe: Oh partigiano, portami via, Oh bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! Oh partigiano, portami via, Ché mi sento di morir.
Vermutlich hört da keine zu, wahrscheinlich nicht einmal in Italien. Es geht um einen Abschied in den Tod. In einen sehr wahrscheinlichen Tod, im Kampf der Partisanen gegen die Faschisten. Bella Ciao ist eine der Hymnen des Widerstands, übrigens auch in Frankreich und Spanien. Es ist ein Lied des Aufbruchs und der Trauer, der Verteidigung von Demokratie und Sozialismus, zugleich ein Lied der Liebe. Wie, so nebenbei vermerkt, das Gedicht avenidas von Eugen Gomringer, das von der berliner Alice-Salomo- Hochschule entfernt werden musste, weil es voyeuristisch und frauenfeindlich sei. Übrigens nach langen, intensiven Diskussionen. Niemand hat es sich leicht gemacht – um am Ende zu einer falschen und schlechten Lösung zu kommen.
Bella Ciao. Warum rege ich mich auf? Ey, Alter, Ist doch nur ein Lied. Darf doch Spaß machen. Vielleicht werde ich alt und beginne beides zu entwickeln: Demut und Ehrfurcht, vor Menschen, die um Freiheit gekämpft haben, um ein gutes Leben in Solidarität, im Kampf um all das, was dann heute so als Werte des Westens behauptet wird: Geld und Party. Also Freiheit, letztlich aber nur die Freiheit des Kapitals, nicht die von Menschen, die in Würde leben und mit Achtung miteinander umgehen.
- Und damit sind wir beim Thema, einem aktuellen und ziemlich heiß diskutierten. Vielleicht ein wenig überraschend, nämlich unerwartet beim Partysong, der ordentlich auf die richtige Zahl an Beats gebracht ist. Es geht nämlich um Identität, um kulturelle Identität und ihre Aneignung. Die Auseinandersetzung läuft ein wenig – vorsichtig formuliert – seltsam. So klar ist das nämlich nicht: die Begriffe und die Sachverhalte sind komplex, die hier antönen. Man kommt ohne sie nicht aus: Kultur steht für menschlich geschaffene Artefakte, für einen anthropologischen Grundsachverhalt, der sich als ganze Lebensweise zeigt, unentbehrlich für alle; Kultur ermöglicht uns Selbstwahrnehmung und Miteinander. Kultur hat einen Überschuss, nämlich die Kunst, in welchen Menschen dann einander begegnen und verstehen können. Kultur ist eigen und universell. Aneignung wiederum steht für einen Vorgang, in welchem Menschen eigentlich erst zu Menschen werden, indem sie sich mit ihrer sozialen und kulturellen Welt konkret auseinandersetzen. Ohne Aneignung gibt es keine individuelle und soziale Entwicklung. Zugleich aber gibt es einen engen Begriff von Aneignung, eher juristisch, auf Eigentum bezogen, das genommen wird. Identität drückt schließlich aus, wie eine Einzelne in ihrer biographischen Entwicklung und im sozialen Kontext eine besondere, eigenartige Person wird – witzigerweise gelegentlich als eigentümlich bezeichnet, ein wenig abgegrenzt von dem, was der gar nicht abwertende Ausdruck Idiotie bezeichnet.
Deutlich wird: all diese Ausdrücke bewegen ein semantisches Feld, weil es um Sachverhalte geht, die nicht in einfache Formeln zu pressen sind. Als – hoffentlich – denkende Wesen, die – hoffentlich – mit Verstand und – noch mehr Hoffnung – zur Vernunft befähigt sind, wollen all diese Ausdrücke Verständigung und Verständnis ermöglichen. Zur politischen Propaganda taugen sie nicht. Wer sie einsinnig verwendet, bricht Denkprozesse ab.
Bislang waren solche Abbrüche des Denkens ein Privileg der politisch Rechten. Differenzierung, Anerkennung von Komplexität – das war in diesem Lager nicht verbreitet. Ganz hilfreich übrigens, weil man damit rechte Ideologie erkennen konnte. Das hat sich nun eben geändert. Seit einigen Jahren, in den USA und in GB schon etwas länger, hat sich der Gebrauch dieser reflexiven und für die Bestimmung einer komplizierten sozialen Welt unvermeidlich offenen Begriffe verengt. Zunächst inspiriert durch die Rezeption der Gofmanschen Stigma-Theorie, dann durch Dekonstuktion innerter Machtprozesse, dann in einem erstaunlichen Umschlag von der Achtung und Anerkennung von Heterogenität, Vielfalt und Individualität im Kontext einer sich als gemeinsam verstehenden Gesellschaft ist ein Muster der – so hätte das wohl Marx formuliert – der Verdinglichung entstanden: Andere Menschen verfügen über eine Identität, die anerkannt sein will, um dann als solche so festgehalten zu werden, dass über sie nicht einmal gemeinsam gesprochen werden kann und darf. Weil dieses Sprechen schon immer Übermächtigkeit, Vorherrschaft und vermeintliche Überlegenheitsgefühle ausdrücke, kolonialisierendes Denken, Fühlen und Handeln. Schweig, wenn Du nicht selbst Träger dieser oder jener kulturellen Identität bist, schweig, wenn Du nicht selbst aus dieser oder jener Kultur stammst, schweig gefälligst, wenn Du nicht behindert bist – so könnte man knapp zusammenfassen, was Gayatri Chakravorty Spivak als die Gallionsfigur der postkolonialen Bewegung allen anderen empfiehlt. Übrigens mit einem Unterton, der die Klassenunterschiede, die Schichtungen, die Ohnmachtssituation in den dann angeblich vorrangig durch die Hautfarbe ihrer Mitglieder bestimmten Gesellschaften ignoriert. Die von Spivak angesprochenen Subalternen können nämlich nirgends sprechen. Aber das nur als Marginalie.
- Dennoch ist, ich gebe zu, der Rat zu beachten. Schweigen und zuhören. Das ist sinnvoll. Freilich im gegebenen Fall für die ganze Debatte, wie sich in der fatalen, wenn nicht sogar letalen Auseinandersetzung gezeigt hat, in der Protagonistinnen der Fridays for Future Bewegung eine engagierte Musikerin ausgeladen haben, weil sie Rastazöpfe trägt. Die mediale Öffentlichkeit hat das ebenso gefreut, wie die von den Umweltaktivistinnen genervten Politikerinnen. Eine Vorlage, die man nicht besser erfinden hätte können. Rastazöpfe waren nämlich schon in den Urzeiten der Menschheit verbreitet, zuletzt sollten sie Solidarität ausdrücken – nicht Aneignung, sondern als Hinweis auf jene, denen eben keine Möglichkeit zum Sprechen gegeben wird.
Oder eben einfach nicht zugehört wird. Das macht nämlich die eine Linie der Debatte um kulturelle Aneignung und um postkoloniale Niederlagen aus, die sich übrigens als Fortsetzung des Kolonialismus mit den gleichen Mitteln erweisen. Diese Linie hat schlicht mit dem zu tun, was als Erbe kolonialistischer Politik zu gelten hat. Mit Raubkunst. Aus den ehemaligen Kolonien in Afrika und Asien. Über Engländer und Franzosen, Belgier nach Deutschland gekommen, angeblich dort ordentlich mit Verträgen erworben, um in Völkerkundemuseen ausgestellt zu werden. Man könnte von begaffen reden. Wer behauptet, dass das alles legal gelaufen sei, darf gleich Hehlerei und Zuhälterei als ordentliche Geschäftszweige bezeichnen. Wobei das alles noch mit der Behauptung verbrämt wird, diese kulturellen Objekte, Kunstwerke von atemberaubender Schönheit, seien in europäischen Museen besser aufgehoben als in ihren Herkunftsländen. Man besuche nur einmal ein Museumsdepot hierzulande!
Also: diese Objekte des brutalen Diebstahls dürfen nicht eingemauert oder gar einbetoniert werden, wie im Humboldt-Forum in Berlin geschehen. Das ist ein Skandal. An – wie das fachlich heißt – Restitution kommt niemand vorbei. Man kann ja Stipendien für Wissenschaftlerinnen ausloben, die vermutlich getreu den Regeln der Hermeneutik deutlich mehr Aufschluss über die ästhetische Bedeutung der Objekte gewinnen, wenn diese in ihren Herkunftsgesellschaften zu finden sind – und wer ein wenig genauer sich mit der Thematik befassen will, sollte Bénédicte Savoys Buch zu Afrikas Kampf um seine Kunst lesen.
Kurz: über diese Frage müssen wir nicht diskutieren. Es sei denn in einer guten Form darüber, was Menschen historisch, sozial und durchaus im Alltag mit ihrer nicht nur traditionellen Kunst verbinden.
- Das aber führt mich dann doch zur heiklen Seite der aktuellen Debatte um kulturelle Identität und ihre Aneignung. Sie wird ziemlich erregt geführt, übrigens von allen Seiten, wie etwa Buchtitel verraten, die von cynical theories sprechen oder von einer Generation beleidigt. Alles ganz witzig, würde nicht in dem einen Fall ein ziemlich positivistisches Wissenschaftsideal abgefeiert, im anderen übersehen, was im Alltagsleben einer Spaßgesellschaft an Kränkungen geradezu normal wird – wobei mir auffällt, wie antisemitische Schmähungen dann eben doch eher, wie heißt das so schön, toleriert werden.
Von der Restitutionsdebatte nun einmal abgesehen, so treiben mich doch in der Debatte mehrere Probleme um, die allesamt mit der Reduktion von Komplexität zu tun haben:
Können wir denn überhaupt so sicher sein in Fragen der kulturellen Identität eines Menschen? Ja, so einigermaßen, soweit und sofern es um die formale Identität geht, wie sie ein Ausweisdokument festhält, zunehmend mehr mit den eindeutig identifizierenden biometrischen Merkmalen. Irgendwann werden selbst die gefälscht werden, was uns jetzt nicht interessieren muss – wenngleich man an der Tatsache der Individualität eines jeden Menschen nicht so ganz vorbeikommt. Und damit auch an der Gefahr nicht, in der jede steht, dass sie wegen ihrer Besonderheit zur Zielscheibe aggressiver Zuschreibungen wird. Aber darum geht es angeblich nicht. Die Debatte richtet sich vielmehr auf systematische Kategorisierungen, die dann mit Ausschlüssen einhergehen. Also mit Machtprozessen. Damit also, dass solche Kategorienbildung zugleich mit Normalitätsannahmen einhergeht, die ihrerseits wieder Selektionen und Ausgrenzungen nach sich ziehen, verbunden mit Übergriffigkeit, mit Schmähung.
Das Paradox der gegenwärtig geführten Kritik an solchen Prozessen besteht nun darin, dass die Forderung, eine andere Identität zu achten und sie nicht anzueignen, eben diese Vorgänge eher stärkt, sie geradezu objektviert und in eine Verdinglichung führt, die Menschen auf ihre Identität festlegt. Gelegentlich macht sich das Gefühl breit, dass diese, nun so gepriesene radikale Reaktion auf Übergriffigkeit und Beleidigung das Problem eher verschärft.
Vielleicht wäre man also – zum einen – besser mit dem Satz bedient, den man früher einem Kind gesagt hätte: ein solches Hindeuten oder Zeigen gehören sich nicht. Man könnte altmodisch davon sprechen, dass es um gutes Benehmen geht; um ein gutes Benehmen, das sich durch ein Gefühl dafür auszeichnet, wie man sich anderen gegenüber mit Anstand verhält. OK, ich gestehe, solche pädagogischen Überlegungen wirken heute überholt, drücken die Position alter Leute aus – wie man sie übrigens weltweit findet.
Zum anderen führt diese Debatte um Identität dazu, dass schlicht das Interesse an Menschen schwindet. Die – zugegeben: manchmal penetrante – Hoffnung, in ein gemeinsames Gespräch, in ein Miteinander zu kommen. Wer einen anderen aufgrund eines äußeren Merkmals nach Befinden oder Herkunft fragt, agiert – ja, erneut eingestanden – zuweilen voyeuristisch und diskriminierend. Es gilt, was der Schweizer Philosoph und Psychoanalytiker Aron Bodenheimer als Obszönität des Blicks bezeichnet. Selbst wenn wir vermutlich niemals die Augen vor äußeren Merkmalen verschließen können – beginnend übrigens bei der Anmach-Feststellung, dass jemand heute gut aussieht. Sie kann beleidigen, aber sie tut vielleicht gut, wird Anlass dazu, ein eigenes Glück mit anderen zu teilen. Der Schematismus wird zum Problem – übrigens noch so weit, dass manche dann gar nicht mehr über ihre Herkunft zu reden wagen, weil sie Angst haben, in die Mühle der Identitätsdebatten zu geraten. Obwohl sie vielleicht an diesem Gespräch interessiert wären, möglicherweise weil sie darin sogar ein wenig von dem sehen, was Bourdieu als soziales oder kulturelles Kapital ansieht.
Aber noch mehr beschäftigen muss bei der Frage nach der Identität die nach Biographien, den selbst erzählten und den zugeschriebenen. Bei den selbst erzählten wäre gegenüber aller vorgeblichen Gewissheit und Festigkeit der Identität festzuhalten, wie diese sich eher wechselhaft zeigen. Beginnend damit, was man wem in welcher Situation nun von sich preisgibt. Weitergehend damit, dass in der selbsterzählten Biographie das Gewicht der lebensgeschichtlichen Knoten immer wieder verändert. Die vorgeblich so feste Identität verändert sich, manchmal verbunden damit, dass man sogar wichtig erscheinenden Ereignisse und sogar Phasen des Lebens vergisst oder verdrängt. Zuweilen kommen sie später wieder, manchmal sehr schmerzhaft oder mit dem Gefühl, dass man einfach Glück gehabt hat – und dieses gar nicht so recht ermessen konnte. Das Glück einer Begegnung mit einer anderen Person, völlig kontingent, aber doch so, dass eine Weiche in der eigenen Entwicklung gestellt wurde. Zuweilen erfährt man, wohl vor allem beim Älterwerden, dass sich manches aus der eigenen früheren Geschichte, sogar aus der Familiengeschichte „irgendwie“, gleichsam epigenetisch in das eigenen Bewusstsein, wenn nicht sogar in das eigene Tun und Lassen eingegraben hat. Manchmal entsteht so ein Gefühl des Unglücks, etwa wenn man erfährt, dass in der eigenen Familie ein NS-Verbrecher war. Oder man entdeckt eine Linie, die man immer schon geahnt hat, die sich nun bestätigt. Und auch die Migrationsgeschichten lassen sich nicht so einfach zurechtstutzen, übrigens nicht einmal als achtende Anerkennung: Manche will an ihre Herkunft gar nicht erinnert werden, viele leben mit einer zuweilen spannungsreichen, durchaus pluralen Identität, sprechen von ihren zwei Heimaten etwa, von einer Vielfalt kultureller Einflüsse, die sie zu ihrem Leben verbunden haben. Übrigens meist mit einer Fähigkeit, die ich etwas frech als Identitätskompetenz bezeichnen würde, als ein fast spielerisches Können, mit Vielfalt umzugehen. (Es sei denn, prägende Einflüsse eines Bildungssystems waren so stark, dass dann die Sozialisation in einer akademischen Eliteeinrichtung ein Grundmuster von Arroganz erzeugt hat.)
Was wird an all dem deutlich? Die Frage nach dem, was als soziale und kulturelle Identität empfunden wird, lässt sich nicht mit einem einfachen Schematismus, mit einer einfachen Norm klären. Sie verweist vielmehr auf die Fähigkeit zur Balance, zu einer Intuition darüber, was erlaubt ist und was die Möglichkeit in sich birgt, mit anderen Menschen in Kontakt, in Austausch, in ein Miteinander einzutreten. Gewiss: das klingt ein wenig naiv, wenn die herabwürdigenden Blicke und Behauptungen in Rechnung gestellt werden, mit welchen manche auf Andere reagieren, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht einem Muster an Normalität entsprechen. Diskriminierung, Verachtung und Verächtlichmachung sind unzulässig – übrigens in jeder Hinsicht und in jedem Fall. So gesehen kann es einerseits nur um Achtung und Anerkennung von Differenz gehen (ob die dann Intersektionalität heißen muss, sei dahingestellt oder eher kritisch beäugt, weil einmal ein technischer Begriff auf das Soziale übertragen wird.); es kommt also darauf an, mit Kontingenz, mit Mehr- und Vieldeutigkeit umzugehen, Pluralität als Lebensbedingung für alle zu begreifen. Deshalb muss andererseits alles vermieden werden, was ein Denken verhindert, das als genereller Humanismus bezeichnet werden kann. Die Vielfalt und Verschiedenheit im Ganzen – menschliches Leben verlangt ein dialektisches Denken und Handeln, in dem Einzelnes und Ganzes zusammengehören.
- Nur: die Frage stellt sich aber schon, warum diese Debatte um kulturelle und soziale Identität sich aktuell in solch zugespitzter Form stellt. Eine sogar beruhigende erste Antwort lautet zunächst, dass zwar aufgrund von Zuwanderung und Veränderung der Bevölkerung einerseits zwar mehr an Vielfalt sich zeigt, daher mehr Diskriminierung möglich ist – wobei ich von verstärkten politisch rechten Strömungen sogar absehe. Andererseits könnte sogleich eingetreten sein, dass die Sensibilität gegenüber allen Formen von Kränkung und Beleidigung gewachsen ist. Die in der Literatur durchaus vorgetragene Auffassung von der moral blindness – so etwa Baumann und Donski, oft verbunden mit Kritik an den sozialen Netzwerken wäre damit sogar ein wenig widerlegt. Das wäre eine optimistische Sicht – bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.
Leider tendiere ich zu einer anderen, zweiten Antwort. Die besagt zunächst, dass in den modernen Gesellschaften der Gegenwart Muster der Kategorisierung und normalen wie normativen Unterscheidung sich ausbreiten, um dann propagandistisch überhöht zu werden. Man macht dann einen Kult aus einer fatalen Entwicklung. Statt Freiheit, Gleichheit und Besonderheit wie sie noch im Ideal der Inklusion anklingen, setzt sich in einer geradezu hinterhältigen Dialektik trennende Differenzierung durch. Ein bitteres Beispiel bietet die Bewegung, die für eine Achtung und Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierungen angetreten ist, nunmehr noch unter der Überschrift von LGBTQ+ auftritt, aber längst schon ein feinziseliertes Kategoriensystem anbietet. In der Verbindung mit der von Spivak formulierten Devise, dass man als – ohnedies vermeintlich – Nicht-Kategorisierter gefälligst schweigen soll, wird die Debatte dann teuflisch. Es dürfen dann nur noch Betroffene reden, doch bleibt eigentümlich offen, wer denn nun eigentlich nun eigentlich als solche oder solche gelten kann. Spricht da jemand wirklich authentisch für sich oder erschleicht sie oder er die Möglichkeit, nicht ausschließen zu können, selbst schwul oder lesbisch zu sein. Oder Opfer von Kolonialisierungsprozessen. Oder einfach Ausländer.
Die Vorstellung einer pluralen Welt bricht zusammen, wobei verschärfend noch hinzutritt, dass die bislang Nicht-Kategorisierten kein Wort mehr äußern können. Man mag das als historische Gerechtigkeit werten, weil nun der Geltungsanspruch sogenannter Normalität ausgehebelt wird – nur wird die auf diesem Wege eigentlich erst recht wieder in Geltung gebracht. Wobei manche dann auch einwenden mögen, dass es wohl aktuell darauf ankäme, möglichst spektakulär sich darstellen zu können. Fatalerweise geht aber mit dieser Kategorisierung und dem Spivakschen Schweigegebot ein massives Dilemma für jene einher, die sich eben für andere einsetzen, Solidarität beweisen wollen, oder schlicht Hilfe anbieten – wie das Pflicht eigentlich für alle ist, besonders aber für jene, die in der Sozialen Arbeit tätig sind. (Notabene: dass man darüber nachdenkt, ob und wie weit Hilfe nicht selbst schon wieder diskriminierend wirkt, anderen den Subjektstatus verweigert, mit Ratschlägen schlägt, gehört übrigens zum professionellen Habitus; oder sollte zumindest dazu gehören.)
Das führt mich zu der dritten Antwort, die vermutlich noch bitterer ausfällt. Mit der vehementen Ablehnung von Aneignung kultureller Identität verwirklicht sich nun endgültig das Geschäftsprinzip moderner, neoliberaler Gesellschaften: Teile die Bevölkerung so, dass sie aus den Augen verliert, dass und wie sie als Ganze von politisch-ökonomisch erzeugten Lebenslagen betroffen ist. So verwirklicht ein vermeintlich linkes Denkmuster nicht nur das Geschäft der politisch Rechten. Vielmehr wird vor allem das Grundprinzip von Individualisierung und segmentierender Zuweisung von Identitäten durchgesetzt, das diesen Kapitalismus geradezu systematisch auszeichnet. Und damit kehren wir zum Eingangsbeispiel zurück: bella ciao wird in aller Welt gesungen, viele Musiker haben es aufgenommen, es geht übrigens Rockversionen, bei denen – wie man so schön sagt – die Post abgeht. Der Rhythmus reißt mit, das Lied berührt. Aber man vergisst nicht, um was es geht. Sehr erfolgreiche Musikerinnen haben betrieben und betreiben, was nun als kulturelle Aneignung verworfen wird. Man denke nur an Paul Simon, der dann einigen kommerziellen Erfolg mit seinen Adaptionen afrikanischer Musik verbuchen konnte. Die Musikbegegnung ist eigentlich der normale Gang der Dinge, es sei denn die Gruppen sind von vornherein artifiziell gecastet worden. Und ob die französischen Expressionisten afrikanische Kultur ausgebeutet haben – also, ich wäre da etwas vorsichtiger. Weil die Grenzen nicht zu ziehen sind. Hat van Gogh die Provence und ihre Künstler beraubt, weil er von dem Licht und den Farben im Süden Frankreichs begeistert war. Oder hat er hier etwas ausgebeutet. Wie ist das mit Dichtern, die ein Idiom aufnehmen, das doch geographisch begrenzt auftritt?
All das unterscheidet sich aber von dem, was mit bella ciao passiert ist. Hier ist ein Kampflied des politischen und sozialen Widerstands schlicht missbraucht worden; nein: es wurde gestohlen und zerstört, um des Geldes willen, für eine Partygesellschaft, die ihrerseits wohl für einen unersättlichen Kapitalismus steht.
Kurz und schlecht: Über die Aneignung kultureller Identität muss man reden. Ohne Zweifel. Aber die Kontexte sind zu beachten. Einmal der Kolonialismus und seine Fortsetzung bis heute. Zum anderen aber – und das ist wesentlich – ob das Prinzip des Kapitalismus dahintersteht, alles, aber auch alles in einen bloßen Geldwert zu verwandeln und damit in seiner Qualität zu vernichten. Völlig unabhängig davon, welche Bedeutung das jeweilige kulturelle Gut, die jeweilige kulturelle Praxis für die Menschen gehabt hat und hat. Klar ist, noch hat der Kapitalismus sich selbst sogar die stärksten Gegner vereinnahmt. Aber dies fällt wohl noch einmal leichter, wenn diese auf subtile Art und Weise, in bitteren Dialektik seine Geschäftspraktiken zu ihren machen, kommerziell, was nicht überrascht, als Teil einer vorgeblich linken Politik, was verzweifeln lässt. Weil sie nun selbst das soziale Miteinander zerstört, die Fähigkeit von Menschen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten – wie übrigens, nur angemerkt, das für die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung.