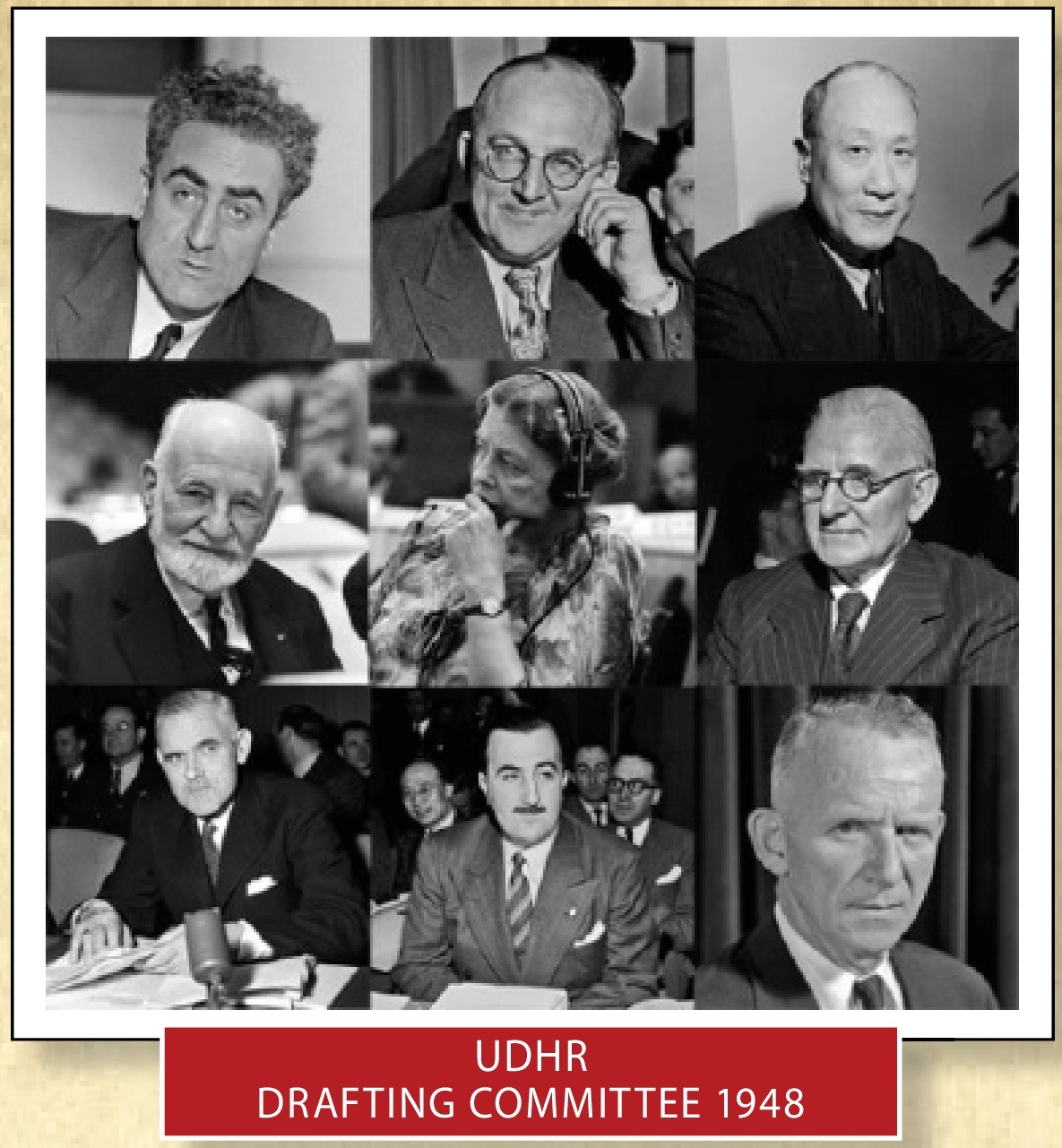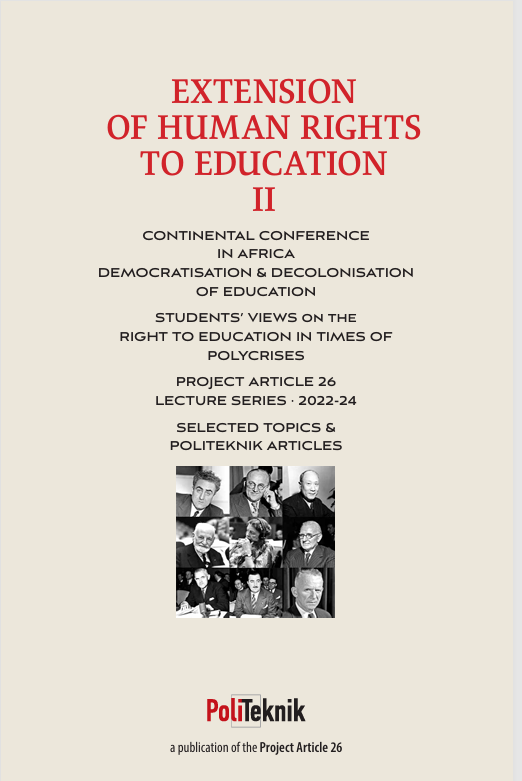Die – inzwischen längst international gewordene – Debatte um eine Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung, mithin um die Idee eines Enlargement of the Human Right to Education (AEdM Art 26), trifft gleich in mehrerlei Hinsicht einen Nerv aktueller bildungs- und sozialpolitischer Auseinandersetzungen.
- Denn es geht in der Tat prioritär darum, überhaupt erst eine Grundlage zu schaffen, wenn man so will: eine Kommunikationsbasis, um in einen weltweiten Austausch über Bildung und das Menschenrecht auf Bildung eintreten zu können. Zu den Eigenheiten der jüngeren Entwicklungen gehört nämlich, dass zwar regelmäßig von Globalisierung gesprochen wird, diese Globalisierung jedoch vorrangig und ausschließlich ein profitzentriertes Geschehen darstellt – lokale Ökonomien sind schließlich geradezu zerbröselt worden, oft genug haben globale Unternehmensaktivitäten die lokalen Ressourcen vernichtet. Zuletzt hat sich eben dieses Geschehen – etwa im Kontext der Corona-Pandemie – als höchst problematisch und anfällig erwiesen. Stichworte sollen hier genügen: Verlagerung in sogenannte Billigländer, mithin Externalisierung zu Lasten des globalen Südens mit Effekten freilich auf die Beschäftigungsverhältnisse im globalen Norden, Auslagerung von lebensrelevanten Produktionen etwa bei der Herstellung von Medikamenten, Lieferketten, Beschädigung von lokalen Industrien und Verlagerung schädlichen Abfalls. Hinzu kommt, dass im Zuge dieser Form von Globalisierung die nun schon weltweit sichtbaren, überaus bedrohlichen Veränderungen des Klimas kaum zu bewältigen sind, nicht zuletzt, weil die Gesellschaften und politischen Gemeinwesen in ein zerstörerisches Wettbewerbsverhältnis zueinander gebracht worden sind.
Das überraschende Paradox dabei besteht darin, dass dieser Globalisierung (des Kapitals und seiner Interessen) eine regionale, wenn nicht lokale Beschränkung der Kommunikation, des Austausches und der Debatten relevanter Themen entspricht; der kommunikativen Übermacht etwa großer Unternehmen oder global agierender Stakeholders entsprechen keine übergreifenden Gegenöffentlichkeiten: Zwar bieten die digitalen Medien hervorragende Möglichkeiten in einen solchen kollektiven Diskurs einzutreten, doch zeichnet sich ab, dass in der selbst kommerziell gesteuerten Aufmerksamkeitsökonomie es vor allem darum geht, die Menschen nicht nur als Produzenten, sondern vor allem als Datenlieferanten auszubeuten, sie sozusagen als Konsumenten zu nutzen, die ihr Denken, Fühlen und Handeln selbst so kanalisieren, dass sie gewissermaßen den Rohstoff für den digitalen Kapitalismus liefern, selbst als Produzenten wirken und das von ihnen informationell Produzierte dann wieder konsumieren, wobei die damit in Gang gesetzte Zirkulation selbst gleichsam als Profit abgefischt wird. Faktisch ist das Gespräch der von ökonomischen, aber auch politischen Entscheidungen Betroffenen unterbunden worden. So übrigens auch im Zusammenhang von Bildungsfragen. Zwar finden sich noch internationale Organisationen, die aber schon spezifische Programmatiken verfolgen – und gelegentlich ebenfalls abgekoppelt selbst von jenen wirken, deren Interessen sie verfolgen sollten. Kurz: Kommunikativ entsprechen der Globalisierung höchstens Einzelstimmen, die selbst schon oft korrumpiert sind, weil sie als internationale Experten gelten – aber das auch nur, weil sie für entsprechende Organisationen wie etwa die OECD stehen.
Das verstärkt noch alles die ohnehin schon sichtbar gewordene Tendenz zur Individualisierung; kollektive Organisationen sind kaum mehr möglich, allzumal solche, die mit einem gemeinsamen Gespräch beginnen, das über Grenzen, über soziale, kulturelle, vielleicht auch ethnische Besonderheiten hinausgeführt wird. Auch hier begegnen seltsame Paradoxien, etwa die, bei der in manchen Gesellschaften geradezu strikte Identitätspolitiken gefordert und verfolgt werden, die mit dem Argument des Schutzes des Eigenen einen Austausch mit anderen verhindern. Dabei wird völlig übersehen, was sich in jedem gemeinsamen Gespräch über die Grenzen hinweg zeigt: Menschen sind offensichtlich bestens in der Lage, gleichermaßen offen wie kritisch über Themen miteinander zu diskutieren, die sich doch in großer Ähnlichkeit stellen – weil sie eben menschheitliche Aufgaben darstellen. Wie etwa das Thema Bildung. Dabei lässt sich auch an diesem beobachten, wie es zunehmend von den (digitalen) Konzernen beherrscht wird, zumal hier global agierende Institutionen den Wettbewerb durchgesetzt haben – nach ihren Standards und mit ihren Normen, nicht aber nach dem, was die Menschen in den praktischen Handlungsfeldern erfahren und selbst gestalten (wollen). Wieder zeigt sich, dass und wie machtvolle Akteure und die ihnen zuarbeitenden ideologischen Apparate (etwa der Medien) eine globale Kommunikation erzeugt haben, der aber – um es erneut paradox zu sagen – keine globale Kommunikation entspricht; es geht um eine Suprastruktur, nicht jedoch darum, eine Infrastruktur zu schaffen, in der sich Menschen austauschen.
So gesehen liegt in der Tat die erste Aufgabe eines Projekts wie das zur Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung darin, eine Organisation zu schaffen, in der sich Menschen begegnen und miteinander austauschen können – über das Thema Bildung, zugleich übrigens auch in einem eigenen Bildungsprozess. Denn schon der Austausch miteinander, über nationale Grenzen und solche der Kontinente hinaus, verändert das Denken, Fühlen und Handeln aller Beteiligten. Die unmittelbare Begegnung mit anderen, die Erfahrung gemeinsamer Anliegen und Perspektiven kann als geradezu fundamental gewertet werden – sie ist Teil jener menschlichen Kooperation, die im Grunde, wie Evolutionsbiologen nachdrücklich zeigen, das Überleben der Gattung homo sapiens erst ermöglicht hat.
Es geht also um ein Netzwerk, möglichst basisdemokratisch, das zuerst und zuvorderst ein – wenn man das so emphatisch formulieren will – Weltgespräch über Bildung ermöglicht und in Gang bringt. Dabei zeigt sich beides: Die Teilnehmerinnen teilen einerseits eine Vielzahl von Vorstellungen, sie können miteinander reden und sich austauschen, selbst wenn die Problemlagen und Sachverhalte unterschiedlich sein mögen. Die Gemeinsamkeit, die – um noch einmal an die Evolutionsbiologie anzuknüpfen – geteilte Aufmerksamkeit und die geteilten Absichten wirken stärker als alle Differenzen.
- Dennoch: Über diese Herstellung eines gemeinsamen Gesprächs hinaus, sollte und muss über inhaltliche Fragen nachgedacht werden, die mit Bildung verbunden sind. Schon im Grundsatz sollte Bildung – durchaus im Verständnis der Erklärung der Menschenrechte – so gefasst werden, dass damit eine menschliche Entwicklung gemeint ist, die von den Personen selbst ausgeht, welche sich ihrerseits mit ihren Lebensbedingungen, mit einer gegebenen kulturellen und sozialen Wirklichkeit umfassend lernend befassen können, zugleich dabei sich selbst so verstehen können, dass sie als kompetente Akteure sich erleben. Bildung hat mehr mit der Entwicklung von Persönlichkeit, mit Subjektivität zu tun, weniger mit Schule – die aber eben doch eine zentrale Bedingung für die Entwicklung von Subjektivität darstellt. Knapp formuliert: Wer von Bildung spricht, bleibt auf das menschliche Subjekt fokussiert, in seiner gemeinsamen Praxis mit anderen, die sich ihrerseits auf eine umgebende Welt bezieht, diese sich zu eigen macht, Menschen formt, zugleich aber – notabene: als gemeinsame Praxis – erlaubt, die Welt zu verändern. Zu dieser Welt gehört Schule mit ihren Inhalten, wobei Schule eben gleichzeitig auch ein Raum für gemeinsame Praxis ist.
Worauf verweist das? Bildung wird zunehmend auf eine seltsame Weise verkürzt und verengt wahrgenommen. Meist, nein, fast ausschließlich richtet sich der Blick auf Schule. Vor wenigen Jahrzehnten hatte man noch mit der Unterscheidung von formaler, non-formaler und informeller Bildung argumentiert, um anderen Kontexte von Bildungsprozessen, von Lernen und ermöglichter Entwicklung zu thematisieren, übrigens wurde damals überzeugend nachgewiesen, dass und diese non-formalen und informellen Kontexte wohl für die Persönlichkeitsbildung fast wichtiger sind als der scholare Zusammenhang. Aber das ist alles vergessen – man möchte: es wurde vergessen gemacht. Schule zählt, vor allem Qualifikationen für einen Beruf.
Um nicht missverstanden zu werden: ja, Schulen gehören zu den wichtigsten Errungenschaften, die in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurden. Sie könnten großartig sein, allzumal für die Entwicklung von Menschen. Manchmal sind sie das auch. Schulen ermöglichen, dass Menschen lernen, eigentlich sogar umfassend, Lerngegenstände, aber sogar das Leben. So gesehen können Schulen heilige Orte sein.
Indes: An Schulen wie übrigens an vielen pädagogischen Institutionen muss mit Grausamkeit gerechnet werden. Es ist gar nicht von sogar militärischen Überfällen zu reden, von denen Schulen wohl sehr häufig bedroht sind. Gewalt findet vielmehr unter Schülerinnen und Schülern statt, sie wird praktiziert von Lehrerinnen und Lehrern, die Schule müsse mit Zucht einhergehen, die sie als Unterwerfung und Unterdrückung, manchmal als einfache Gemeinheit realisieren, die sich etwa in herabsetzenden Worten äußert. Schläge werden ausgeteilt. Schulen sind grausam auch, weil sie zwar versprechen, die Individuen auf ihrem Entwicklungsweg so zu unterstützen, dass diese ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten erkennen und diese aufnehmen. Das lässt einen ersten Punkt für die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung erkennen: Bildung und Gewalt schließen sich aus! Bildung darf nicht mit Grausamkeit einhergehen, Übergriffigkeit, Misshandlung, jede Form von Schmerzen müssen ausgeschlossen und verboten werden!
- Eine Entwicklungsmöglichkeit erkennen, sie vielleicht nur ahnend aufnehmen und an sie anzuknüpfen, um einen Weg zu bahnen. In der deutschen Pädagogik gibt es dafür den Ausdruck Bildsamkeit. Er bezeichnet, dass eine Entwicklungsmöglichkeit, ein Talent, das sich andeutet, erkennt und in gemeinsamer Praxis gefördert wird. Aber die Wirklichkeit zeigt eher, wie diese Förderung gar nicht stattfindet, dass Menschen gar nicht sich verändern können, geradezu auf dem Status festgehalten werden, der ihnen zugeschrieben worden ist. Dass zugleich Förderung mit Kontrolle, mit Überwachung und Zwang und damit einhergeht, einem fest umrissenen Zeitregime zu gehorchen. Aber Menschen, Kinder, Erwachsene, Ältere lernen und entwickeln sich nur in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Jede und jede benötigt in ihrer Bildung eine eigene Zeit. Manches geht schnell, manches langsamer, manchmal verzögert sich eine Entwicklung, vielleicht auch, weil das sich bildende Subjekt einen anderen, unerwarteten Weg einschlägt. Deshalb gilt übrigens, dass Menschen niemals als behindert bezeichnet werden sollten. Sie beanspruchen nur für sich eine andere Dauer für ihren Bildungsprozess, manchmal brauchen sie länger als der Durchschnitt. Aber was besagt das eigentlich schon. So gesehen bedeutet die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung immer den Blick auf die jeweiligen Zeithorizonte, die ein Menschen, die zuweilen Gruppe für die jeweiligen Bildungsprozesse benötigt.
Und manchmal tritt hinzu, dass jemand das eine oder andere sich nicht wirklich zu eigen manchen kann. So blöde war der Begriff der Begabung nicht, wenn er sich auf einzelne Bereiche menschlichen Könnens bezogen hat. Es gibt Differenzen, die nicht zur Qual führen dürfen können. Manche Kinder sind begeisterte Mathematiker, andere habe Lust darauf Sprachen zu lernen. Wieder anderen scheitern an den Forderungen der Schulen in diesen Domänen. Was übrigens noch lange nicht bedeutet, dass sie später einmal doch hervorragend eine andere Sprache erwerben – tatsächlich wäre es wünschenswert, dass jedes Kind wenigstens noch eine Sprache sich aneignen kann, wie auch Kenntnisse der Mathematik hilfreich wären. Man könnte es mal so sagen: Jede und jeder sollte einmal erfahren können, wie viel Spaß eine andere Sprache oder das Spiel mit den Zahlen machen kann. Nur: Wiederum ist Geduld gefordert, Zurückhaltung. Das erweiterte Menschenrecht auf Bildung verlangt, niemanden den Weg zu einem Gegenstand zu versperren, selbst wenn dieser nicht heute in der Schule gefunden, sondern später erst erworben wird.
Öffnen der Zeithorizonte wäre also ein entscheidendes Moment bei der Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung. Geht nicht, sagen viele. Schule lässt sich dann nicht organisieren. Der Einwand ist komplett falsch. Unterricht muss individualisiert geschehen und kann individualisiert geschehen. Viele Lehrerinnen beweisen das tagtäglich, die Pädagogik hat das selbst möglich gemacht, zu erinnern ist beispielsweise an die gruppenförmige Organisation des Unterrichts bei Peter Petersen und den von ihm initiierten Jena-Plan-Schulen.
Wieder ein Paradox: Gefordert wird die Individualisierung des Unterrichtens von nahezu allen. Aber sie wird stetig konterkariert durch Maßnahmen der Normierung, der Standardisierung, der Überprüfung, durch eine Unkultur eines Testens, bei dem es nur darum geht, Vergleichsdaten zu konstruieren. Um die Menschen in Konkurrenz zueinander zu bringen, sie gegeneinander zu stellen. Und nicht genug damit: versprochen wird so Bildungsgerechtigkeit. Was für ein Unfug. Bildung ist ein solch hochgradig individuelles Geschehen, dass Gerechtigkeit in ihrem Zusammenhang eigentlich immer dialektisch gesehen werden muss. Als Gleichheit in der Ermöglichung, als Achtung vor Differenzen und ihre Anerkennung, als Förderung der individuellen Subjektivität – freilich im Blick auf eine gemeinsam zu gestaltende Gesellschaft. Individuelle Besonderheit und Solidarität miteinander, Einzigartigkeit und Gemeinsamkeit gehören zusammen. Standardisierungen in der Bewertung (notabene: nicht bei den Voraussetzungen) systematisieren geradezu Ungerechtigkeit. Ungleichheit wird so zum Lernprogramm, das Menschen zermürbt, weil es sich auf die Positionen verteilt, die ein Wirtschaftssystem hierarchisiert. Mit gekonnter Arbeitsteilung hat das nichts zu tun. Also wiederum eine Lehre für die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung: Denkt dialektisch, seht die Mehrdeutigkeit menschlicher Existenz, die damit einhergeht, dass wir gemeinsam die Unterschiede leben und in Differenzen so lernen, dass Gemeinsamkeit entsteht.
- Bildung ist ein individuelles Geschehen, das die Subjekte selbst betreiben müssen und können. Es kann ermöglicht werden, muss manchmal angestoßen werden. Anstoß zur Selbsttätigkeit hat das die Pädagogik früher genannt. Deshalb ist es schlicht Unfug davon zu sprechen, dass man Bildung, gar „die Bildung“ herstellen oder produzieren kann. Bildungsprozesse kann man manchmal herauskitzeln – wohin sie dann führen, weiß man nur selten. Dass also aus der genannten Bildsamkeit ein Bildungsprozess entsteht, braucht also Zeit, vor allem aber auch Räume, Pädagogische Orte. Orte, an welchen hinreichender Schutz für die Subjekte in ihrer Bildungstätigkeit gegeben ist, wo sie mit der Welt und mit sich selbst experimentieren können, wo sie gemeinsam mit anderen Erfahrungen machen. Wo manchmal etwas schief geht, wo Fehler gemacht werden – die sich übrigens gelegentlich als Impulse für Veränderungen mit großer Tragweite erweisen. Bildung braucht also Orte, an welchen Optionen möglich werden. Man kann und muss sich mit Themen und Gegenständen auseinandersetzen, sollte die Schlüsselprobleme erkennen und begreifen, die sich stellen – wie das Wolfgang Klafki genannt hat. Das verlangt zunächst Möglichkeiten der Einsicht und des Erkennens, des Wissens und des Prüfens sowie des Verwerfens von nur scheinbar Begriffenen. Das verlangt Möglichkeiten des miteinander Redens, des leidenschaftlichen Diskutierens.
Viele Schulen kennen das nun gar nicht. Sie fordern Schweigen, Stille. Vor allem aber stellen sie Inhalte und Techniken ins Zentrum, beachten und vermessen das Lernen, die Lernleistung und den Lernerfolg. So nebenbei werden zwar Konstruktivismus und Kompetenz beschworen, wird davon geredet, dass die einzelnen Subjekte sich in ihrer lernenden Subjektivität auszeichnen sollen. Kein Wort wahr. Faktisch geht es um Performanz, um das Vorführen des Gelernten, damit es dann vermessen und bewertet werden kann. Assessment der Qualifikationen, möglichst für eine ökonomisch relevante Tätigkeit – von Beruf zu sprechen verbietet sich zunehmend.
- Bildung verlangt anderes, deshalb muss die Erweiterung des Rechts auf Bildung darauf zielen, eben das Andere schon immer mit zu denken, mit zu ermöglichen. In eine Praxis der Verschiedenheiten aufnehmen. Hochtrabend, in der Sprache der Erziehungsphilosophie gesagt: Bildung lässt sich ohne Alterität nicht denken. Bildung gelingt nicht als einfaches Anhäufen von Wissen, gelingt auch nicht als Einübung in das nicht-kristalline Wissen – was, nebenbei bemerkt, den Zynismus auf die Höhe treibt, weil man denn eben nicht einmal über Wissen, über Erkenntnis und Erfahrung verfügt, sondern irgendetwas glibberig Rutschiges hat, das man eben nicht hat. Auswendig lernen, üben, dann anwenden. Das führt zu bloßer Funktion: Funktionieren in Produktion, heute noch mehr im Konsum. Hier wie dort zielt das ganze Unternehmen auf Aussaugen der menschlichen Lebenskraft in festgelegter Zeit. Man kann das Arbeit nennen, wie sie übrigens lange ebenfalls heiliggesprochen worden ist, übrigens auch von dem in dieser Hinsicht naiven Karl Marx. Leistung soll in der Zeit erbracht werden, wobei diese Leistung immer mehr Energie verbraucht, zugleich zunehmend fremd bestimmt ist. Von Unternehmern, von Arbeitgebern und von den Herstellern der Konsumartikel. Noch einmal: Menschen sollen ausgesaugt werden, in der digitalen Ökonomie noch mehr, weil der digitale Kapitalismus auf Extraktion des Denkens, Fühlens, Wünschen und Handelns gerichtet ist, so, dass die ganze menschliche Lebenszeit verfügt und genutzt wird: 7/24, so lautet das Ideal der modernen Wirtschaft in allen Bereichen, mit dem Effekt, dass die Menschen nur noch müde sind, sich nicht mehr konzentrieren können. Sie werden dann ersetzt durch automatisierte Lebensprozesse.
- Aber was heißt das nun für die Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung? Eigentlich hat das schon der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel erkannt, damals als er Rektor eines Gymnasiums war. Schulen, pädagogische Orte müssen Orte der Muße sein, an welchen es gar nicht so sehr um nützliches Wissen geht, sondern darum, Wissen in eine Art Spiel zu bringen, das einerseits die Horizonte erweitert: Geschichte etwa gehört in den, wie das modern heißt, handlungsentlasteten Raum des Denkens. Das macht andererseits darauf aufmerksam, was im Zentrum steht: Eben Denken. Philosophieren hat das Hegel genannt, konsequentes Prüfen, Begreifen, gewiss einer objektiven Welt und des auf Geltung gerichteten Wissens. Es gibt Wahrheit, auch wenn sie sich uns immer wieder entzieht. Auch wenn wir sie uns selbst entziehen müssen. Fragend, diskutierend, mit Geduld, mit der Ataraxia der Epikureer, mit Skepsis, mit Vertrauen in die Vernunft.
Und? Mit der Zeit und den Orten, an welchen wir immer wieder Alternativen, Optionen, das Andere, das Unwahrscheinliche denken und prüfen dürfen. Mehr noch: an welchen wir uns erlauben können, nichts zu tun, sozusagen aus der Welt zu treten, vielleicht sogar aus uns selbst. Indem wir die Fragen stellen: Was wäre, wenn wir das nicht tun, wenn wir anders denken, wenn wir uns die Möglichkeit gönnen zu betreiben, was modern technisch als opt out bezeichnet wird. Einfach: nicht Mitmachen. Uns dagegen zu entscheiden. Um vielleicht einen ganz eigenen Blick zu entwickeln, um Wahrnehmungen und Erfahrungen zu gewinnen, die auf den vorgegebenen Wegen gar nicht vorgestellt waren. Man kann das auch so sagen: Bildung verlangt Verrücktheit, Bildung geht mit Idiotie einher, sofern diese meint, sich auf sich selbst zu verlassen, sich auch den Anforderungen etwa der digitalen Aufmerksamkeitsmaschine zu verweigern.
Möglicherweise stellt das die größte Bildungsanforderung dar, die sich gegenwärtig zeigt. All dem sich zu verweigern, was als Beifang der modernen Kommunikationsmedien erscheint, in Wirklichkeit aber als Hauptsache für die Unternehmen der digitalen Kommunikation verbucht werden muss. Also keinen Sturm auf die Geräte, das wäre dämlich, weil sie uns eben auch durch die Corona-Pandemie geholfen haben, weil sie uns zugleich auch erlauben, etwa über Bildung miteinander zu sprechen. Aber hin und wieder schon einmal abschalten, sich der Welt da draußen zuwenden, den Menschen nebenan. Und vor allem niemals zu glauben, dass man die Wege dieser digitalen Ökonomie gehen sollte, ohne Alternativen für sich selbst festzuhalten und zu verfolgen. Das erweitert das Menschenrecht auf Bildung, weil es die Kontrolle über uns selbst wieder finden lässt.