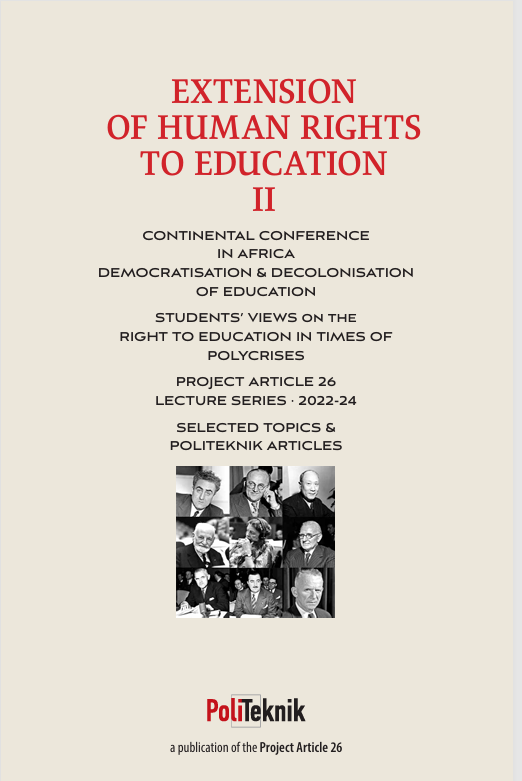Identitätspolitik macht von sich reden, spätestens wieder seit dem neuen Buch von Sahra Wagenknecht. Aber was ist das – „Identitätspolitik“? Allzu vieles wird darunter subsumiert, sowohl von denen, die sie verteidigen als auch von denen, die sie für überflüssig halten und sogar störend finden, weil sie eine Politik im Interesse der großen Mehrheit der Lohnabhängigen oder gar der sozial Schwachen beeinträchtige. Aber was als Identitätspolitik daherkommt, ist meist keine mehr. Was soll daran politisch sein, wenn jemand eine junge Weiße im Afrolook des Lokals verweist?[1] Das Vergehen wird cultural appropriation genannt.
Der Kampf marginalisierter Gruppen um die Anerkennung ihrer Ansprüche auf gleiche Rechte als Bürger*innen und als Menschen, das war Identitätspolitik und das ist recht verstandene Identitätspolitik nach wie vor. „Back lives matter“, ein aktuelles Beispiel für eine identitätspolitische Bewegung, geht es darum, dass sich Schwarze genauso frei und ungefährdet im Land bewegen können wie andere Bürger*innen. Die Anerkennung des elementaren Rechts auf körperliche Unversehrtheit wird eingefordert. Dieses Beispiel lässt keinen Zweifel, dass die Grundlage identitätspolitischer Ansprüche universalistisch ist. Sie entspringt dem Geist der Aufklärung. Nicht von ungefähr haben die in der Französischen Revolution erklärten Rechte sogleich auch bei den schwarzen Sklaven den Anspruch auf Freiheit geweckt und die erste Frau auf den Gedanken gebracht, die gleichen Rechte zu verlangen.[2]
Der Kampf von Frauen oder Schwarzen, generell der Kampf von rassifizierten Gruppen, um gleichen Lohn, gleiche Arbeitsbedingungen und gleiche Zugangschancen auf dem Arbeitsmarkt weist über die bürgerliche Revolution hinaus. In zumindest einer Strömung der Frauenbewegung hat man immer klar gesehen, dass die von früher überkommene Abwertung der Frau vom Kapital für die erhöhte Ausbeutung ihrer Arbeitskraft genutzt worden ist, und auch dass die von Frauen geleistete Hausarbeit für die Reproduktion des Kapitals lange Zeit existenznotwendig war. Identitätspolitik war also auch Sozialpolitik und dabei systemkritisch. Prinzipiell steht sie nicht im Widerspruch dazu.
Identitätspolitik ist emanzipatorisch, streitet gegen Bevormundung auf unterschiedlichen Ebenen. Frauen, lange an den Rand gedrängt und zum Schweigen gebracht, in der Geschichtserzählung unsichtbar gemacht, forderten nicht nur gleiche Rechte und Chancen einschließlich der politischen Repräsentation, sondern auch die Anerkennung ihrer Leistungen für Kultur und Gesellschaft, was geschichts- und sprachpolitische Konsequenzen hatte. Die bisher Privilegierten in der Gesellschaft machten da sinnvolle Lernprozesse durch. Sprachliche Innovationen wie das Gendern boten Lernanreize, weil sie Selbstverständlichkeiten aufhoben, den Anstoß für eine neue Weltwahrnehmung lieferten. Gendern war zumindest in der Anfangszeit eine verstörende Sprachpraxis und implizierte eine Art Verfremdungseffekt. Auch mit der Umbenennung diskriminierter Gruppen wurden die Wörter „politisiert“, so die Linguistin Deborah Cameron. Political Correctness in der Sprache habe zu einem reflektierten Sprechen und Schreiben beigetragen, so ihr Urteil. [3]
Ein wesentlicher Aspekt von Identitätspolitik ist nach wie vor die Forderung, dass die anderen das je eigene Selbstverständnis anerkennen, so dass zum Beispiel Frauen sich nicht den Erwartungen der Männerwelt beugen müssen oder Afroamerikaner*innen und Roma nicht mehr auf stereotype Rollen festgelegt werden. Die Anerkennung der eigenen Selbstdefinition ist besonders für Schwule und Lesben in den 1980er Jahren wichtig gewesen. Dass sie die Beendigung der rechtlichen Repression forderten, war eine Konsequenz daraus.
Die Forderung nach Anerkennung der eigenen Identität steht nicht im Widerspruch zum Universalismus, wenn man Identität mit Selbstverständnis übersetzt.[4] Identität ist nämlich nicht das, wie viele meinen, was die soziale Lage, das kulturelle Umfeld, die genetische Anlage aus uns gemacht haben, sondern was wir daraus gemacht haben, letztlich das Verhältnis, das jede und jeder zu ihren/ seinen Genen und zur eigenen Sozialisation einnimmt. Es ist ein universalistisches Prinzip der modernen Gesellschaft, dass jede und jeder verlangen kann, als die oder der genommen zu werden, als die oder der er sich selbst versteht, was auch impliziert, dass ihre oder seine Erfahrungswelt ernst genommen wird.
Aber man kann verlangen, dass sie oder er sich in einen Dialog darüber einlässt. Und in diesem Punkt unterscheiden sich die kommunikativen Scharmützel und Frontenbildungen über geschlechtliche Identität oder welche Selbstdefinitionen auch immer in der jüngeren Zeit von „Identitätspolitik“.
Als die identitätspolitischen Bewegungen noch von nennenswerter Bedeutung gewesen sind, bezog die oder der einzelne von dort ihre/ seine Stärke im Emanzipationsprozess. Die Frauenbewegung zum Beispiel lieferte nicht nur ein Identitätsangebot, sondern gab der einzelnen Frau Selbstvertrauen. Der Kampf um Anerkennung war keine Sache für Einzelkämpfer*innen. Er wurde diskursiv in der Öffentlichkeit ausgetragen, meist mit der Schaffung einer Gegenöffentlichkeit. Eine Voraussetzung für Identitätspolitik ist, dass negative Erfahrungen „als typische Schlüsselerlebnisse einer ganzen Gruppe gedeutet werden“.[5] Gemeinsam setzt man sich zur Wehr. Diese politische Praxis wurde zu Recht Identitätspolitik genannt. Was dagegen heute unter diesem Namen läuft und vor allem als Identitätspolitik kritisiert wird, meist mit dem Vorwurf verbunden, sie spalte die „Linke“ in ihrem Kampf gegen soziale Ungleichheit oder aber die Gesellschaft überhaupt, so zum Beispiel Francis Fukuyama,[6] das sind von Affekten und von Moralismus beherrschte, gesellschaftlich unproduktive Konfrontationen.
Dabei spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Es ist verständlich, dass jemand, der sich unterlegen fühlt, der schon manches einstecken musste und keine Bewegung mehr hinter sich weiß, der nur auf imaginäre Unterstützer*innen zählen kann, nicht auf Dialog setzt, sondern in die Offensive geht. Im Internet, dem Forum der Ressentiments, ist dann die Versuchung groß, all den Frust und die aufgestaute Wut abzulassen. Anonym oder mit Pseudonym kann man das noch leichter. Shitstorms sind ein politisch relevantes Phänomen, aber keine politische Aktion.
Aber auch unabhängig vom Internet sind viele Konflikte, die der Identitätspolitik zugerechnet werden, nicht politisch. Sehen wir uns einmal das eingangs erwähnte Beispiel an! Das Lokalverbot, vermutlich nur dem Bedürfnis entsprungen zu demonstrieren, wer „hier“ das Sagen hat, dürfte kaum zum Nachdenken oder gar zur Diskussion darüber anregen, was Schwarze mit Dreadlocks zum Ausdruck bringen wollen, ob die Imitation dieser Haartracht durch eine Weiße eine fragwürdige Mimesis sein muss oder nicht auch Identifikation im positiven Sinn ausdrücken kann.
Selbst folgende Offensive einer muslimischen Studentin kann nicht als politischer Akt gelten. Diese junge Frau hat einen Referenten wegen Volksverhetzung angezeigt, weil er Bedenken über das Tragen des Kopftuchs bei Lehrerinnen geäußert hat?[7] Die Studentin überantwortet damit die Frage des Kopftuchtragens den Juristen. Die Erfolgsaussichten lassen wir beiseite. Sie strebt mit ihrer Klage nicht mehr Rechte für ihre Gruppe an, sondern die Bestrafung des Beklagten und damit das Verbot einer Meinungsäußerung. Unter den Alternativen, die sie gehabt hätte, auf die Lehrmeinung des Referenten zu reagieren (Gespräch nachher, schriftliche Auseinandersetzung mit ihm) hätte bestenfalls der unmittelbare Protest vor der übrigen Hörer*innenschaft politische Qualität gehabt. Das hätte in der Situation viel von ihr verlangt. Aber nur so hätte sie eine Wirkung bei einem, wenn auch kleinen Publikum erzielt. Vielleicht hätte sie eine Diskussion ausgelöst. Ob ihre nachträglich bekannt gewordene Klage bei Gericht in diesem Sinn produktiv war, ist mehr als fraglich.
Bei einigen Konflikten, von denen man liest, und die der Identitätspolitik zugeordnet werden, gewinnt man den Eindruck, dass insgeheim Ressourcen und Positionen oder auch Alleinstellungsmerkmale und Markenzeichen ausgehandelt werden, was der herrschenden Marktlogik – früher hätte man gesagt, dem „Geist der Zeit“ entspricht. Da wird ein Historiker, der vereinbarungsgemäß über den Kolonialismus in Afrika referieren sollte, auf Betreiben einer Initiative von der Stadt Hannover ausgeladen, die die Veranstaltungsreihe verantwortet hat (Frontal 21).[8] Ihm, Helmut Bley, so der Name des Historikers, soll man gesagt haben, ein weißer Mann könne grundsätzlich nicht über afrikanische Angelegenheiten urteilen. Die Assoziation mit „intellectual property“ drängt sich auf. Kommentar der Schwarzen Soziologin Natasha A. Kelly (HU Berlin) dazu: „Warum muss überhaupt ein weißer Mann die Perspektive einer schwarzen Person übernehmen? Weil wir keinen Zugang haben dazu.“ Sie meint die mangelnden Chancen im Wissenschaftssystem.
Die niederländische Lyrikerin Marieke Lucas Rijneveld wurde beauftragt, das Gedicht „The Hill We Climb“ von Amanda Gorman, das diese bei der Amtseinführung von Joe Biden vortrug, ins Niederländische zu übertragen. In den sozialen Medien traf das auf harsche Kritik. Denn eine Weiße könne die Gefühle einer Afroamerikanerin nicht verstehen. Daraufhin gab Rijneveld den Auftrag zurück, reagierte aber mit einem Gedicht darauf.[9] Die Fragen lyrischer Verarbeitung und literarischer Übersetzung lagen außerhalb des Horizonts der Proteste. Wie so häufig entschied eine von Naivität getragene Empörung, vermutlich befeuert durch gegenseitige Ansteckung im Netz.
Ein völlig unpolitischer Vorwurf lautet „cultural appropriation“, kulturelle Aneignung also. Nicht nur mit Dreadlocks kann man sich da schuldig machen. Es reicht schon, wie man hört, dass unsereins sich beim Karneval mal als Indianer verkleidet hat, oder erzählt, als Kind wäre man gern Indianerhäuptling gewesen (Frontal 21). Nach solchen Meldungen kann man sich nur wundern, dass bei einem Auftritt von Willy Michl, Liedermacher und Sänger aus München, Künstlername Sound of Thunder, noch nicht gerufen wurde „cultural appropriation“. Der als „Isarindianer“ bekannte läuft seit Jahrzehnten mit Federschmuck herum.
Die mehr oder weniger ungeschickte Verkleidung als Indianer oder Indianerin ist unproblematisch im Vergleich zu den ambivalenten Bildern vom edlen Wilden oder von raubgierigen Indianerhorden, die seit einhundert Jahren der Film vermittelt.[10] Die Streifen eines ganzen Filmgenres dürften eigentlich nur mit einem kritischen Vorspann gezeigt werden.
Der Name „Indianer“, die Folge eines grandiosen Irrtums europäischer Entdecker, ist problematisch, weil er die Selbstzuordnung der so Bezeichneten völlig verfehlt. Aber er dürfte hierzulande kaum jemanden verletzen, weil hier nur selten Vertreter der in die Reservate verdrängten Völkerreste von jenseits des Atlantiks auftauchen. Die mögliche Betroffenheit von Minderheitenangehörigen ist aber das maßgebende Kriterium. Im Übrigen sollte man symbolische Gesten nicht überbewerten. Mit dem Namen „Indianer“ wird den Natives lediglich symbolisch das Recht aberkannt, das ihnen mit der Politik der Reservate längst real genommen worden ist.
Das ist mit dem N-Wort etwas Anderes. Die negative Konnotation ist ein unauslöschliches Erbe des europäischen Kolonialismus. Und für die vielen Schwarzen Zeitgenossen, die hier in Deutschland und Europa leben, ist jene Bezeichnung schwer zumutbar. Ihre Empfindlichkeit ist zu respektieren. Dass „Neger“ von lateinisch niger auch nichts Anderes bedeutet als schwarz oder Schwarzer, geschenkt. Auch dass aufgeklärte Geister wie Kurt Tucholsky oder Erich Kästner das Wort in den 1920er Jahren noch unbefangen verwendeten, rechtfertigt den Sprachgebrauch heute nicht. Damals gab es hierzulande kaum einen Schwarzen, der sich getroffen hätte fühlen können.
Historisch mehr als verständlich ist auch die Verurteilung von Black Facing – vor allem für Afroamerikaner*innen eine provokante Maskerade, die den nach wie vor herablassenden Umgang mit Schwarzen nach dem Ende der Sklaverei zum Ausdruck brachte. Black Facing als cultural appropriation, also kulturelle An- oder Enteignung abzutun, wäre eine Verharmlosung. In den sog. Minstrel Shows wurden dem Publikum Karikaturen von Schwarzen präsentiert. Dominant war die Figur des dümmlich gutmütigen Dieners oder Clowns, die wir in Europa von Witzblättern kennen und vielleicht schon mal bei der Wahl des Faschingskostüms in Erwägung gezogen haben. In unseren Köpfen gibt es außerdem die Figur des bedrohlichen Wilden, des Kannibalen. Rassistische Imaginationen sind immer ambivalent, oszillieren zwischen Faszination, eventuell auch wohlwollender Belustigung, einerseits und Bedrohung andererseits.[11] Sie bewusst zu machen, ist eine pädagogische Aufgabe. Sprachliche und generell kulturelle Praktiken zu ächten, die entsprechende Bilder vermitteln, das kann nur eine identitätspolitische bzw. antirassistische Bewegung.
[1] So berichtet von Catherine Newmark in der Zeit v. 19.9.17
[2] Olympe de Gouges 1748 bis 1793, siehe Auernheimer (2020): Identität und Identitätspolitik. Köln.
[3] „Wörter, nichts als Wörter?“ In: Das Argument 213 (1996), S.13-24.
[4] Georg Auernheimer (2020): Identität und Identitätspolitik.Köln.
[5] Axel Honneth (1998): Kampf um Anerkennung. 2. Aufl. Ffm., S.260.
[6] Francis Fukuyama (2019): Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet.Hamburg.
[7] https://www.zdf.de/politik/frontal-21/cancel-culture-wie-die-identitaetspolitik-spaltet-100.html, Abruf am 3.5.21
[8] Siehe Anmerkung 7!
[9] https://www.swr.de/swr2/literatur/mit-einem-gedicht-antwortet-marieke-lucas-rijneveld-auf-die-debatte-um-ihre-gorman-uebersetzung-100.html, Abruf am 4.5.21
[10] Hans-Peter Rodenberg (1994): Der imaginierte Indianer. Frankfurt/M.
[11] Siehe Stuart Hall (1989): Rassismus in den Medien. In: Ausgew. Schriften 1. Hamburg.