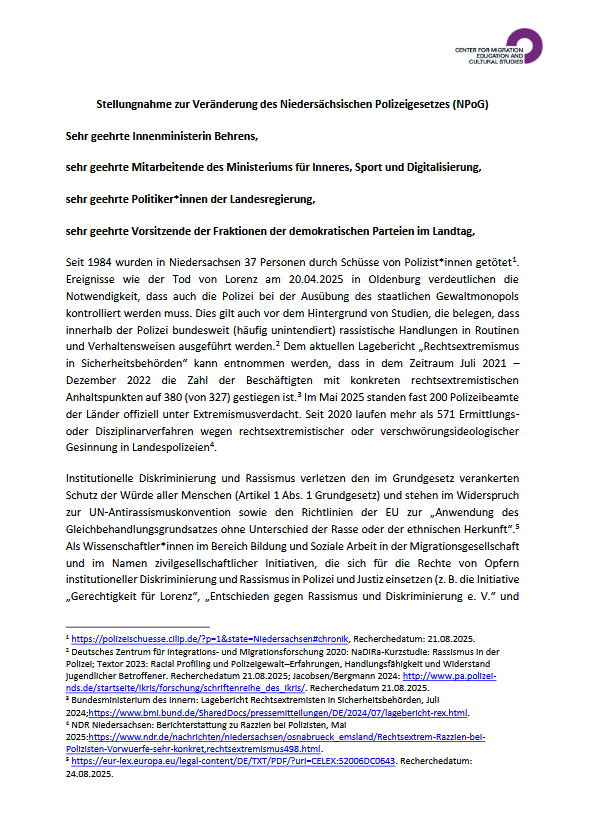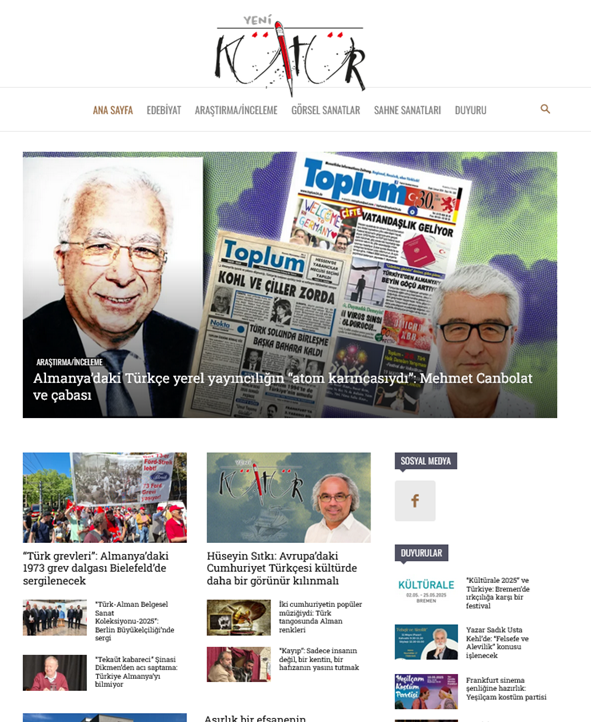Prof. Dr. Horst Pöttker | TU Dortmund
„Charity begins at home.“ Was können die Sozialwissenschaften in der Pandemie tun? Was haben sie getan? Und was können sie sich noch vornehmen?
Sie können etwas Ähnliches tun wie die Mediziner. Sie können sich die Frage stellen, wie möglichst viele Menschen vor Covid-Krankheit und –Tod zu bewahren sind. Virologen erforschen dafür das Corona-Virus und seine Eigenschaften: Übertragbarkeit, Krankheitsfolgen, Tödlichkeit und welche Mittel geeignet sind, die davon ausgehenden Gefahren für Leib und Leben zu minimieren.
Auf den Gebieten der Sozialwissenschaften wäre zu erforschen, in welchen gesellschaftlichen Konstellationen sich das gefährliche Virus auf welche Weise verbreitet. In der Makroperspektive: Welche ethnischen, Alters- oder Berufsgruppen sind wie stark betroffen? In welchen Wohn- oder Arbeitsquartieren ist die Ansteckungsrate wie hoch? Und mikrosoziologisch: Mit welchen Handlungsweise im Alltag korreliert das Ansteckungsrisiko? Erst aus solchen Erkenntnissen ließen sich – kombiniert mit medizinischem Wissen – die wirksamsten Konzepte zur Bekämpfung der Pandemie ableiten.
Was haben die Sozialwissenschaften davon geleistet? Mir scheint, ziemlich wenig. Klar, am Anfang, im Frühjahr 2020, standen sie ebenso überrascht und hilflos vor der neuen Situation wie die Mediziner; genau genommen sogar noch hilfloser, denn während für die Virologen der Gegenstand, das Virus, gleich vorhanden war und nach wenigen Tagen im Test erkannt und weiter untersucht werden konnte, baute sich das Objekt der Sozialwissenschaften erst mit dem Wachstum der Infizierten-Zahlen allmählich auf. Dennoch: Nach der ersten Welle gab es genug Infizierte, die man durch Beobachtung, Befragung, Experiment und Analyse von Verhaltensspuren hätte untersuchen können. Das ist nicht in dem Maß geschehen, wie es möglich gewesen wäre.
Es wird zwar zu Recht gefordert, dass nicht nur Virolog(inn)en, sondern auch Soziolog(inn)en, Psycholog(inn)en, Theolog(inn)en oder Kulturwissenschafter(innen) zu Rate gezogen werden sollten, wenn es zu entscheiden gilt, ob, wie und wie lange der Lockdown fortgesetzt wird. Aber diese sinnvolle Forderung geht häufig ins Leere, weil belastbare Daten über soziale Ansteckungswege kaum vorhanden sind. Großveranstaltungen sind zu vermeiden, Masketragen hilft doch – das mögen Einsichten sein, die über Ahnungen und Vermutungen hinausgehen. Aber jenseits davon ist wenig Genaues bekannt, es gibt vereinzelte Studien, die etwa zeigen, dass das Bahnpersonal ein überraschend geringes Infektionsrisiko hat. Im Großen und Ganzen jedoch stochern diejenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, wenn sie sich an die Sozialwissenschaften wenden, noch immer im Nebel.
Woran liegt das? Man darf spekulieren: Die Sozialwissenschaften machen keine Ausnahme von einer kulturellen Fehlentwicklung, deren fatale Folgen sich auch in der Pandemie zeigen, je länger sie dauert. Vielleicht sind sie sogar besonders davon betroffen. Die Entschlossenheit, nach Maßgabe eigener Vernunft Entscheidungen zu treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen, hat in der Politik, aber auch anderswo sichtlich abgenommen. Allenthalben greift eine Verzagtheit um sich, die in der diffusen Angst wurzelt, von anderen nicht anerkannt und irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden.
In der Kommunikationswissenschaft wird die Isolationsfurcht als Grund der „Schweigespirale“ gesehen und die Neigung zur Konformität als Sozialverhalten legitimiert. Kant hat sich das anders vorgestellt, als er im Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, das Wesen der Aufklärung erkannte. Daraus entwickelte sich die Idee der mündigen Bürger(innen) als Träger der Demokratie. Wer Konflikte scheut, ist dagegen versucht, nicht der eigenen Vernunft, sondern der Tradition zu folgen.
Auch wenn solcher Konformismus der wissenschaftlichen Verpflichtung zur Innovation widerspricht, dürfte er dort besonders verbreitet sein, wo Erkenntnisfortschritt sich nicht nur am Aufstapeln zutreffender Erkenntnisse bemisst, sondern auch am Wechsel von Perspektiven, die dann für mehr oder weniger lange Zeit vorherrschend bleiben und in dieser Zeit Konformität erheischen. In den Geistes- und Sozialwissenschaften bedarf es besonderer Frische des Denkens, um sich von herkömmlichen Fragen zu lösen und neue Herausforderungen zu erkennen, was in der Pandemie besonders wichtig ist.
Ich möchte das – charity begins at home – am Beispiel meines Fachs, der Journalistik, demonstrieren, wobei ich mich an die eigene Nase fassen muss: Was läge näher als zu untersuchen, unter welchen medialen Bedingungen und in welchen Darstellungsformen Journalist(inn)en am wirksamsten speziell über das Virus und seine Verbreitung aufklären, besonders darüber möglichst zutreffende und wichtige Informationen möglichst weit verbreiten können, damit der oder die Einzelne sich schützen und die Gesellschaft die Pandemie überwinden kann?
Statt uns vordinglich um diese Fragen zu kümmern, sind wir in der Journalistik (zu) lange auf dem eingefahrenen Gleis geblieben, auf dem es vor allem um Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit des Journalismus gegenüber der Politik geht. Gleich zu Beginn der Pandemie entbrannte im Fach ein Streit darüber, ob die Medien sich von den Politiker(inne)n zum Werkzeug einer angeblich alternativlosen Seuchenbekämpfung machen ließen, statt auch in dieser Ausnahmesituation aus der kritischen Distanz der „vierten Gewalt“ die staatlichen Schutzmaßnahmen auf Zweckmäßigkeit und Folgen für Humanität und Wirtschaft zu prüfen.
Darüber ist eine Forschung, die konstruktiv die Möglichkeiten des Journalismus bei der Pandemiebekämpfung ins Zentrum rückt, zu kurz gekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mit der Fortdauer der Pandemie wächst das Material, an dem sich nachhaltige Erkenntnisse gewinnen lassen. Selbst wenn solche Einsichten erst gewonnen werden, wenn die Pandemie überwunden ist, wäre das nicht vergeblich – die nächste Seuche kommt bestimmt.