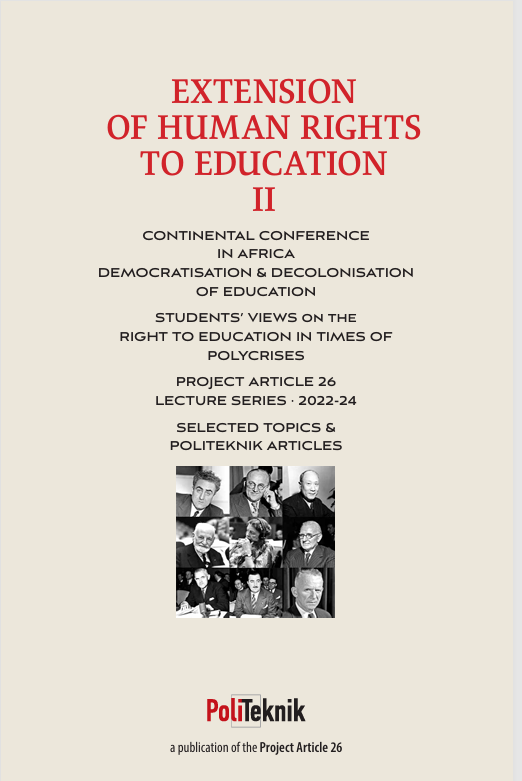Umso umfangreicher Militäretats, Rüstungsexporte und Auslandseinätze wachsen, desto häufiger sprechen unsere Regierenden und ihre Sänger/innen von „Frieden“. Umso stärker sich soziale, wirtschaftliche und politische Ungleichheitsverhältnisse ausprägen, desto häufiger hört man die schönen Sonntags-Worte vom „sozialen Zusammenhalt“. Die soziale Frage, Ungleichheiten und deren Implikationen sind so präsent wie selten zuvor. Allerdings wächst deren Thematisierung im nationalistisch-ethnisierenden Sinne stärker als solidarisch-internationalistische Stimmen. Dabei ist es interessant zu sehen, wie auch heute wieder der weltweite Aufstieg der (extrem) rechten Bewegung lieber den angeblich dummen, fremdenfeindlichen Unterklassen zum Vorwurf gemacht wird, als den Beitrag der ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen, medialen und anderen gesellschaftlichen Eliten genauer unter die Lupe zu nehmen. Letzteres soll deshalb im Folgenden im Vordergrund stehen.
Der Koalitionsverstrag der aktuellen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD vom 14. März 2018 verspricht im Titel nicht nur „Aufbruch für Europa“ und „eine neue Dynamik für Deutschland“, sondern zudem „eine(n) neue(n) Zusammenhalt für unser Land“ [1] Inklusive Überschriften kommt der Begriff „Zusammenhalt“ immerhin 19-mal im Koalitionsvertrag vor. Zugleich folgte die dritte Große Koalition während der Amtszeit von Angela Merkel dem Dogma, dass es keine Steuererhöhung geben dürfe, und zwar für niemanden – selbst für Großkonzerne, Reiche oder Hyperreiche nicht, wie Christoph Butterwegge in seinem Band „Die zerrissene Republik“ schreibt (Butterwegge 2020, S. 303). Und er ergänzt: „Während die Schlüsselbegriffe ‚Digitalisierung‘ und ‚digital‘ in dem (…) 173 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD nicht weniger als 298-mal auftauchte(n), wurde die Ungleichheit nur an drei Stellen erwähnt. Bezogen auf Deutschland kam dieser Begriff sogar bloß einmal vor, nämlich als „wachsende Ungleichheit zwischen Städten und Regionen“, die durch ein „neues gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden und Kreise“ verringert werden sollte. Offenbar war die Ungleichheit zwischen Kapital und Arbeit, den Klassen bzw. Schichten sowie zwischen Arm und Reich in der Bundesrepublik für CDU, CSU und SPD kein Problem, obwohl sie schon im Titel ihres Koalitionsvertrages einen neuen Zusammenhalt zu schaffen versprachen.“ (ebd.) Insofern macht das Versprechen doch nachdenklich.
Einen weiteren Hinweis auf möglicherweise mangelnden „sozialen Zusammenhalt“ in Deutschland haben inzwischen auch verschiedene Ämter und Gerichte erbracht. Indem sie sozialstaatsförderliche Nichtregierungsorganisationen wie „Attac“ und „Campact“ die Gemeinnützigkeit absprechen, aber verschiedenen Gruppen von Finanzlobbyisten und Militär-Lobbies weiterhin als eingetragene, gemeinnützige Vereine betrachten, bewirken sie – absichtlich oder unabsichtlich – eine Einschränkung der Arbeit von NGOs zugunsten des demokratischen und sozialen Rechtstaates. Ähnlich gelagert ist die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschist(inn)en (VVN/BdA) politikwissenschaftlich einzuschätzen, da zugleich verschiedenste eindeutig demokratiefeindliche Rechtsaußen-Vereine und extrem-rechte Verbindungen weiterhin mit steuerlichen Vergünstigungen zu rechnen haben. Wer für Militär, Nationalismus und autoritäre Männerbünde wirbt, kann sich demnach als „gemeinnützig“ verstehen. Wer sich für Artikel 1, Art. 14, Art. 15 und Art. 20 des Grundgesetzes über die Menschenwürde, die Sozialbindung des Eigentums und das Sozialstaatsgebot einsetzt oder gar für den Grundgesetzartikel 139, wonach „(d)ie zur ‚Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus‘ erlassenen Rechtsvorschriften (…) von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt (werden)“, also weiterhin Gültigkeit besitzen, einsteht, müsste demnach um seine Gemeinnützigkeit fürchten. Das wäre dann ein buchstäblicher Bärendienst am sozialen Rechtsstaat und seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen.
Doch die Gefahr der sozialen Spaltung wird aus konservativer und neoliberaler Sicht viel zu stark übertrieben. Im Jahre 2011 schrieb der damalige Chefredakteur des Handelsblatts, Gabor Steingart in einem Artikel über den Sozialstaat, dass „Deutschland immer sozialer“ und dauernd bloß von oben nach unten umverteilt werde. Kürzlich hat der Historiker und WELT-Redakteur Sven-Felix Kellerhoff in der Antwort auf einen Leserkommentar geschrieben: „Noch nie gab es in Deutschland eine größere Umverteilung nach unten, in den Bereich der Arbeitsunfähigen oder Arbeitsunwilligen, als heute.“ (Welt-Redakteur Sven-Felix Kellerhoff in der Antwort auf einen Leserkommentar, in: WELT.de v. 14.1.2020)
Demgegenüber beweist Christoph Butterwegge in seinem neuen Buch über „Die zerrissene Republik“, dass sich die wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit dergestalt entwickelt, dass der viel bemühte „soziale Zusammenhalt“ schwindet und mit guten Gründen buchstäblich von einer „zerrissenen Republik“ gesprochen werden kann. „Armut und Reichtum sind im Kapitalismus der Gegenwart strukturell so miteinander verzahnt, dass beide tendenziell zunehmen. Die zum Teil skandalös niedrigen (Dumping-)Löhne für Millionen prekär Beschäftigte bedeuten nämlich hohe Gewinne, Dividenden und Renditen für Unternehmer, Kapitalanleger und Börsianer.“ (Butterwegge 2020, S. 110). Während daraus im globalen Maßstab ökonomische Krisen und (Bürger-)Kriege resultieren, die wiederum größere Migrationsbewegungen nach sich ziehen, sind in Deutschland der soziale Zusammenhalt und die repräsentative Demokratie bedroht. Daher thematisiert Butterwegge nicht bloß, wie soziale Ungleichheit entsteht und warum sie zugenommen hat, sondern auch, weshalb die politisch Verantwortlichen darauf kaum reagieren und was getan werden muss, um sie einzudämmen.
Ähnlich stellte schon der 2012 verstorbene britische Sozial- und Universalhistoriker Eric Hobsbawm die Umverteilung von oben nach unten als eine Schlüsselfrage der Entwicklung moderner Gesellschaften dar. Auch unter Berücksichtigung ökologischer Zusammenhänge prognostizierte er bereits 1995, dass die Politik des neuen Jahrtausends vielmehr durch soziale Umverteilung als durch ökonomisches Wachstum bestimmt sein werde. Dabei war er damals schon nicht so naiv wie manche öko-kapitalistische Forderung nach der Macht der Märkte für mehr Nachhaltigkeit (vgl. Interview mit Habeck und Baerbock: Der Markt soll es richten, in: FAZ.net v. 23.3.2019). Stattdessen vermutete Hobsbawm: „Die marktunabhängige Zuteilung von Ressourcen, oder zumindest eine scharfe Beschränkung der marktwirtschaftlichen Verteilung, wird unumgänglich sein, um der drohenden ökologischen Krise die Spitze zu nehmen.“[2]
Mehr Ungleichheit fordern und die Folgen verdammen?
Bei manchen Kolleginnen und Kollegen fühlt man sich indes irgendwie an den Spruch: „Wasch‘ mir den Pelz, aber mach‘ mich nicht nass!“ erinnert. Wie kommt das? Wie kann man als Intellektuelle/r über Jahre hinweg einflussreich alle möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Ungleichheit in der Gesellschaft fordern und fördern, und dann deren Ergebnis publikumsträchtig betrauern?
Der Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Wolfgang Streeck hielt noch im Jahre 2000 einen Anstieg der gesellschaftlichen Ungleichheit auf „dem erreichten Niveau des allgemeinen Wohlstands“ nicht nur für „unvermeidlich“, sondern auch für „grundsätzlich hinnehmbar“ und „notwendig“ zur weiteren Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Mit Hilfe einer so gearteten „zivile(n) Bürgergesellschaft“ werde endlich Abschied genommen vom „staatszentrierten Irrealsozialismus der westdeutschen Wohlstandsperiode“. Der begriffsstutzigen „Sozialarbeiterfraktion in Partei und Gewerkschaften“ galt seine Botschaft, vom Staat „nicht mehr alles, sondern nur noch immer weniger“ zu erwarten: „(D)ie Gesellschaft und der Einzelne müssen und können mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen, also mehr aus der eigenen Tasche bezahlen (…); der Staat als Vollkaskoversicherung hat ausgedient.“[3]
Woher die seit Jahrzehnten gestiegene soziale Ungleichheit gekommen ist und wie sie sich entwickelte, hat auch Wolfgang Merkel in der Zeitschrift „Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte“ (6/2016) knapp zusammengefasst. Der Politikwissenschaftler, seit 1998 Mitglied der SPD-Grundwertekommission, bezeichnet die gestiegene „Ungleichheit als Krankheit der Demokratie“. Was wie eine etwas verunglückte biologistische Demokratietheorie klingt, entpuppt sich jedoch als relativ klare Beschreibung des keineswegs schicksalhaften Aufstiegs neoliberaler Ordnungen. So führt er dazu folgendes aus: „Am Anfang war Margaret Thatcher. Dann folgte Ronald Reagan. Märkte wurden dereguliert, Steuern auf hohe Einkommen, Erbschaften, Vermögen und Unternehmensgewinne gesenkt. Die gesamtwirtschaftliche Lohnquote fiel, die Gewinnquote aus Unternehmens- und Kapitaleinkünften stieg. Die funktionelle Einkommensverteilung der reichen Volkswirtschaften hat sich damit verschoben. Kapitalbesitzer werden einseitig bevorteilt. Seit Beginn der 80er Jahre ist die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in der OECD-Welt gestiegen, gleichgültig welchen Indikator man verwendet. Der Anstieg der Ungleichheit war nicht die ‚natürliche‘ Folge von digitaler Revolution, Wissensökonomie und kühner schöpferischer Zerstörung. Er war vor allem eine Folge politischer Entscheidungen. Die Politik hatte der Steuerung der Märkte entsagt und schrieb die besondere Form der Marktermächtigung im sogenannten Washington Konsens von 1990 fest.“ (Merkel 2016, S. 14-19, hier: S. 14) Doch das musste auch in Deutschland von Politiker(inne)n, Wissenschaftler(inne)n und Medien vorbereitet, begleitet und durchgesetzt werden. Und hier begegnen wir wieder Wolfgang Merkel als einem Anhänger und vehementen Verteidiger etwa der „Motive und Grundkonstanten der Agenda 2010“, wodurch vermutet werden könnte, dass er diesen Prozess mit zu verantworten hat, was angesichts seiner kritischen Betrachtungsweise bemerkenswert ist.[4]
Agenda-Nostalgiker
Was waren also die „Motive und Grundkonstanten der Agenda 2010“? Für den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder lässt sich das kurz zusammenfassen. Er sagte dazu im Bundestag: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.“ (14.3.2003 im Bundestag). Das klang fast wörtlich, wie die Streeckschen Forderungen aus dem Jahre 2000 und in der Tat war der Wissenschaftler gleichzeitig hochrangiger Berater des Kanzlers.
Dennoch findet offenbar auch der Offenbacher Jobcenter-Chef Matthias Schulze-Böing (SPD), dass »Hartz IV« allen Ernstes als Inbegriff von »Inklusion« zu verstehen sei. Für Armut und Langzeitarbeitslosigkeit macht er regelmäßig die von ihm als »Kunden« bezeichneten Betroffenen verantwortlich und beschimpft Christoph Butterwegge als »professoral dotierten Agitator«, der ohne wissenschaftliches Ethos »mit Fehlinformationen Unfrieden« stifte, weil er einen Hartz-IV-kritischen offenen Brief an den SPD-Kanzlerkandidaten von 2017 verfasst hatte (vgl. Frankfurter Rundschau v. 1.3.2017). Es gibt also immer noch eine starke, aber kontrafaktische „Agenda-Nostalgie“ in bestimmten Kreisen, die Hartz IV und Co. am liebsten als den Höhepunkt „sozialen Zusammenhalts“ dargestellt wissen wollen.
Dabei waren Ziele von Hartz IV und Agenda 2010 wirklich kein großes Geheimnis. Denn der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder forderte ja selbst schon 1999 freimütig: „Wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau vom 25.7.2013). Und Hans-Ulrich Jörges feierte Ziele und Inhalte von Hartz IV: „Kein Arbeitsloser kann künftig noch den Anspruch erheben, in seinem erlernten Beruf wieder Beschäftigung zu finden, er muss bewegt werden, den Job nach überschaubarer Frist zu wechseln – und weniger zu verdienen. Die Kürzung des Arbeitslosengeldes und die Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau verfolgen exakt diesen Zweck. Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter Androhung der Verelendung zu Arbeit gezwungen werden“ (Hans-Ulrich Jörges, in: Stern vom 11.9.2003).
Diese Entrechtungs- und Lohndumping-Dynamik war und ist demnach ein bewusst eingesetztes gesellschaftspolitisches Konzept. Wer sich also über die gravierende Kinderarmut aufregt, muss wissen, dass sie politisch befördert wurde. Eltern sollten durch zu niedrige Regelsätze bzw. -leistungen nach SGB II für sich und ihre Kinder sowie durch verschärfte Sanktionen dazu gezwungen werden, jede Arbeit anzunehmen, auch wenn sie von diesem Gehalt sich und ihre Familie nicht einmal ernähren können. Kein Wunder, dass der Bundeskanzler daraufhin stolz das Ergebnis seiner „Agenda 2010“ auf dem Wirtschaftsforum von Davos 2005 kundtat: „Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau vom 8.2.2010).
Diese von ihm mit beförderte Entwicklung sieht der Sozialwissenschaftler Wolfgang Streeck inzwischen richtigerweise als sehr problematisch an. Er erblickt nicht in den aufrührerischen Unterschichten ein Gefährdungspotential für den sozialen Zusammenhalt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern vielmehr bei den immer antidemokratischer agierenden finanzmarkthörigen Eliten. Während „die Massenloyalität der Arbeit- und Konsumnehmer gegenüber dem Nachkriegskapitalismus stabil“ geblieben sei, war es laut Streeck das Kapital, „das dem demokratischen Kapitalismus (…) die Legitimation“ aufgekündigt habe, um soziale Verpflichtungen loszuwerden (Streeck 2013a, S. 44f.). Nicht die Arbeiterklasse und die Lohnabhängigen seien es gewesen, sondern „Kapitalbesitzer und Kapitalverwalter“ hätten „einen langen Kampf für einen grundlegenden Umbau der politischen Ökonomie des Nachkriegskapitalismus“ begonnen (Streeck 2013a, S. 54), um eine „Fundamentalrevision des Wohlfahrtsstaates der Nachkriegsjahrzehnte“ einzuleiten (Streeck 2013a, S. 57).
Verbunden mit einer immer ungerechteren Ressourcenverteilung in der Gesellschaft stellt sich aber ein unversöhnlicher Antagonismus her zwischen Kapitalismus und Demokratie, wie Streeck ebenfalls richtigerweise herausarbeitet. „Wenn folglich der Kapitalismus des Konsolidierungsstaates auch die Illusion des gerecht geteilten Wachstums nicht mehr zu erzeugen vermag, kommt der Moment, an dem sich die Wege von Kapitalismus und Demokratie trennen müssen. Der heute wahrscheinlichste Ausgang wäre dann die Vollendung des hayekianischen Gesellschaftsmodells der Diktatur einer vor demokratischer Korrektur geschützten kapitalistischen Marktwirtschaft.“ (Streeck, 2013b, S. 62)
Einigermaßen resignativ kommt Streeck auch auf die gegenteilige Alternative eines etwaigen demokratischen Post-Kapitalismus zu sprechen, ohne diesen aber beim Namen zu nennen. Er verwirft jedoch sofort deren mögliche Realisierung angesichts der offensichtlichen Stärke ihres Kontrahenten, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. „Die Alternative zu einem Kapitalismus ohne Demokratie wäre eine Demokratie ohne Kapitalismus. (…) Sie wäre die andere, mit der Hayekschen konkurrierende Utopie.“ Aber „im Unterschied zu dieser läge sie nicht im historischen Trend, sondern würde im Gegenteil dessen Umkehr erfordern. Deshalb und wegen des enormen Organisations- und Verwirklichungsvorsprungs der neoliberalen Lösung (…) erscheint sie heute als vollkommen unrealistisch“ (Streeck, 2013b, S. 62f.). Ein Realismus-Begriff wird allerdings dann problematisch und geradezu gattungsgefährlich, wenn sich mehr Menschen einen „Kapitalismus ohne Welt“ als eine „Welt ohne Kapitalismus“ vorstellen können. Dagegen steht zumindest die Aussage des argentinischen Arztes und Revolutionärs Ernesto Che Guevara, welcher sagte: „Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche!“
Es irritiert allerdings auch einigermaßen, dass mit Streeck gerade jemand gegen den seit Jahrzehnten aufgekommenen neoliberalen Kapitalismus zurecht wettert, der selbst seit Jahrzehnten in höchsten wissenschaftlichen Regierungsberater-Gremien und strategischen Stellen den Machtanstieg des neoliberalen Kapitalismus in Deutschland z.B. durch die Maßnahmen der sog. Agenda 2010 ideologisch vorbereitet hat (inklusive Propagierung eines breiten Niedriglohnsektors, mehr Flexibilisierung, Deregulierung und Privatisierung sowie eines grundsätzlichen Anti-Keynesianismus; vgl. Müller 2013). Was also auf der Basis der gegenwärtigen antikapitalistischen Erkenntnisse des Autors Grund genug wäre für eine selbstkritische Aufarbeitung zum Thema „Verantwortung von Wissenschaft“, erscheint Streeck offenbar nur als böswillige Verleumdung seiner früheren tadellosen Tätigkeiten für die Bundesregierung unter Gerhard Schröder (vgl. Müller 2013).
Fazit
Sowohl Wolfgang Merkel, als auch Wolfgang Streeck sind sich einig, dass die soziale Ungleichheit inzwischen stark gestiegen ist und sich damit bedrohliche Folgewirkungen ergeben, die sie zurecht beklagen. Nur bei der selbstkritischen Aufarbeitung des eigenen Anteils an der ideologischen Mobilisierung für neoliberale Maßnahmen und für mehr soziale Ungleichheit scheinen sich die Verantwortlichen vollständig in Nebel und Verdrängung zu verstecken. Solange Politik, Medien und Wissenschaft so unkritisch mit der eigenen Tätigkeit umgehen, unterliegen sie der Gefahr, kausale Erkenntnisse zum Verständnis von Entwicklungsprozessen auszublenden. Hier wäre von der selbstkritischen Reflexion eines Pierre Bourdieu viel zu lernen über gesellschaftliche Spaltungsprozesse und intellektuelle Verantwortung.
Literatur:
Butterwegge, Christoph (2020): Die zerrissene Republik. Wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Beltz Juventa Weinheim/Basel.
Merkel, Wolfgang (2010): Falsche Pfade? Probleme sozialdemokratischer Reformpolitik, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 7-8/2010, S. 72-75.
Merkel, Wolfgang (2016): Ungleichheit als Krankheit der Demokratie, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 6/2016, S. 14-19.
Müller, Albrecht (2013): Der Soziologe Wolfgang Streeck war ein durchsetzungsfähiger Wissenschaftler. Aber die ihn heute lobend zitieren, wissen offensichtlich nicht, für was er Pate gestanden hat, für die Agenda 2010. In: Nachdenkseiten.de v. 7.5.2013.
Streeck, Wolfgang (2000): Die Bürgergesellschaft als Lernzielkatalog, in: Die Mitbestimmung 6/2000, S. 28-30.
Streeck, Wolfgang (2013a): Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 3. Auflage, Berlin.
Streeck, Wolfgang (2013b): Was nun Europa? – Kapitalismus ohne Demokratie oder Demokratie ohne Kapitalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2013 2013b, S. 57-68.
Streeck, Wolfgang. In: Wikipedia.de v. 18.8.2015.
[1] Vgl. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, Berlin 2018, S. 1
[2] Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München/Wien 1995, S. 711
[3] Wolfgang Streeck, Die Bürgergesellschaft als Lernzielkatalog, in: Die Mitbestimmung 6/2000, S. 28-30, hier: S. 28f.
[4] Vgl. seine Verteidigung der „Motive und Grundkonstanten der Agenda 2010“ noch im Jahre 2010 in: Wolfgang Merkel: Falsche Pfade? Probleme sozialdemokratischer Reformpolitik, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 7-8/2010, S. 74