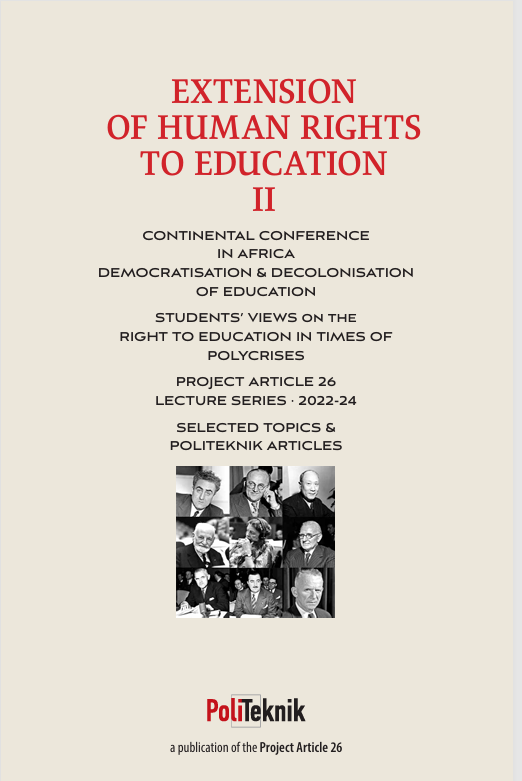Im Herbst 2015 haben die Vereinten Nationen einstimmig die Nachhaltigkeits-agenda 2030 beschlossen. Ihr Kern besteht sie aus 17 Nachhaltigkeitszielen, mit 169 Spezifizierungen. Die letzteren sind aber für das normale Publikum weitgehend unbekannt.
Das eigentliche Problem besteht darin, dass die Entwicklungsländer bei den Verhandlungen darauf insistierten, dass die ökonomischen Entwicklungsziele klare Priorität erhalten. Die Ziele heißen ausdrücklich Sustainable Development Goals. Und die ersten 11 Ziele sind rein ökonomisch zu definieren, angefangen mit der Überwindung der Armut und Überwindung des Hungers (Abbildung 1)

Abbildung 1: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung als Kern der Nachhaltigkeitsagenda 2030
Wenn diese elf Ziele bis 2030 für dann mehr als 8 Milliarden Menschen erreicht werden, sind die Ziele 13 (Klima), 14 (Ozeane) und 15 (biologische Vielfalt an Land) in einer hoffnungslosen Lage. Es sei denn, man erfindet eine radikal andere Ökonomie, bei welcher (z.B.) die Überwindung der Arbeitslosigkeit (Ziel 8) keinen Schaden an Klima, Ozeanen und biologischer Vielfalt anrichten, – eine total illusorische Vision.
Es ist aber begreiflicherweise ein Tabu, bei den Vereinten Nationen, diesen fundamentalen Antagonismus zwischen ökonomischen und ökologischen Zielen anzusprechen.
Ein politischer Weg, das Dilemma zur Sprache zu bringen und damit die ökologischen Ziele zu retten ist dieser: Man kann und sollte zeigen, dass eine Klimaverschlechterung die Ärmsten der Armen viel härter trifft als die Wohlabenden, und dass ein fortgesetzter Verlust der biologischen Vielfalt auch in den Weltmeeren die Überwindung des Hungers praktisch verhindert. Das kann bei Nachdenklichen in der Politik und den Medien dazu führen, dass man die Sicherung der Ziele 13, 14 und 15 ernstnimmt und nicht dem konventionellen Wachstum opfert.
In Wirklichkeit hat der Club of Rome aber in seinem großen Bericht Wir sind dran[1]gezeigt, dass die heutige Denkweise nun mal ökonomistisch ist, und dass nichts weniger als eine neue Aufklärung erforderlich sei, um eine Balance zwischen Mensch und Umwelt sowie zwischen Kurzfrist und Langfrist herzustellen.
Eine historische Gegebenheit in der Rhetorik der Entwicklungsländer ist erwähnenswert. Beim ersten UNO-Umweltgipfel von 1972 war die Wortführerin der Entwicklungsländer die damalige indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi und erlebte eine riesige Popularität mit dem Slogan Poverty is the biggest polluter. Dier Slogan fußte auf der Tatsache, dass sich die reichen Länder den teuren Umweltschutzleisten leisten konnten, die armen nicht. Das galt für die lokale Verschmutzung. Heute aber geht es beim Klima, bei den Ozeanen und der Biodiversität eher um das Phänomen Affluence is the biggest polluter. Die Logik „erstmal reich werden und dann sich um die Umwelt kümmern“ wäre heute total kontraproduktiv.
Die letzten Endes größte Gefahr für die ökologischen Ziele wird im Übrigen in der Nachhaltigkeitsagenda überhaupt nicht erwähnt: die immer noch rasende Vermehrung der Weltbevölkerung. Zwar wird hiergegen immer eingewandt, dass die ärmeren Länder, in denen diese Vermehrung heute stattfindet pro Kopf viel kleiner ökologische Fußabdrücke haben als die reichen. Aber jeder weiß, dass die politische Macht der ärmeren Mehrheiten tendenziell dafür sorgt, dass diesen das Wirtschaftswachstum sehr zugute kommt; und wer wollte ihnen dieses neiden? Empirisch haben die Entwicklungsländer in den letzten Jahrzehnten dramatisch aufgeholt, wie die „Elefantenkurve“[2] zeigt (Abbildung 2). Der gezeigte Zeitraum endet zwar im Jahr 2008, aber in den letzten elf Jahren hat sich die Entwicklung fortgesetzt.
Es sind auch die Entwicklungsländer, in denen heute die Dynamik der Kohleverbrennung stattfindet. Derzeit sind etwa 1380 neue Kohlekraftwerke im Bau oder in Planung, und über 90% derselben in den Entwicklungsländern[3]. Das ist denselben moralisch nicht zu verübeln, aber es ist ein klares Signal dafür, dass eine Klimapolitik, die sich nur um das Wohlverhalten der alten Industrieländer dreht, zum Scheitern verurteilt ist.

Abbildung 2: Die “Elefantenkurve”. Das Wohlstandswachstum von 1998-2008 fand in der Hauptsache in den Schwellen- und Entwicklungsländern (sowie bei den globalen Finanzeliten) statt.
Abbildung 2: Die “Elefantenkurve”. Das Wohlstandswachstum von 1998-2008 fand in der Hauptsache in den Schwellen- und Entwicklungsländern (sowie bei den globalen Finanzeliten) statt.
Eine realistische Politik der globalen Nachhaltigkeit müsste also in erster Linie darin bestehen, dass es den Entwicklungsländern zum ökonomischen Vorteil gereicht, Klima, Ozeane und Biodiversität zu schonen. Für die Biodiversität gibt es in der Konvention über Biologische Vielfalt (englisch abgekürzt CBD) das „Access und Benefit Sharing“ (ABS) Prinzip, welches die Nutznießer genetischer Ressourcen (insbesondere Pharma- und Saatgutkonzerne aus dem Norden) verpflichtet, ihren ökonomischen Vorteil mit den Herkunftsländern der genetischen Ressourcen fair zu teilen. Das Prinzip wurde 2010 in Nagoya in dem Nagoya-Protokoll konkretisiert, und das Protokoll trat am 12.10.2014 völkerrechtlich in Kraft.[4] Leider sind aber die Industrieländer, allen voran die USA, kaum bereit, sich an die Regelungen des Nagoya-Protokolls zu halten
Beim Klima ist eine ähnliche Regelung von Deutschland bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen ins Gespräch gebracht worden, wurde dort aber von den USA, Russland, Saudi-Arabien und anderen Staaten schroff abgelehnt. Das wird „Budgetprinzip“[5] genannt und sagt, dass alle Länder der Welt ein pro Kopf der heutigen Bevölkerung gleichgroßes Recht auf Nutzung der Atmosphäre erhalten, dass aber die historischen Verbräuche darauf angerechnet werden müssen. Dann haben die alten Industrieländer ihr „Budget“ im Wesentlichen schon verbraucht und müssten nun mit Entwicklungsländern Verträge abschließen, in denen diese den Industrieländern Lizenzen verkaufen. Hierdurch würde nach der in Deutschland begonnenen neuen Welle der Verbilligung der erneuerbaren Energien sowie nach den gigantischen Potenzialen der Energieeffizienz eine Situation eintreten, wo die Wirtschafts-minister der Entwicklungsländer dafür plädieren, keinerlei neue Kohlekraftwerke mehr zu bauen und stattdessen den Übergang zu Effizienz und erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Und plötzlich würden die Klimakonferenzen wieder richtig Sinn machen.
Beim Schutz der Ozeane müssen die Schutzgebiete gegen Überfischung deutlich verschärft und kontrolliert werden und müssen scharfe Regelungen zur Verhinderung der Einleitung von Plastikabfällen und giftigen Substanzen in die Meere beschlossen werden. Diese müssten finanziell insbesondere die Herstellerländer der Kunststoffe treffen. Chemische Innovationen für Kunststoffe, die sich umweltverträglich von selber auflösen würden natürlich den Kostendruck gewaltig vermindern.
Die zum Schluss genannten Vorschläge sind nur Skizzen. In Wir sind dran ist insbesondere die Klimafrage sowie die Notwendigkeit einer Kontrolle der Finanzmärkte ausführlich diskutiert. Und dem Weg zu einer neuen Aufklärung im Dienste der Nachhaltigkeit ist der gesamte zweite Buchteil gewidmet.
[1] Ernst von Weizsäcker, Anders Wijkman u.a. 2018. Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Gütersloher Verlagshaus. (Englische Originalfassung: Come On!, Springer, Heidelberg, New York.)
[2] Branko Milanovic, World Bank. 2016. https://milescorak.com/2016/05/18/the-winners-and-losers-of-globalization-branko-milanovics-new-book-on-inequality-answers-two-important-questions/.
[3] Energiezukunft, 13.12.2017 und 5.10.2018
[4] The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing, abrufbar auf der Homepage der Convention on Biological Diversity (CBD).
[5] Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU). 2009. Solving the climate dilemma: The budget approach. Berlin.