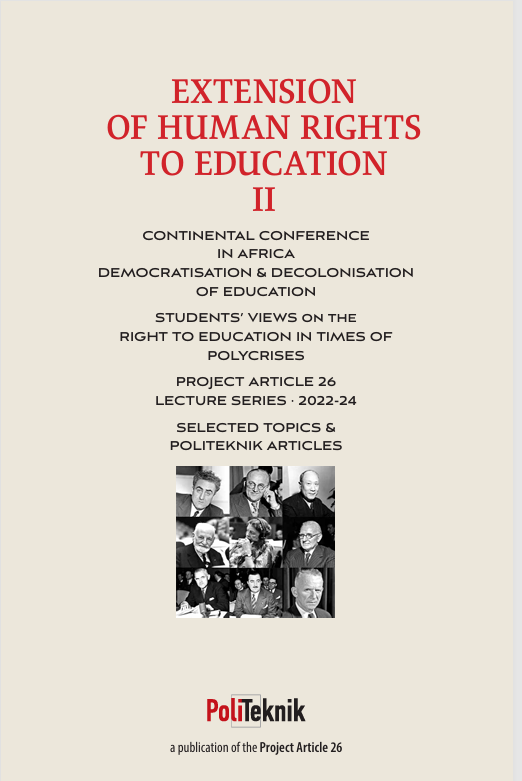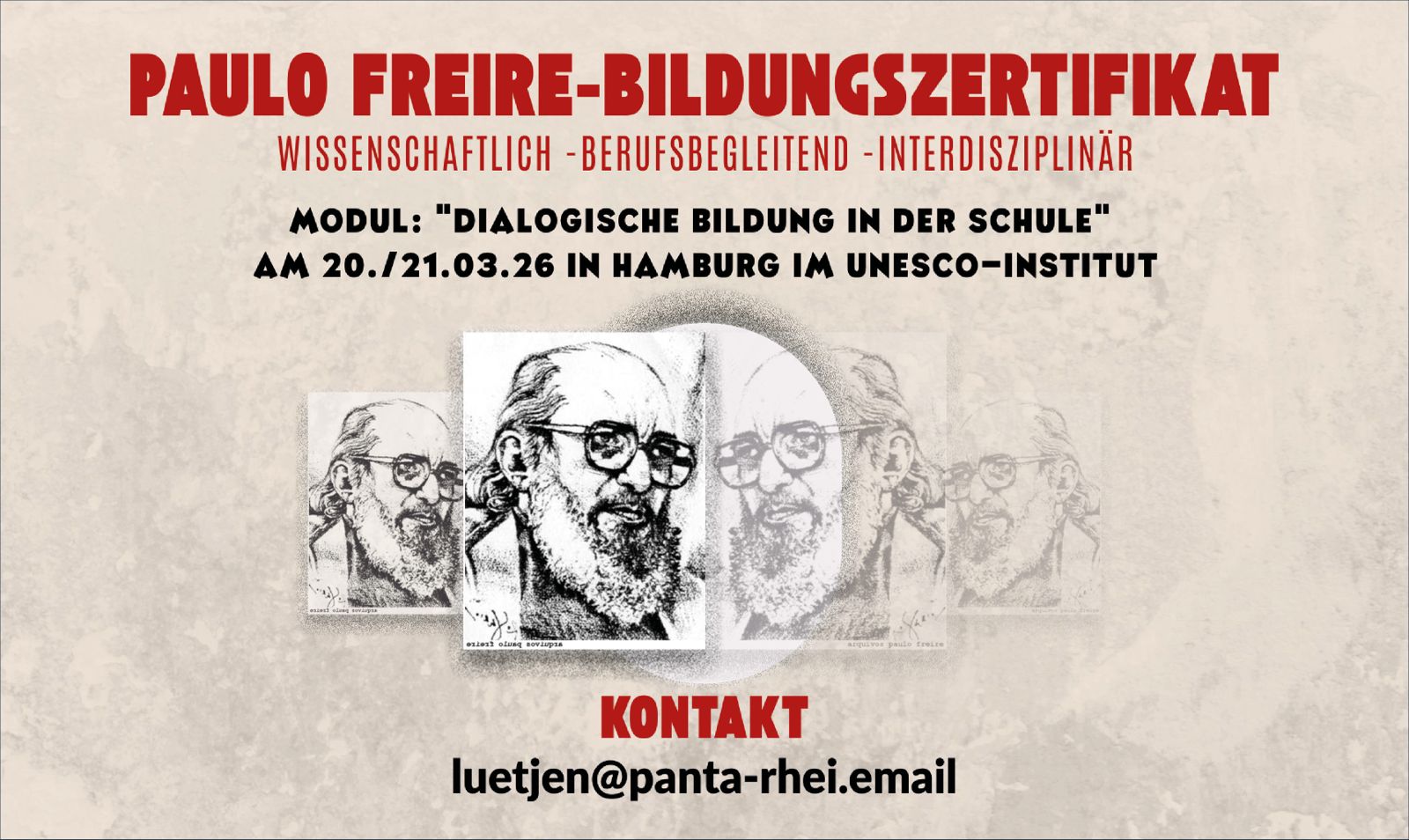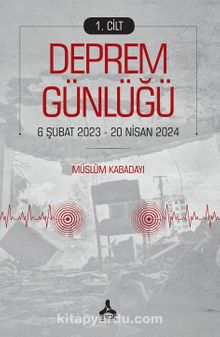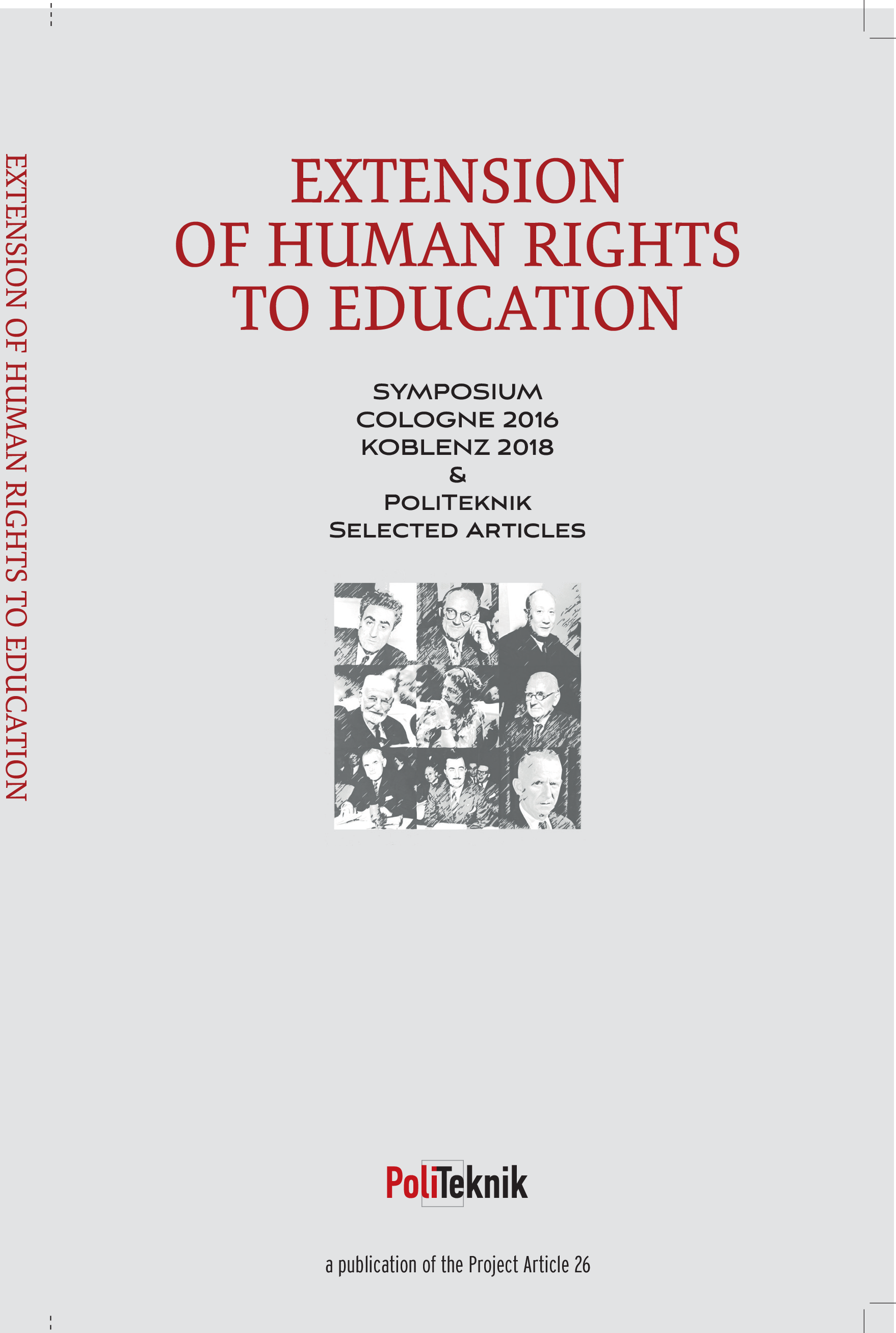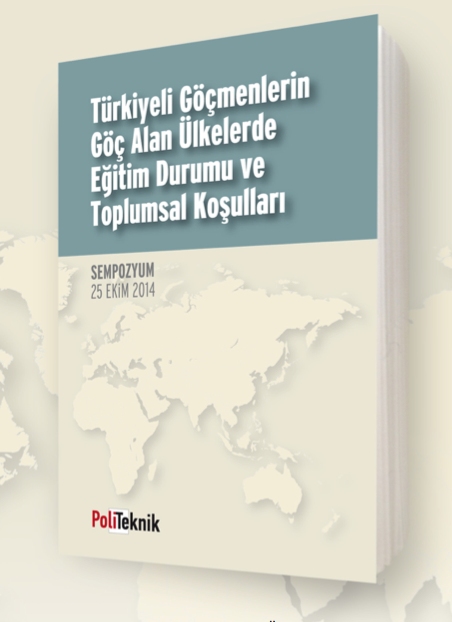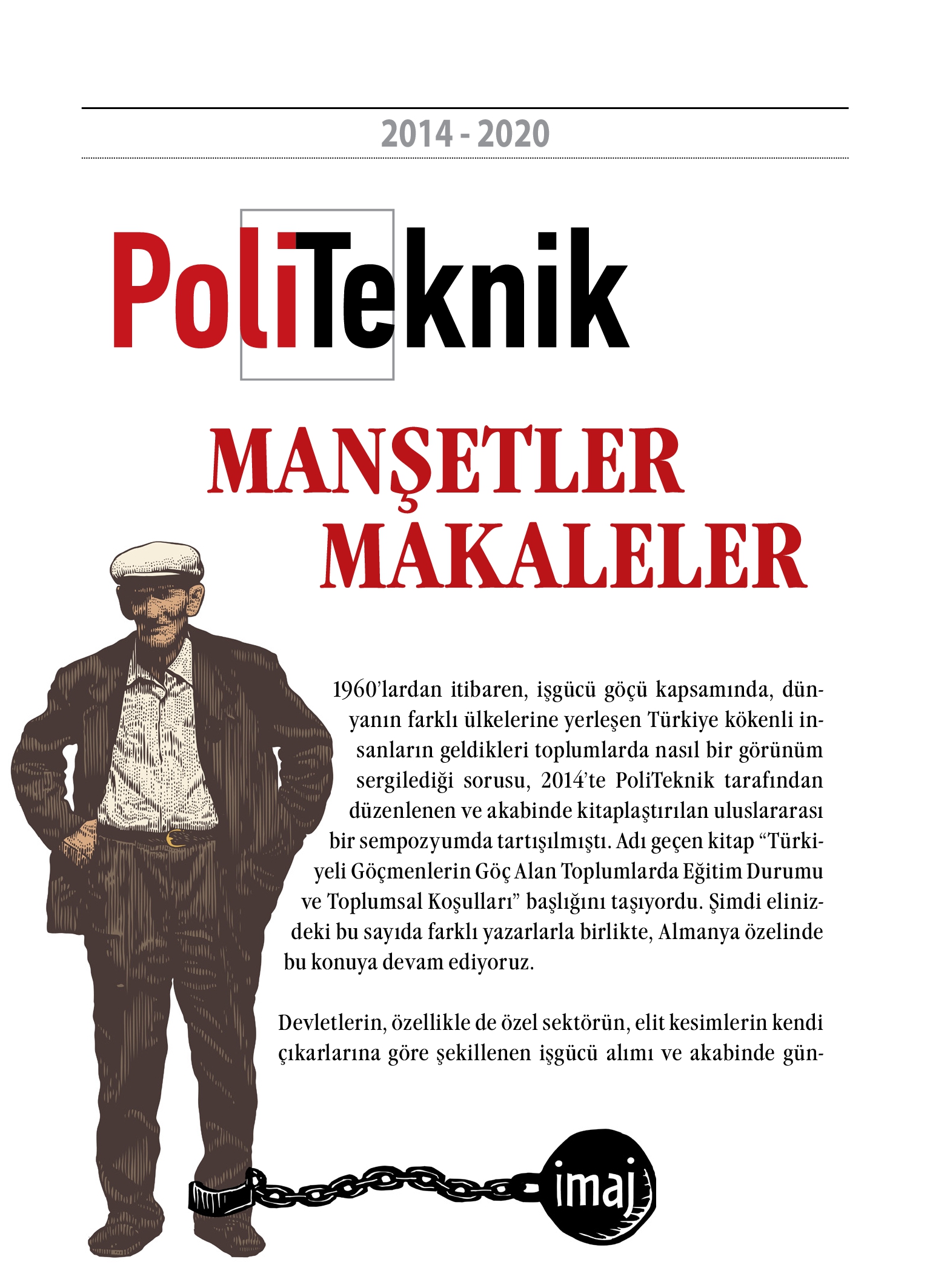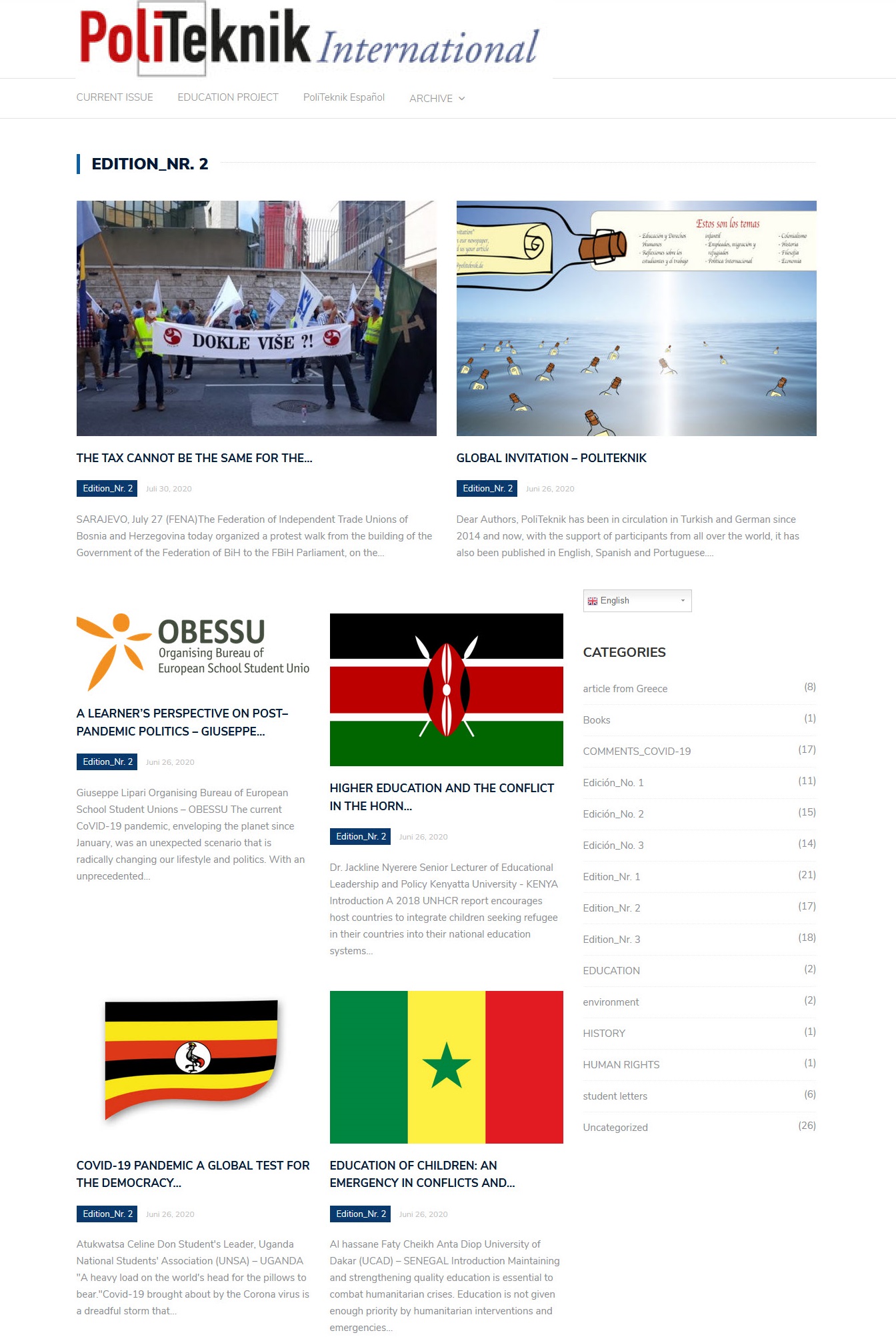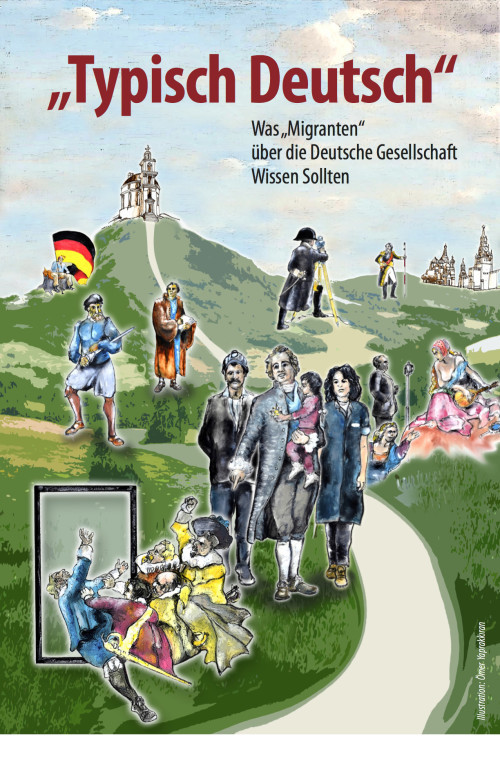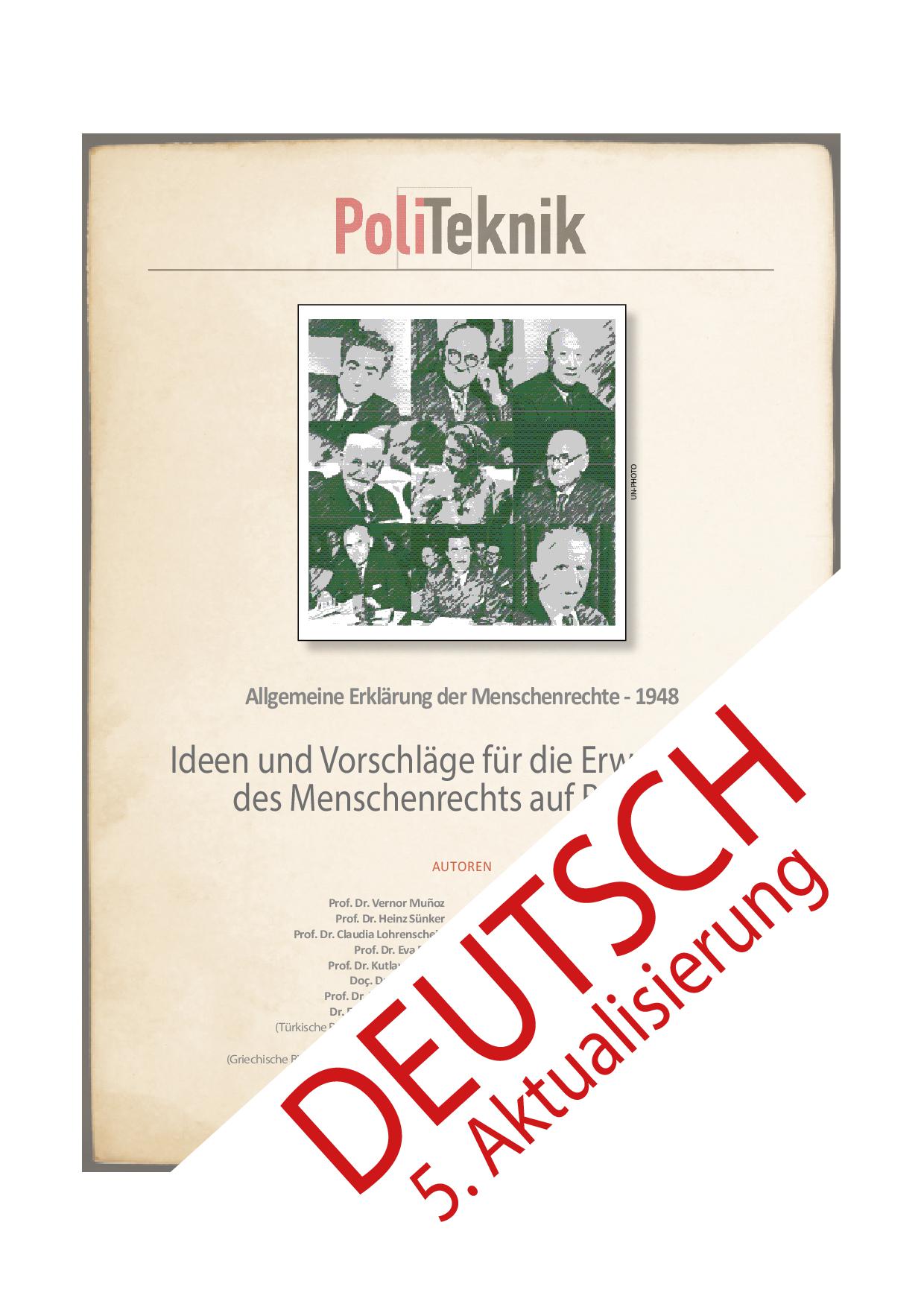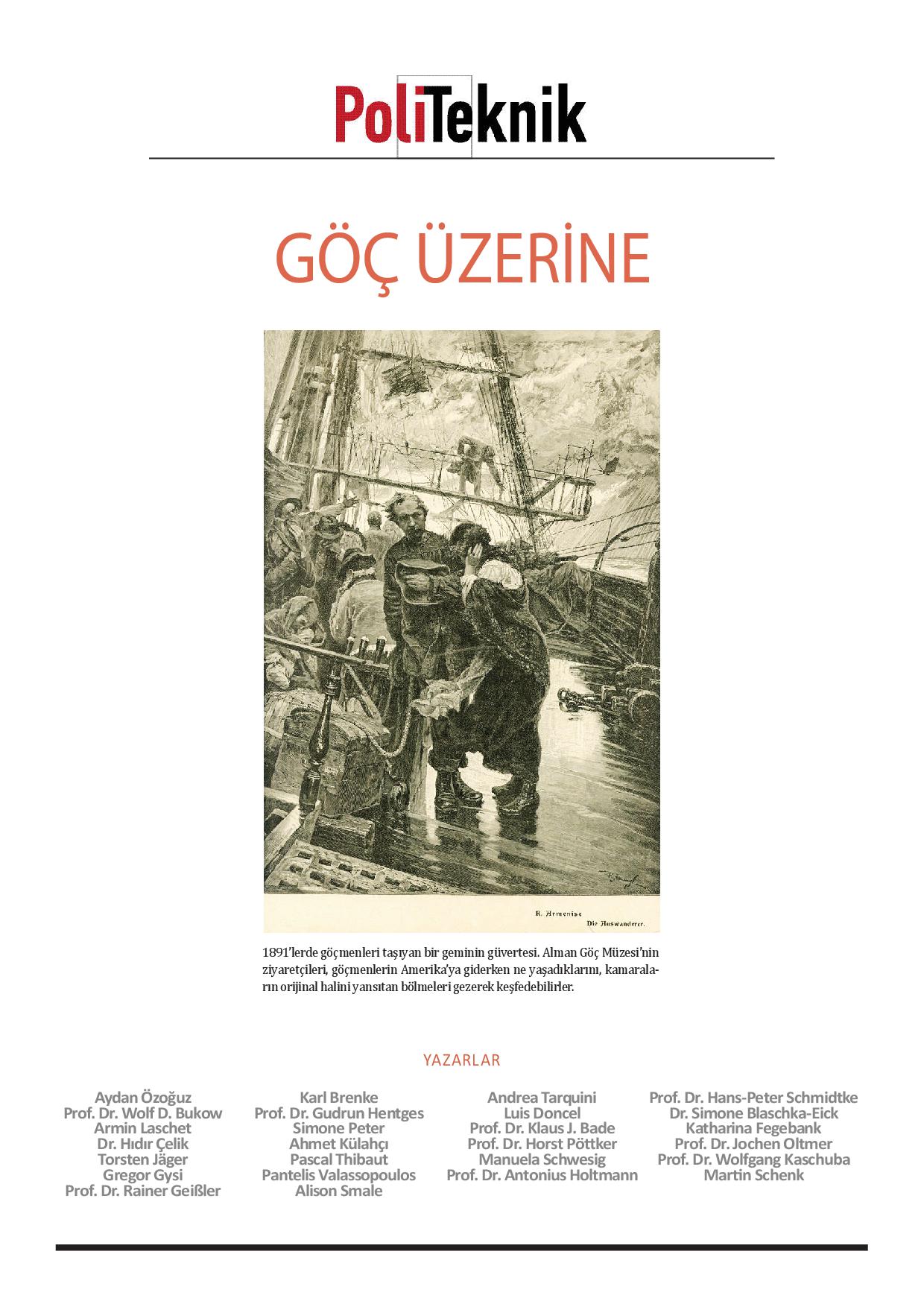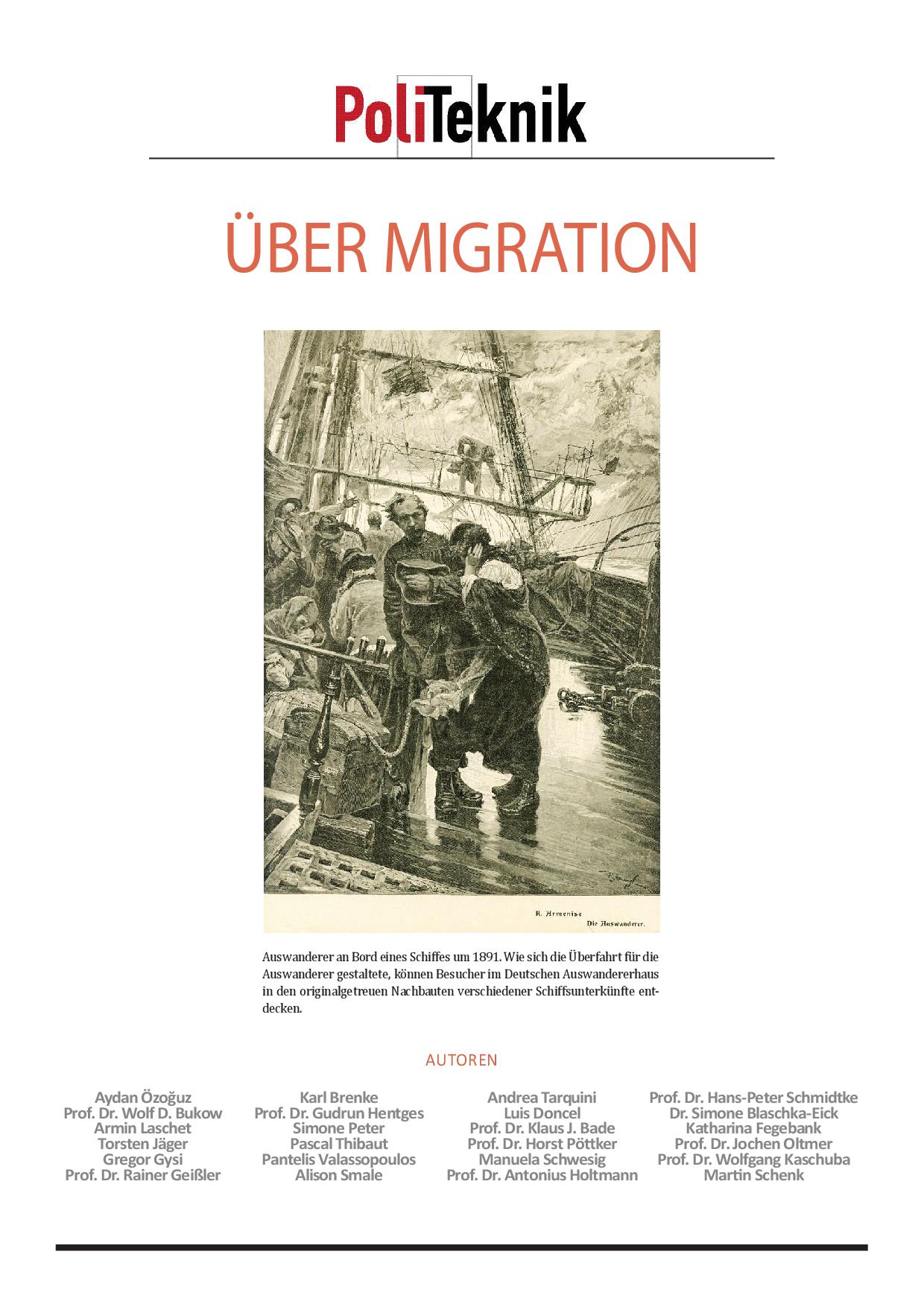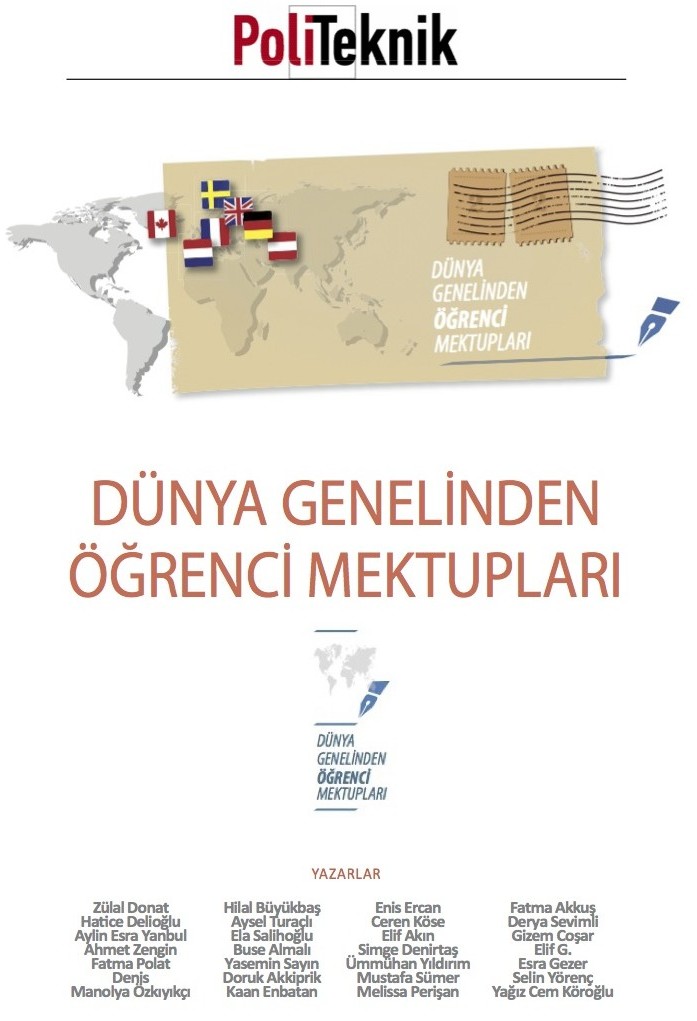Die Integrationsbeauftragte und Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, zuständig für den Bereich Antirassismus in der Bundesregierung, hat einen Expert*innen-Rat mit einer Arbeitsdefinition von Rassismus beauftragt und diese nun im März 2025 veröffentlicht.
“Arbeitsdefinition Rassismus”
Rassismus basiert auf einer historisch gewachsenen Einteilung und Kategorisierung vonMenschen anhand bestimmter äußerlicher Merkmale oder aufgrund einer tatsächlichen odervermeintlichen Kultur, Abstammung, ethnischen oder nationalen Herkunft oder Religion (Essentialisierung und Naturalisierung). Bestimmte Merkmale werden diesen Gruppen zugeschrieben (Homogenisierung), die sie und die ihnen zugeordneten Personen als höher- oder minderwertig charakterisieren (Hierarchisierung). Die als minderwertig kategorisierten Gruppen werden herabgewürdigt und auf der Grundlage von negativen Stereotypen undVorurteilen abgewertet. Die Zuordnung von Menschen zu einer bestimmten Gruppe führt zueiner gesellschaftlichen Wahrnehmung von ihnen als „zugehörig“ bzw. „fremd“ oder „nichtzugehörig“ zu Deutschland, was wiederum zu ausgrenzenden Praktiken und Erfahrungen führt (Dichotomisierung).
Rassismus tritt auf unterschiedlichen, häufig zusammenwirkenden Ebenen auf und trägt dazu bei, dass bestimmte Gruppen und ihnen zugerechnete Personen beim Zugang zu und der Teilhabe an materiellen oder immateriellen Ressourcen benachteiligt oder ausgeschlossen werden:
• Rassismus entsteht aus bewussten und unbewussten Einstellungen und Überzeugungen. Er drückt sich aus in Äußerungen und Handlungen sowie im Verhalten einzelner oder in Gruppen handelnder Personen (individueller Rassismus).
• Rassismus ist in staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen zu finden: in der Sprache, in verbreiteten stereotypisierenden Annahmen, in der ungleichen Verteilung von Ressourcen und Privilegien sowie in der damit verbundenen systematischen Diskriminierung und Ausgrenzung bestimmter Gruppen und Personen (struktureller Rassismus).
• Rassismus kann sowohl durch rechtliche Vorgaben in staatlichen wie nichtstaatlichen Institutionen als auch durch organisatorische Strukturen begünstigt werden. Rassistische Diskriminierung entsteht häufig unbeabsichtigt durch alltägliche Routinen und Handlungslogiken (z. B. wahrgenommene ‚Sachzwänge‘), die als Teil der Kultur einer Organisation etabliert sind und nicht hinterfragt und reflektiert werden. Auch Normen und Vorschriften, Organisationsstrukturen und Verfahren, Praktiken und Handlungsroutinen können Menschen rassistisch benachteiligen und ausschließen (institutioneller Rassismus). Individueller, struktureller und institutioneller Rassismus bezeichnen verschiedene, sich aber gegenseitig bedingende und verstärkende Erscheinungsformen von Rassismus.” (Integrationsbeauftragte der Bundesregierung 2025: https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1864320/2337298/867de6459981a576f7887dec3363ecb2/broschuere-rassismusdefinition-data.pdf?download=1).
Sinnvolles und Veränderungsbedarfe
Sinnvoll ist neben vielen anderen Aspekten bei der Definition von Rassismus (vgl.Rommelspacher, Birgit (20211: Was ist eigentlich Rassismus? In Melter/Mecheril (Hrsg.Rassismuskritik Band I: http://www.agpolpsy.de/wp-content/uploads/2017/11/Rommelspacher-Was-ist-Rassismus.pdf ) die Konstruktion ethnischer, kultureller und religiöser Gruppen, die bevorzugt oder benachteiligt werden. Ebenso überzeugend ist die Betonung, dass Rassismus beabsichtigt und unbeabsichtigt ausgeübt werden kann und in allen Teilen der Gesellschaft, also auch in Institutionen, ausgeübt wird.
Dringend zu ergänzen ist jedoch erstens, dass die ausdrückliche oder indirekte Konstruktion von “Rassen”, deren Existenz bei Menschen wissenschaftlich widerlegt ist, zwingend Teil einer Rassismus-Definition sein muss. Rassialiserende Zuschreibungen und Racial Profiling sind sonst analytisch ebenso wenig zu erfassen wie Kontinent-bezogene Einteilungen in Vergangenheit und Gegenwart als Teil des Anti-Schwarzen-Rassismus, des Anti-Asiatischen Rassismus und des Antislawismus.
Zweitens sind bei den Ebenen von Rassismus neben der strukturellen, institutionellen und Individuuellen (interaktiven) Ebene auch die diskursive Ebene (was öffentlich/ medial geschrieben und gesagt wird) sowie die personale Ebene (kognitiv, psychisch, körperliche Ebene, wo Ideen rassistischer Überlegenheit, Unterlegenheit oder Widerstandshaltungen angeeignet werden; vgl. DeZIM 2022 https://www.rassismusmonitor.de/publikationen/rassismus-und-seine-symptome/ ) zu ergänzen, da sich die genannten Ebenen wechselseitig beeinflussen und auch für Bildungsarbeit, Medienarbeit und pädagogische/psychologische Beratung sehr bedeutsam sind. So ist die neue Rassismus-Definition ein wichtiger Schritt in der Diskussion über Rassismus in Deutschland. (DeZIM 2025: https://www.rassismusmonitor.de/fileadmin/user_upload/NaDiRa/Publikationen/Verborgene_Muster_Monitoringbericht/NaDiRa_Monitoringbericht_2025_FINAL__1_.pdf ) Die Arbeitsdefinition ist ein Weg, der in vielen weiteren Diskussionen, verbindlichen Aktionsplänen und Handlungen fortgesetzt werden muss.
Claus Melter 2025