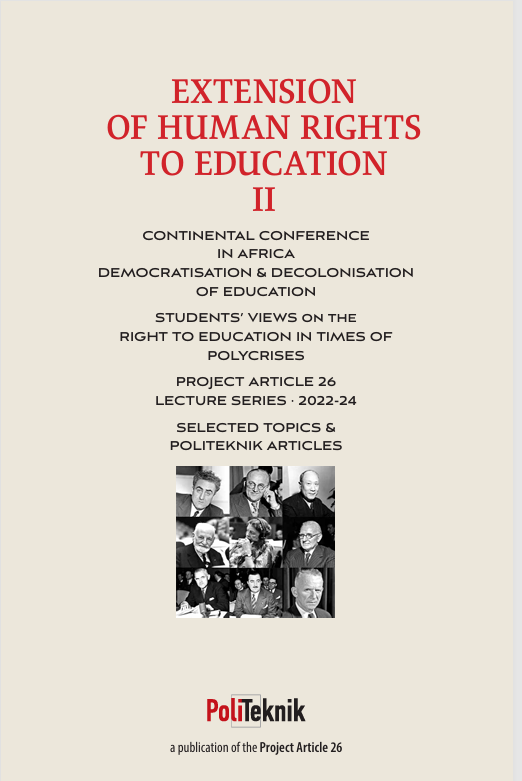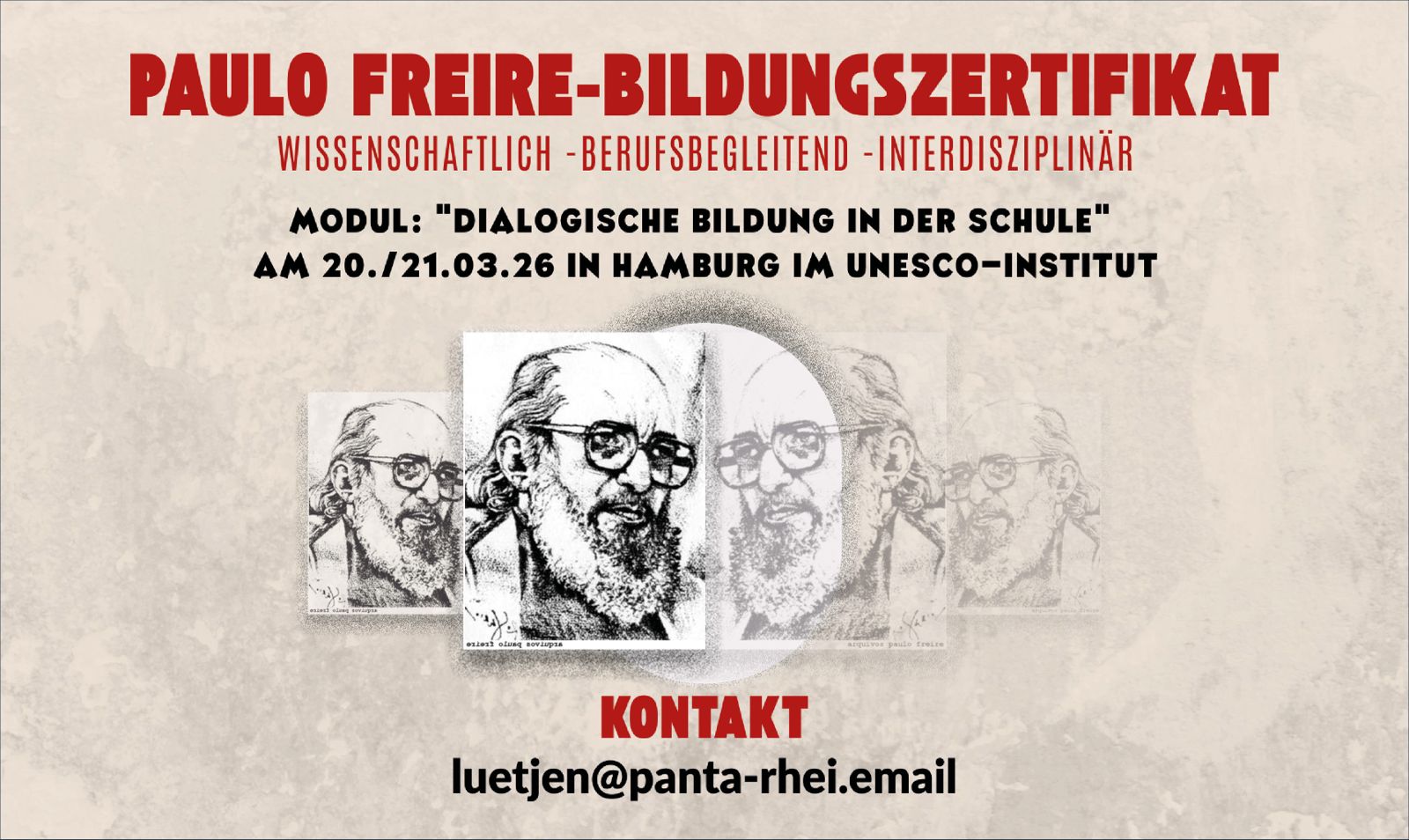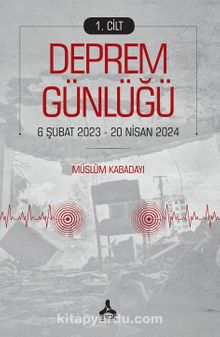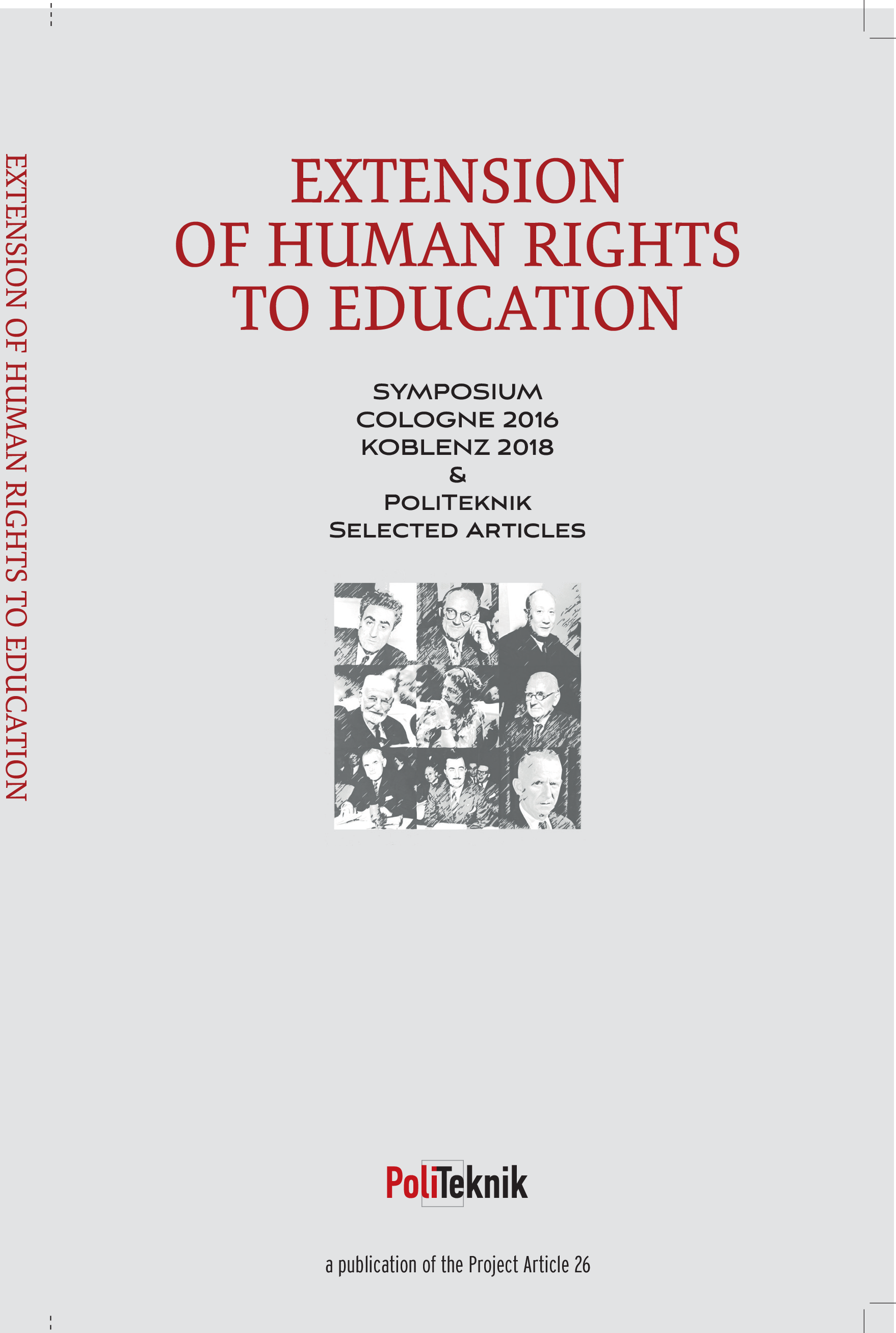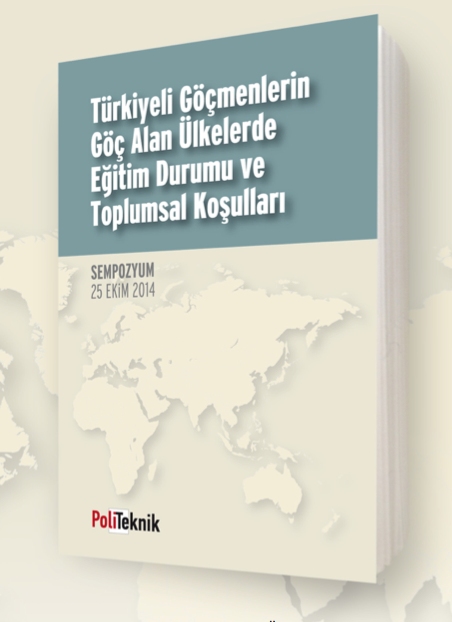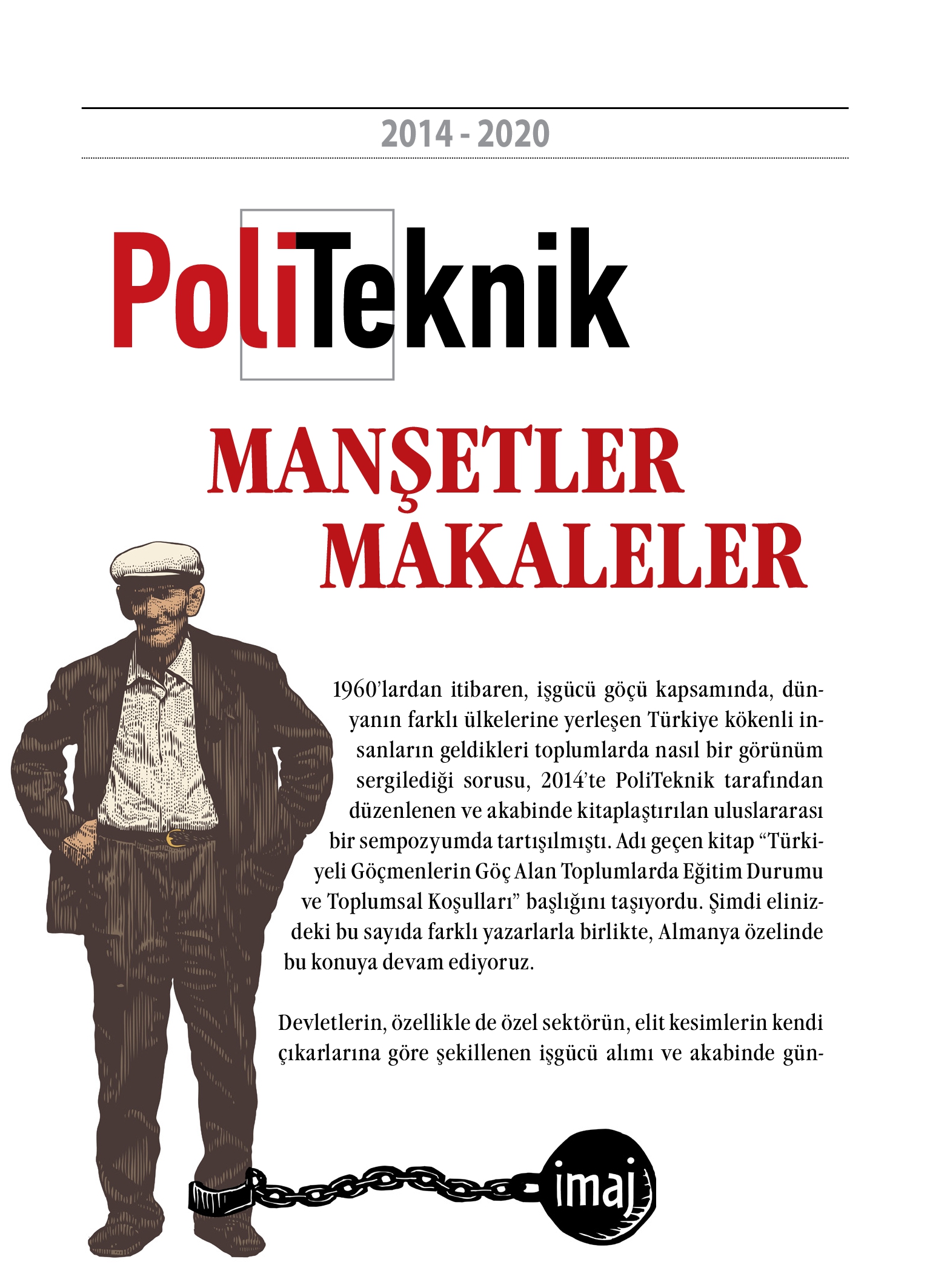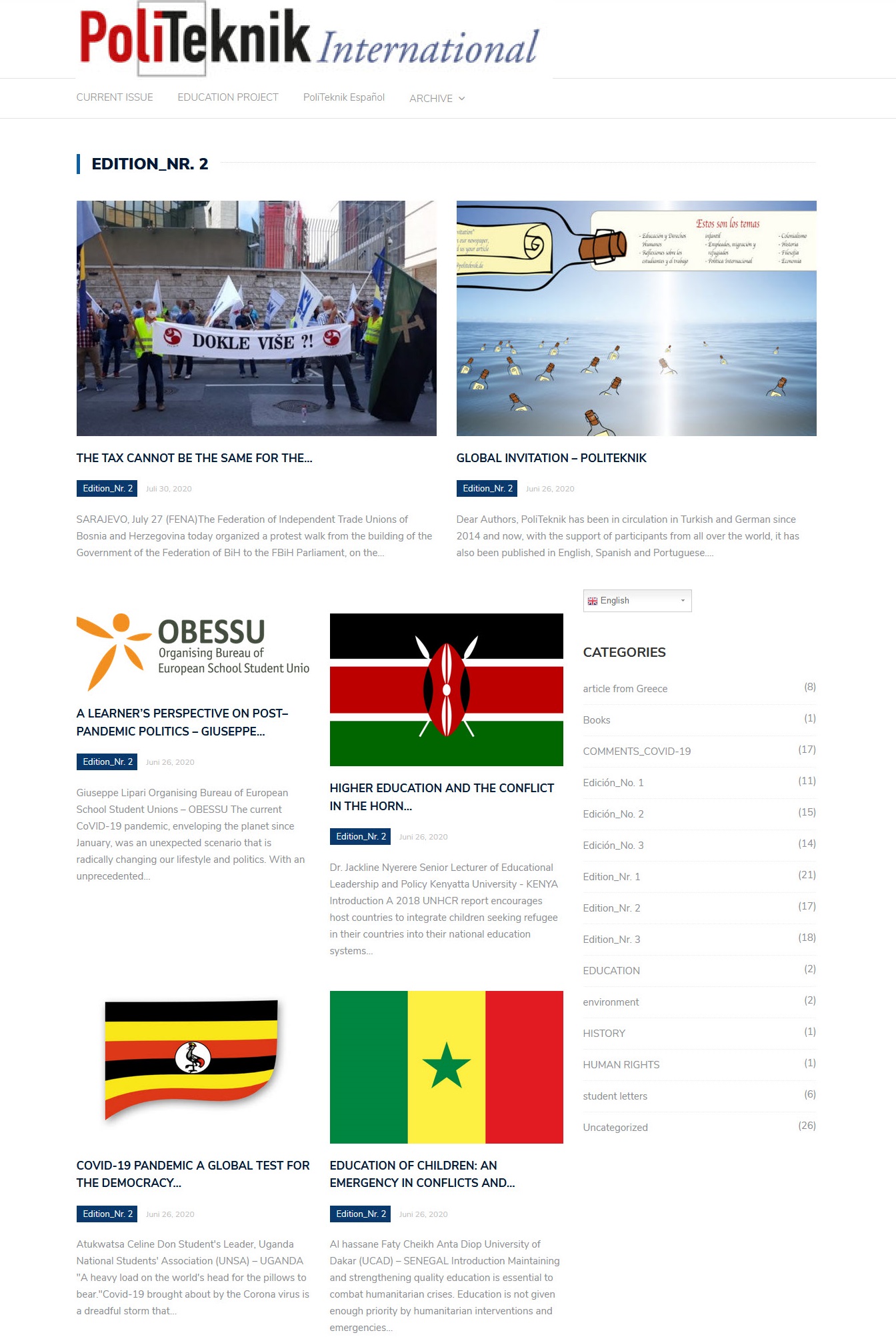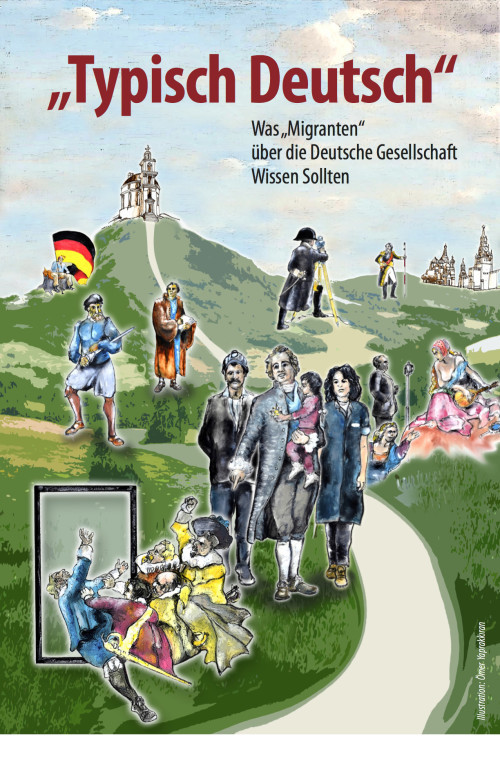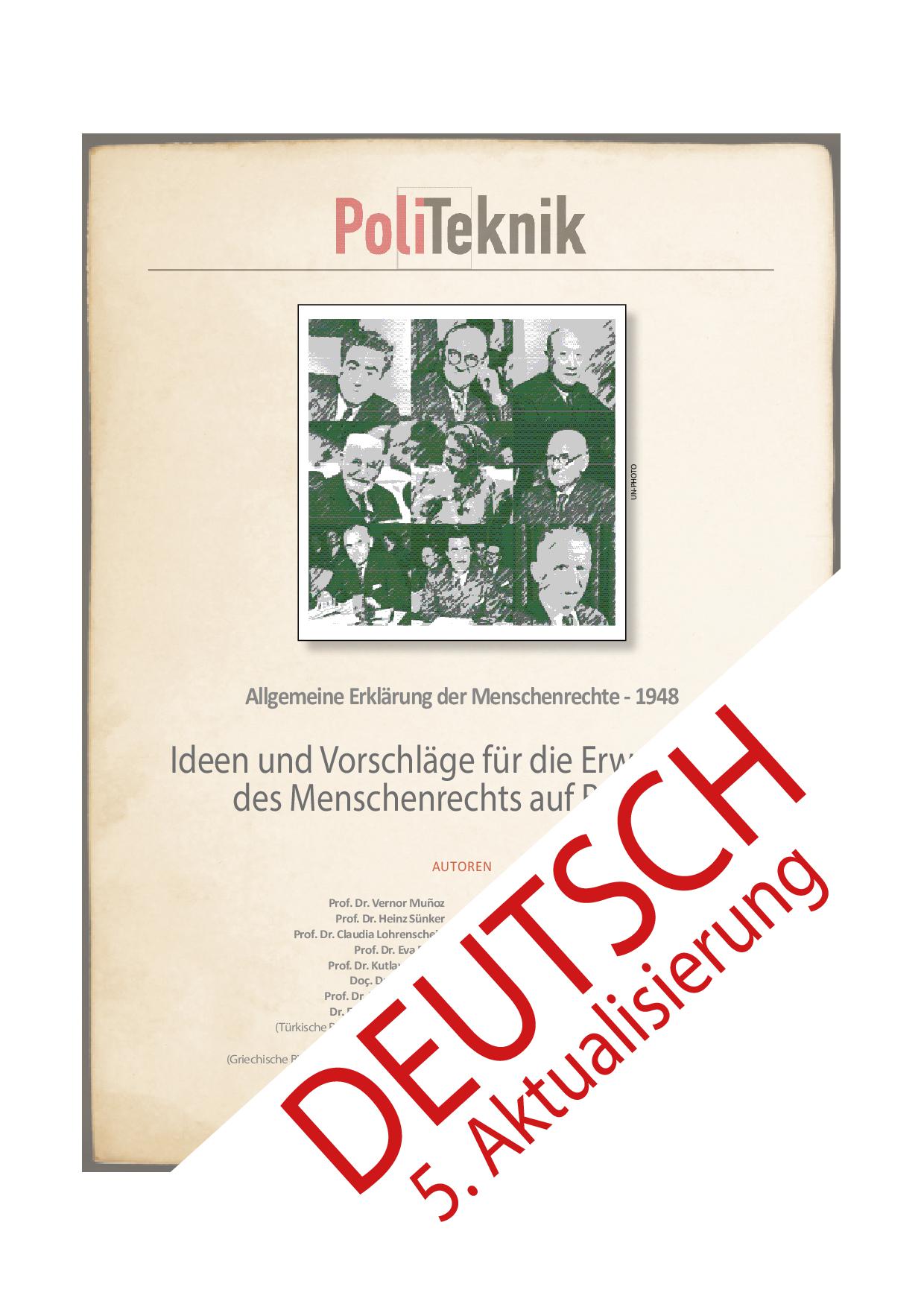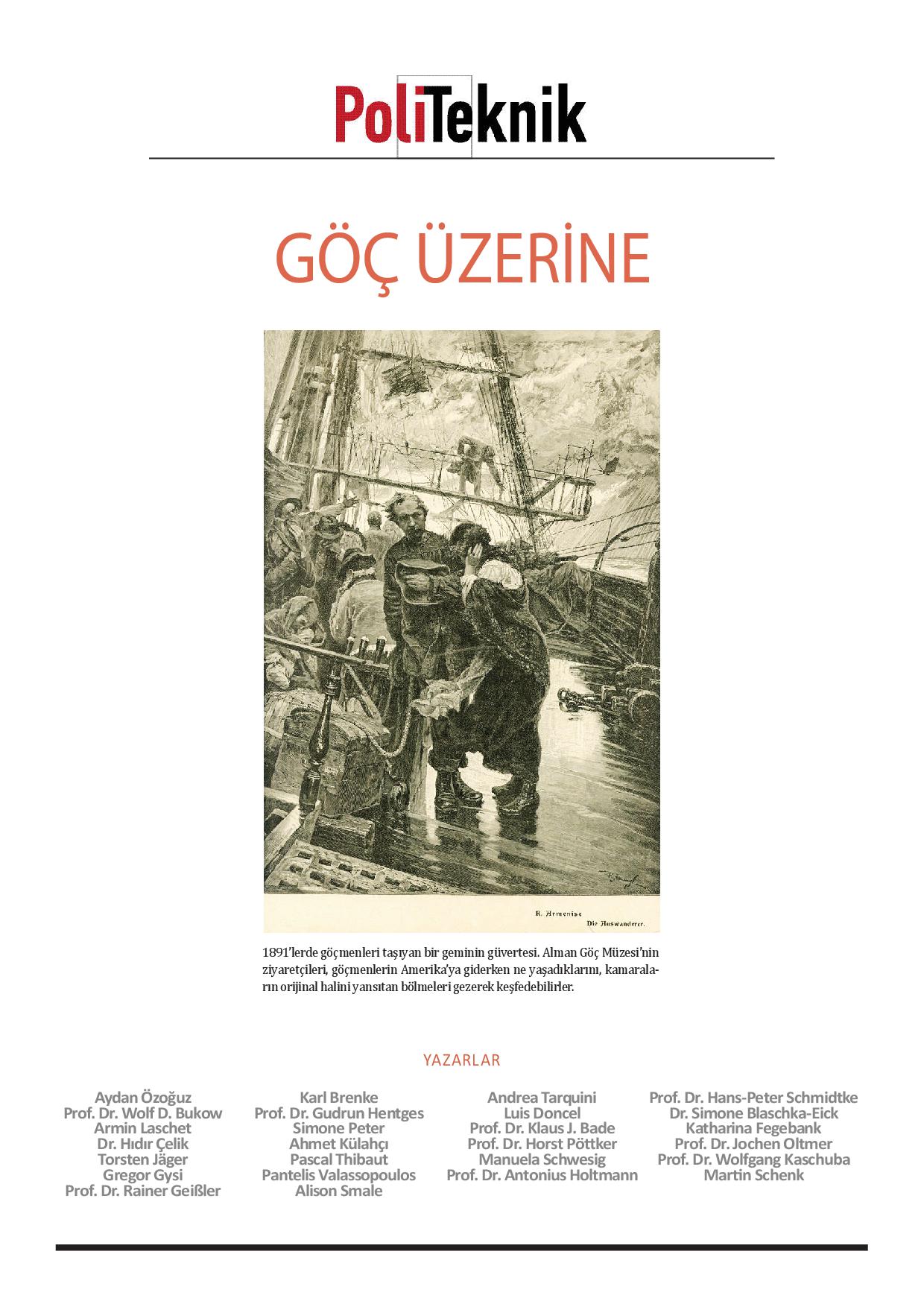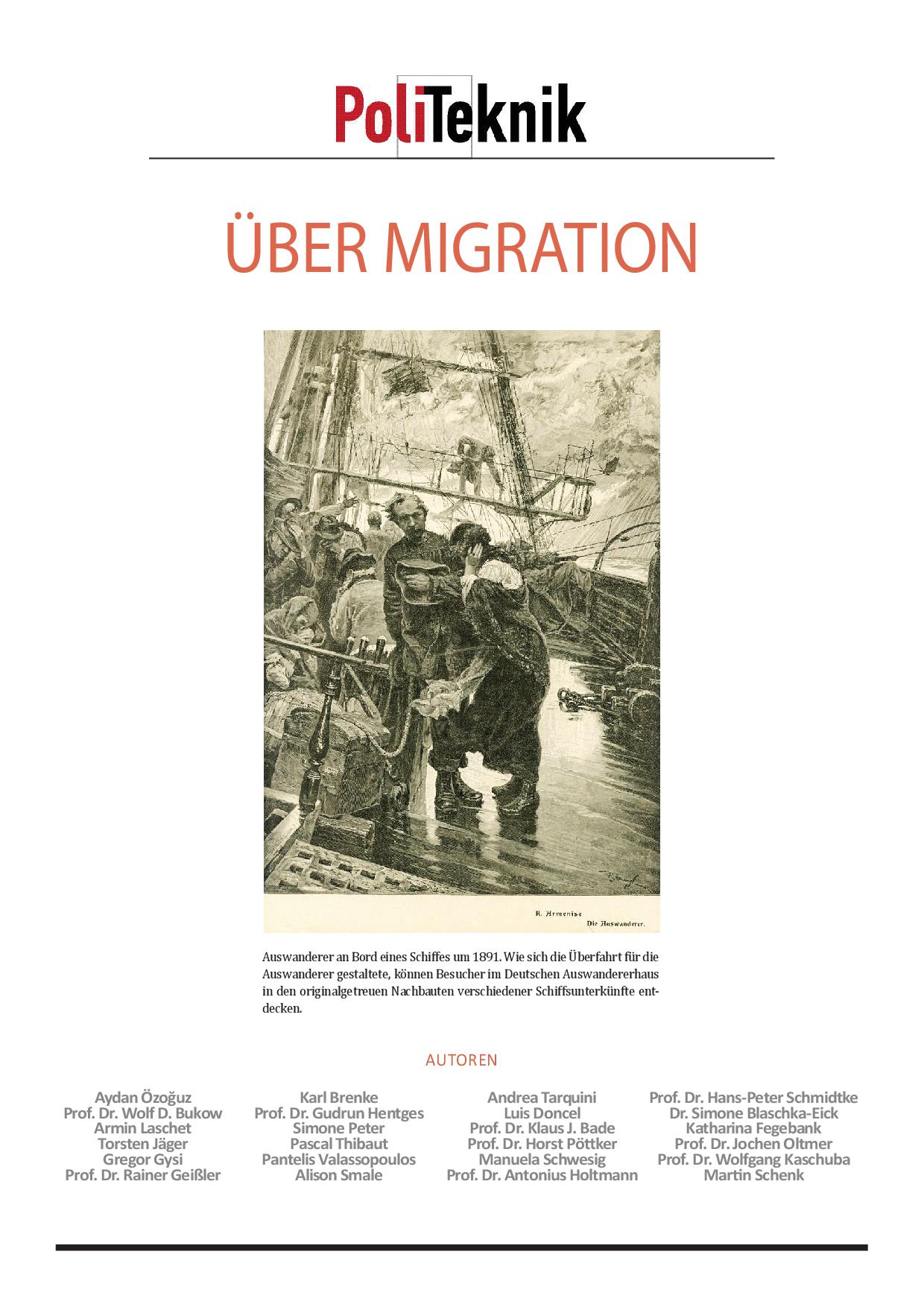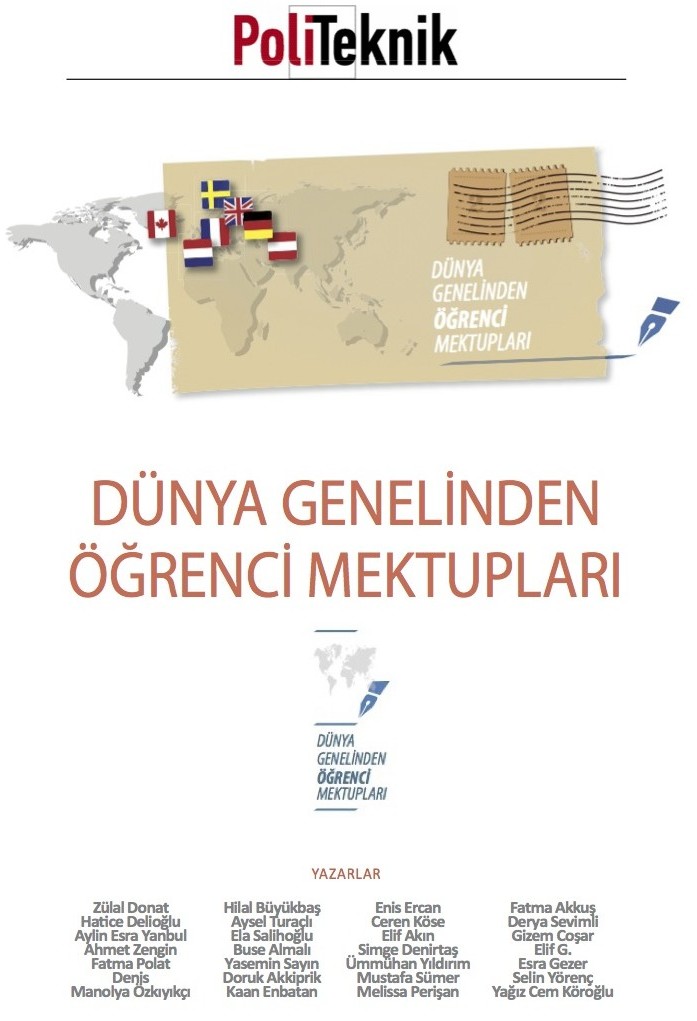Die Entscheidung
Am 23.7.2025 hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der Beschaffungen für die Bundeswehr schneller ermöglichen und vereinfachen soll. Das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz(!) (Fassung von 2022) wird fortgeschrieben. Der Prozess der Dynamisierung des Rüstungssektors wird um eine Stufe höher gehoben. Doch nicht nur die Beschleunigung der Beschaffung ist ein Ziel des Gesetzes, sondern auch die weitere Stärkung der eigenen Rüstungsindustrie. Diesem zweiten Ziel dienen die Maßnahmen, dass schon auf dem Markt vorhandene Lösungen berücksichtigt werden sollen und gleichzeitig die „technologische Souveränität“ durch innovative Beschaffung gefördert wird. „Lösungen“, die die Rüstungsindustrie schon entwickelt und auf dem Markt anbietet, können bei der Beschaffungsentscheidung, anders als bei üblichen Verfahren, berücksichtigt werden. Auch können Aufträge dann bereits erteilt werden, wenn eine Lösung erst durch technologisch Innovation seitens der Industrie erwartbar ist.
Das Gesetz zielt darüber hinaus explizit auf „einen engen Schulterschluss mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“ und erweitert legal deren Macht. Sie kann nämlich im Vertrauen auf die Abhängigkeit der Regierung von den vorgenommenen Wettbewerbsbeschränkungen relativ risikofrei Rüstungsgüter entwickeln und auf den Markt bringen. Da gleichzeitig aber auch finanzielle Leistungen der Regierung für technologisch zukünftige Problemlösungen bereitgestellt werden, ist auch die Entwicklungsforschung der Rüstungsindustrie vollständig gesichert. Da diese am besten über den jeweils aktuellsten technologischen Forschungsstand informiert ist, steigert sie ihren Vorsprung gegenüber der politischen und der administrativen Ebene. Das Gesetz stellt selbst in Rechnung, dass durch die genannten Mechanismen Preiserhöhungen zu erwarten sind: „Auswirkungen auf Einzelpreise in einzelnen Branchen sind etwa durch beschleunigte Nachfrage und mehr Verhandlungsspielraum [der Rüstungsindustrie] möglich.“
Der Ausschluss von Konkurrentenklagen soll die schnellere Durchsetzung von Vergabeentscheidungen absichern. Was unter den Vorzeichen von „unbürokratischem Handeln“ und der „Befreiung von bürokratischen Zwängen und Belastungen“ – ein dominantes Thema der Wirtschaft – als sachlogische Konsequenz aussieht, stärkt vor allem die Macht von Auftraggeber und Auftragnehmer. Die Bundeswehr und der militärische Produktionssektor bilden eine Liaison, die sie immer mit dem Hinweis auf die Bedrohung oder Handlungsweisen des „Feindes“ abschirmen können. Da Behauptungen über Aktivitäten des „Feindes“ in der Regel nur von militärischen oder geheimdienstlichen Organisationen aufgestellt und kaum von außen widerlegt werden können, wird die Liaison sehr mächtig. Der Wissensstand zur Waffentechnologie wird darüber hinaus auf der Seite des Militärisch-Industriellen Sektors strukturell erweitert und abgesichert. Dies liegt auch an der „barocken Komplexität von Waffensystemen“ (Michael Brzoska), die nur als Bündelung ganz unterschiedlicher Technologien entwickelt werden können.
Während die Rüstungsindustrie also einen erhöhten planerischen und finanziellen Spielraum erhält, sieht die Kostenprognose im Zusammenhang mit dem Klimaschutz wesentlich „günstiger“ aus: „Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen ist nicht anzuwenden.“ Während im Personalbereich die Regierung aufgrund der beschleunigten Beschaffungsverfahren nur mit einer schmalen, sehr theoretischen Einsparung rechnet, sind die Einsparungen aufgrund der Regelung, dass Umweltschäden keine Rolle spielen, erheblich umfangreicher. Die Vorbereitung des Krieges, der die höchsten Umweltschäden in jeder Hinsicht erzeugt, wird durch Einsparungen beim Klimaschutz verbilligt.
Der Gesetzentwurf beruft sich im ersten Satz auf einen scheinbar felsenfesten Fakt: „Russland ist eine Bedrohung für den euro-atlantischen Raum“. Die Gesetzesänderung im Jahr 2025 wird also begründet mit der Behauptung einer „dramatisch veränderten sicherheitspolitischen Situation“. Die Verbindung von scheinbarer Tatsache und emotionaler Steigerung durch Behauptung einer „Dramatisierung“ soll die Einsicht in die Notwendigkeit des politisch Gesetzten wecken und stärken. Seit Beginn des Kriegs Russlands gegen die Ukraine werden diese Behauptungen ständig wiederholt. Das Mantra wirkt – auch wenn es keine Beweise für diese folgenreiche Behauptung gibt. Vor allem werden die Gründe für diesen Krieg zwischen 1990 und 2022 vollständig ausgeblendet.
Zugleich wird eine technologische „Spitzenstellung“ Deutschlands anvisiert, die es „schneller“ zu erreichen gelte. Die angebliche Evidenz der Begründung und die Konstruktion einer Notsituation lässt die Regierung als eine getriebene Institution erscheinen, die ihrem Gegenüber bei der Beschaffung von Waffen alle Freiheit einräumen müsse. Der Verteidigungsminister hat deshalb am Tag der Entscheidung über den Gesetzentwurf die Rüstungsindustrie „zu einem Round Table ins Verteidigungsministerium eingeladen“. Sie hat wohl den Minister über den Stand der Innovation und Verfügbarkeit der marktvorhandenen „Lösungen“ informiert.
Die Kontinuität der Eskalation
Mit dem Gesetzentwurf der Regierung wird freilich keine ganz neue Praxis eingeleitet, vielmehr werden schon geübte Praktiken intensiviert und beschleunigt. So hat beispielsweise ein „Rahmenvertrag“ der Bundeswehr mit Rheinmetall im Umfang von 260 Millionen zur Ausstattung von Militärtransportrouten einen pauschalen Auftrag erteilt, der erst später abgerechnet werden muss. Auch in Fragen der nicht-militärischen Infrastruktur für eine reibungslose Kriegsführung hat der Sektor also relative Handlungsfreiheit.
Im Juni 2022 änderten Bundestag und Bundesrat Art. 87a des Grundgesetzes und schufen mit dem Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ einen schuldenfinanzierten Schattenhaushalt, der von der Kreditobergrenze der Schuldenbremse ausgenommen ist. Mit dem 100 Milliarden Euro schweren Sonderprogramm zur Ausrüstung einer „einsatzfähigen Bundeswehr“ ist der Rahmen für Militärausgaben nahezu grenzenlos geworden. Das Sondervermögen ergänzt den Verteidigungsetat des Bundeshaushalts, der im Jahr 2023 auf den Rekordwert von über 50 Milliarden Euro gestiegen ist. Die Hälfte des Sonderprogramms geht allein an einen Auftragnehmer, nämlich die Rheinmetall – nach Recherchen des „Doku-Formats Spur“ des ZDF.
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigt der Verteidigungsetat für das Jahr 2025 auf rund 62,43 Mrd. Euro. Insgesamt stehen der Bundeswehr, zusammen mit 24 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen, für das Jahr 2025 86 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Eckwerte im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für die kommenden Jahre sehen vor, dass der Einzelplan in 2026 auf ca. 83 Mrd., in 2027 auf 93 Mrd., in 2028 auf 136,48 Mrd. und in 2029 auf 152,83 Mrd. steigen wird.
Der Gesamtrahmen wurde schließlich durch den Beschluss des Deutschen Bundestags im März 2025 über ein für die Bundeswehr unbegrenztes Sondervermögen und ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Infrastruktur gänzlich geöffnet. Gegen alle bisher in der Bundesrepublik geltenden Grundsätze wird ein Ausgabenbereich nicht mehr begrenzt und eröffnet dadurch, im Rahmen weiterer Haushaltsbeschlüsse, grenzenloses Wachstum. Dieses Wachstum wird auch von der inneren Dynamik der Waffenentwicklung her nicht zu begrenzen sein. Denn der technische Wandel hat eine solche Geschwindigkeit erreicht, dass jede Neuentwicklung nach kurzer Zeit veraltet ist. Denn durch die Entwicklung der „Gegenmittel“ durch den „Feind“ werden alle „Neuigkeiten“ schnell überholt. Aber auch die Behauptung, aus der eigenen Technologiedynamik heraus ein absolut taugliches Waffensystem entwickelt zu haben oder entwickeln zu können, das die gerade fertigen Produkte ablösen sollte, kann kaum zurückgewiesen werden.
Die publizistische Begleitmusik
Die Gesetzesinitiative der Bundesregierung vom 23.7.25 ist kein isolierter Vorgang, sondern selbstverständlich eingebunden in einen längeren Prozess und eine gleichsinnige Transformation des staatlichen Apparats. Die dabei vorgenommenen Gesetzesänderungen sind erheblich und perfektionieren und militär-logische Umstrukturierung dieser Handlungsbereiche. Allerdings bleibt die Dynamik nicht auf den staatlichen Bereich beschränkt.
Die Medien beeilen sich zum überwiegenden Teil, insbesondere die Medien mit großer Verbreitung und ökonomischer Macht, die staatlichen Aktivitäten zu unterstützen und, vor allem, gegen Kritik zu immunisieren. So haben sich Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR zu einem Rechercheverbund zusammengeschlossen und geben der Regierung militärstrategische „Schützenhilfe“(!). In einem Bericht in der SZ vom 25.7.20025, S.5, berichten sie unter der alarmierenden Überschrift „Bundeswehr gibt riskante Informationen preis. In öffentlichen Ausschreibungen im Internet tauchen Angaben zur Bundeswehr auf, über die sich Russlands Geheimdienste freuen dürften. Experten sehen die Sicherheit Deutschlands und der Nato gefährdet“ über eigene Aktivitäten zur Absicherung der Aufrüstung.
Die drei Medien berichten von einer Recherche, in deren Verlauf sie „Hunderte öffentlicher Ausschreibungen“ der Bundeswehr untersucht haben. Dabei haben sie geprüft, welche Informationen in den Ausschreibungen riskante Informationen für die russischen und anderen Geheimdienste enthalten seien. Das Vorgehen ist überraschend, weil „Geheim“dienste sich üblicherweise nicht dadurch auszeichnen, dass sie öffentliche Ausschreibungen als relevante Nachrichtengrundlage lesen. Den deutschen Geheimdiensten war dies lange Zeit vorgeworfen worden, und die parlamentarische Kontrolle hatte die Haushaltsausgaben in Frage gestellt. So sind vor allem die Feststellungen des Verfassungsschutzes über die Gefährlichkeit und Verfassungsfeindlichkeit von Organisationen und Parteien auf der Grundlage von Medienberichten erstellt worden. Wenn aber nur öffentlich zugängliche Organisationen oder Medien ein solche Feststellung träfen, dann würde einem solchen Bericht die Bedrohlichkeit und die Gefährlichkeit fehlen. Da musste schon der Verfassungsschutz her.
Von den Hunderten von Ausschreibungen sind nach Intervention der Rechercheure auch nur zwei Ausschreibungen von der Bundeswehr zurückgezogen worden. Deshalb wird der Bericht der SZ auch mit den notwendigen Elementen befeuert, die Angst und Schrecken hervorrufen. So ist nicht nur von „Spionage“ (in Bezug auf öffentliche Ausschreibungen!) die Rede, sondern auch von „hybriden Maßnahmen“ (die allein mit dem Begriff „hybrid“ ihre Gefährlichkeit erhalten), von „tückischen Cyberangriffen“ (da graust es den Leser und die Leserin) oder von Fragen militärischer Sicherheit in einem „noch nicht beschriebenen hybriden Format“. Es reicht also nicht, etwas Reales zu beschreiben, es müssen auch ausgedachte Möglichkeiten der Bedrohung herhalten.
Solche Behauptungen werden den in der Überschrift angekündigten „Experten“ in den Mund gelegt, als da sind: die Präsidentin des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst, der Verteidigungsexperte der CDU und der Vorsitzende der Politisch-Militärischen Gesellschaft. Die mit dem Begriff „Experte“ üblicherweise verbundene Vorstellung von einer sachkundigen Expertise wird hier unterlaufen mit Personen, die eine politisch legitimierende Aufgabe gegenüber der Regierung haben. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) verteidigt dagegen die Ausschreibungen, denn „sicherheitsrelevante Aspekte“ würden bei Ausschreibungen berücksichtigt. Sie erscheint als Repräsentantin einer Bürokratie, die die ungehemmte Aufrüstung eher behindert als fördert. Und die implizite Ironie des Berichts, dass Behinderung von der Bundeswehr selbst komme, erledigt deren Argumentation.
Die Aufgabe der Medien zur Kontrolle und „kritischen“ Beobachtung der Regierungen wird in Recherche und Publikation hier so verstanden, dass die Absicherung der Aufrüstungspolitik und Beschaffung der Kriegstüchtigkeit die Medien selbst als ihre eigene Mission definier. Sie treiben die Kriegsvorbereitung voran und legitimieren sie in der Gesellschaft.
Dazu reicht ein strategisch aufbereiteter Bericht nicht aus. Es muss ein Kommentar her, der die mediale Begleitmusik für die Aufrüstungsstrategie zusätzlich absichert. So wird in der gleichen Ausgabe der SZ auf S. 4 ein Kommentar unter dem Titel „Ausgemusterte Regelungen“ veröffentlicht. Der Kommentar vermeidet klug das übliche Lamentieren über die Bürokratie und schafft zwischen Bürokratiekritik und Bürokratienotwendigkeit einen Spielraum für eine „ab- und ausgewogene“ Argumentation. Beispiele für unendliche Beschaffungsaktivitäten, die auch durch internationale Zusammenarbeit gebremst wurden, plausibilisieren das Plädoyer für den „guten Anfang“ des Regierungsbeschlusses.
Gleichzeitig wird mit den „Standards aller Art“ aufgeräumt, wie Mindestlohn, Umweltstandards und Rechtssicherheit. Jetzt geht es um etwas Wichtigeres, denn „Wladimir Putins verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht die Sicherheit von ganz Europa“. Da muss Schluss sein mit der „Regelungsdichte“, die wie eine „überwucherte Hecke“ zu einer „verteidigungspolitischen Orientierungslosigkeit“ und „ruinierten Verteidigungsfähigkeit“ geführt habe. Der Verwirrung der Vergangenheit im Glauben an eine ideale Welt wird die Zukunft einer rationalen und entscheidungsmächtigen Nation gegenübergestellt. Dieses Licht der Zukunft ergibt sich als Gegenbild zu „Putins Neoimperialismus“ – der wie eine Apokalypse über Europa hereingestürzt zu sein scheint. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wird ins Feld geführt, ohne dass nur ein einziges Datum, geschweige denn eine einzige Aktion der NATO und des Westens oder eine diplomatische Initiative Russlands seit 1990 erwähnt wird. Selbstverständlich ist in dieser Propaganda auch das Protokoll der Verhandlung zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul kurz nach Kriegsbeginn aus dem Bewusstsein verschwunden.
Die Formierung der Gesellschaft
Die Diskussion über Ludwig Erhards Begriff „Formierte Gesellschaft“ Mitte der 1960er Jahre war kurz und heftig. Insbesondere Ralf Dahrendorf hat mit der Entgegensetzung von „formierter“ und „offener“ Gesellschaft einen Schlussstein gesetzt. Wenn der Begriff aber offener formuliert wird und eher „Formierungsprozesse“ in der Gesellschaft, oder besser in Teilbereichen der Gesellschaft, als der Zustand einer formierten Gesellschaft thematisiert wird, gewinnt er wieder analytische Schärfe. Da die totalitären und konfliktleugnenden Aspekte des Begriffs evident sind, werden in der politischen Programmatik, zu der der Begriff bei Ludwig Erhard gehörte, heute andere Kategorisierungen vorgenommen. So hat der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 23. Juli 2025 im Landtag von Baden-Württemberg seine Regierungserklärung mit „Verteidigung und Resilienz“ überschrieben.
Die Verwendung des Begriffs „Resilienz“ hat sich längst von der Beschreibung einer guten psychischen Verfassung von Personen abgelöst und wird ausufernd gebraucht. In der Rede von Kretschmann geht es um „eine große gemeinsame Kraftanstrengung, zu der jede und jeder einen Beitrag leisten muss“, und zwar zur Ausrichtung der ganzen Gesellschaft auf „Verteidigung“. „Dafür packen wir hier im Land tatkräftig an: im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, beim Thema Forschung und Entwicklung, bei Vernetzung und Zusammenarbeit und in der Frage der Widerstandsfähigkeit von Staat und Gesellschaft.“ Für die Zusammenarbeit von Hochschulen, Universitäten, Fraunhofer-Instituten, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der Wirtschaft wird ein „Innovationscampus Sicherheit und Verteidigung“ eingerichtet. Die Hochschulen werden in Beschlag genommen mit einem „Fortbildungsbooster Sicherheit und Verteidigung“.
Besonders aber die Schulen sollen sich an Verteidigung ausrichten, damit die Schüler „Propaganda und Desinformation auf die Spur kommen“. Damit ist vor allem die „wichtige Informationsarbeit“ der Jungoffiziere in den Schulen gemeint. Das neu einzuführende Pflichtfach „Medienbildung und Informatik“ soll dazu dienen, das „Wertefundament unserer freien Gesellschaft“ zu festigen und Falschinformationen und Fake News, „die feindlich gesonnene Staaten im Netz platzieren,“ erkennen zu helfen.
Der Horizont dieser Mobilmachung wird nicht mehr nur an einem „äußeren Feind“ festgemacht, sondern an den gefährlichen und heimlichen, schwer erkennbaren Beeinflussungen und Infiltrationen des Alltags. Es geht um die hybriden Angriffe „Propaganda, Cyberangriffe, Sabotage und Desinformationskampagnen“, die den Alltag der Menschen verunsichern. Gegen die unerkannten Gefahren werden alle üblicherweise positiv etikettierten Eigenschaften wie beispielsweise Hilfsbereitschaft auf Verteidigung und Feindabwehr ausgerichtet. „Darüber hinaus ist es entscheidend, die gesamte Gesellschaft Schritt für Schritt darauf vorzubereiten, was bei diesen hybriden Angriffen passieren kann“. Es geht um Vorbereitung auf den „Ernstfall“. Gerade die „schützenden“ Institutionen wie die Katastrophenhilfe, die Krankenhilfe, THW, Feuerwehr und medizinische Versorgung werden „ab jetzt“ auf den militärischen Verteidigungsfall ausgerichtet. „Wo immer möglich, soll es einen Vorrang für Verteidigung geben.“
Was in einer demokratischen Gesellschaft als freiheitsverbürgend angesehen wird, ist in dieser wahnhaften Fokussierung auf den „Ernstfall“ aufgehoben, sowohl die Freiheit der Wissenschaft wie das freie Bewusstsein des Bürgers. Die Parole „Feind hört mit“ wird zur Verfolgungsvorstellung durch unerkannte Angriffe und Propaganda umformuliert. Der Umbau von einer zivilen zu einer dem Militärischen untergeordneten Gesellschaft wird hier konkret und maßlos formuliert; die Formierung schreitet voran.
Bewertende Zusammenfassung
Am 27. Februar 2022 verkündete Bundeskanzler Scholz im Bundestag die Zeitenwende. Sie war verbunden mit einem bis dahin unvorstellbaren Sündenbekenntnis eines großen Teils der politischen Elite – bis hin zum Bundespräsidenten, dass alles, was bis dahin in der Ost-West-Politik verantwortet wurde, falsch gewesen sei. Ein Bekenntnis in der katholischen Beichte kann nicht besser formuliert werden. Freilich ist das Bekenntnis auch damit verbunden, dass die faktische Fortsetzung des Kalten Kriegs gegen Russland und der Nato-fähige Ausbau der Ukraine als Subtext der öffentlichen Friedensrhetorik offenkundig wurde. Möglich ist eine solche Wende freilich nur mit einem erheblichen kollektiven psychischen Aufwand, dem eine aggressive Steigerung folgen muss, damit sich keine Zweifel breitmachen. Die Regierungserklärung vom 27. 2. 22 wird anschließend durch die Haushaltsbeschlüsse des Deutschen Bundestags kontinuierlich in finanzielle Höhen gesteigert, wie sie seit dem 2. Weltkrieg unvorstellbar gewesen sind.
Die Wende setzt gleichzeitig eine erhebliche Verdrängung einer politischen Wirklichkeit seit der deutschen Einigung 1990 voraus. Seit der Deutschen Einigung war gegenüber Russland versprochen worden, dass eine Ost-Ausdehnung der NATO nicht erfolgen werde. Alle russischen Präsidenten haben bis zum Dezember 2021 darum gebeten, diese zu verhindern, und haben die Sicherheitsbedürfnisse Russlands reklamiert. Ihre Berücksichtigung war sowohl im OSZE-Vertrag wie auch im Pariser Abkommen von 2000 zwischen Russland und der NATO zugesagt worden. Während der Verträge Minsk 1 und Minsk 2 hat dann Russland die Erfahrung gemacht, dass vertragswidrig die Ukraine rüstungsmäßig an die NATO angebunden wurde und der Osten der Ukraine beschossen wurde. Das öffentliche Bewusstsein braucht zur Absicherung seiner wahnhaften Steigerung eine Katharsis, die alle gegenläufigen Erfahrungen zwischen 1990 und 2022 tilgt. Weil sie aber nicht total vergessen sind, wird erhebliche Energie gegen alle aktiviert, die die Zeit vor dem Krieg 2022 in anderer Erinnerung habe. Dabei würde eine einzige kritische Nachfrage nach der Bedeutung von „hybrid“ das Gebäude zum Zusammenbruch bringen.
Nach dem Beginn des Kriegs Russlands gegen die Ukraine wurden alle Scheu- und Lügenklappen fallen gelassen und der Westen setzt seine Aufrüstung und Kriegsvorbereitung ungehemmt fort. 2025 stellt der stellvertretende Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr General André Bodemann fest: „Wir befinden uns nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Sondern in irgendeiner Phase dazwischen, weil wir diese hybriden Bedrohungen haben.“ (SZ 29.8.2025, S.5) Die Handlungsermächtigung des Militärisch-Industriellen Sektors, die Radikalisierung der Öffentlichen Meinung und die Transformation der gesamten Gesellschaft auf Kriegsfähigkeit hin werden den Prozess von dem einen zum anderen Zustand beschleunigen und nur noch schwerlich umkehrbar machen.
Gleichzeitig wird unter der „Führerschaft Deutschlands“, wie Kanzler Merz verkündet, die aggressive Politik gegen Russland und seine Randstaaten, die für seine Sicherheit von Bedeutung sind, fortgesetzt. Die ideologische Formation des Westens erklärt scheinheilig, dass es um Demokratie und Freiheit gehe. Doch wenn die EU-Präsidentin mit einer Zusage von einer Milliarde Euro vor den Wahlen nach Moldawien reist, handelt es sich um eine direkte Intervention zur Steuerung einer Wahl – so weit die demokratische Treue der EU.
Methodische Notiz
Dieser Text versteht sich als Hinweis auf eine an sich gründliche Untersuchung. Aus einer langen Kette politischer und publizistischer Ereignisse wird eine einzelne Entscheidung herausgegriffen und näher betrachtet. Eine allgemeine Bedeutung erhält der Text im Bewusstsein, dass es eine lange und alltäglich praktizierte dominante Politik und Publizistik gibt. Also: pars pro toto.
Den Begriff des Militärisch-Industriellen Sektors hat der amerikanische Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident 1961 eingeführt. Er sprach von einer „gigantischen industriellen und militärischen Verteidigungsmaschinerie“, die den demokratischen Prozess gefährde. Inhaltlich hat vor allem der Soziologe C. W. Mills diesen Machtkomplex analysiert. Analysen in Deutschland stammen von Michael Brzoska und Dieter H. Kollmer.