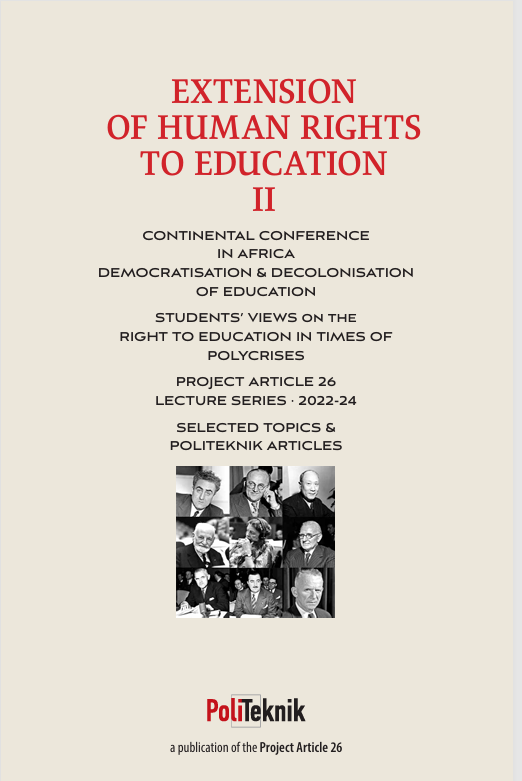Bei heutigen Diskussionen zu Ost-West-Themen, auch kritischen, wie dem spannenden Text von Dirk Oschmann (Der Osten: eine westdeutsche Erfindung), vermisse ich schmerzlich eine Auseinandersetzung mit den Fragen des Sozialismus der ostdeutschen und osteuropäischen Gesellschaften vor der Wende, sowie eine Kritik an der kapitalistischen Wirtschaft. Die DDR wird auf Diktatur und Unrechtsstaat reduziert, die westliche Welt dagegen ist eine Demokratie. Weder war die DDR sozialistisch, noch Westeuropa und die USA kapitalistisch. Diese beiden Aspekte der Wirklichkeit sind gleichsam tabu.
In meiner Jugend habe ich in widersprüchlichen Diskurswelten gelebt. Das Elternhaus war christlich und kritisch gegenüber dem Staat, es gab aber aktive Auseinandersetzungen und Wohlwollen gegenüber vielen akzeptierten und als gut erkannten Seiten der teils verwirklichten und teils ausstehenden gesellschaftlichen Formen. Die katholische Kirche, zu der wir gehörten, verhielt sich sehr ablehnend. In der Schule war ich in der Regel mit einer kritiklosen Affirmation der DDR konfrontiert; die Schüler wiederum waren oftmals, nicht durchgängig, in einem hohen Grade negativ gegenüber Staat und Ideologie eingestellt.
Für mich war bis zum Ende der DDR der Autoritarismus, am stärksten im Phänomen der Mauer symbolisiert, verhasst, wie auch die Gewalt, welche durch die Armee (NVA) in Bereitschaft gestellt und immer wieder ausgeübt wurde; bis ins letzte Jahr der DDR wurden Menschen, welche die DDR illegal verlassen wollten, erschossen. Aber der Anspruch einer sozialistischen Gesellschaft, der Überwindung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, der internationale Geist leuchteten mir sehr ein. Wir diskutierten über viele Widersprüche. Dazu gehörte die Frage nach dem sogenannten Volkseigentum. Warum kümmerten sich die Menschen nicht um Häuser, Ländereien oder Betriebe, wenn sie doch dem Volke, also den Menschen, ihnen selber, gehörten? Funktionierte nur, was die Leute privat besaßen? Auf der anderen Seite hatte die Bevölkerung, also die Menschen selber, gar nicht die Macht über das Volkseigentum, sondern die Prozesse wurden von bürokratisch organisierten Eliten bestimmt. Heute kann ich (auch mit Lektüre von P. Bourdieu) besser erkennen, warum real erlebte Ohnmacht zu Gleichgültigkeit und Desinteresse führen. Ein anderer Widerspruch betraf die Frage, warum sich die medial so hoch gelobte Klasse der Arbeiter und Werktätigen so unmotiviert zum Arbeiten zeigte, nachdem doch die kapitalistische Ausbeutung beendet worden war. Auch hier lässt sich heute antworten, dass die Arbeiter gar keine Macht hatten, sondern auch in der DDR unterdrückt und ausgebeutet wurden. Aber Widersprüche sind treibende Kräfte. Hätte es jemals 1989 die Kraft zum Umbruch gegeben, wenn es nicht den Anspruch oder die Vision des Volkseigentums gegeben hätte, also einer direkten und aktiven Mitbestimmung über die Belange der Gesellschaft, über Wirtschaft und Politik, von den Menschen selber her? War nicht die implizite oder explizite Erwartung da, dass das Eigentum, das Eigene der Gesellschaft, einschließlich politischer, kultureller, wirtschaftlicher Zusammenhänge, das Land, die Betriebe, die soziale Wirklichkeit, nun wirklich den Menschen gehören und von diesen bestimmt werden sollte? Und wollten die arbeitenden Menschen nicht tatsächlich die dem Anspruch nach herbeigeredete, aber noch nicht verwirklichte Befreiung von Unterdrückung und Ausbeutung wahr machen? Ein Umbruch in solchem Sinne, eine gesellschaftliche befreiende Umwälzung ohne Wiedervereinigung wäre eine Revolution gewesen, die diesen Namen verdiente; aber das was tatsächlich geschehen ist, war keine Revolution, sondern vielleicht eine Implosion, die bekannte Übernahme des Schwächeren durch den Stärkeren.
In meiner Schulzeit habe ich zweimal aktive Erfahrungen mit Kritik gemacht. Es wurde viel darüber diskutiert, dass man in der DDR nicht seine Meinung sagen durfte. Aber die Wirklichkeit war oft subtiler und komplexer. Es gab seit der siebendten Klasse alle zwei Wochen einen Schultag mit der Bezeichnung “Produktionsarbeit” (PA), das war praktische Arbeit, die teilweise mit Betrieben der Industrie oder von Baustellen verknüpft wurde. Dort lernten wir technische Fertigkeiten wie mit Metall oder Beton zu arbeiten. In der 10. Klasse wurden wir auf verschiedene Betriebe der Stadt Görlitz verteilt, wo wir nun alle zwei Wochen je einen Vormittag zubrachten. Während der 10. Klasse wurde ich einmal aufgefordert, einen Aufsatz zu schreiben mit Fragen, die etwa beinhalteten, wie ich die sozialistische Arbeit erlebt, was ich gelernt, wie ich die Arbeiter erlebt hatte. Im ersten Moment war mir danach zumute zu fluchen über eine so blöde Arbeit, in der von mir erwartet wurde, den Lehrern und Vorgesetzten nach dem Munde zu reden und mir etwas aus den Fingern zu saugen, was mir sehr schwer fiel. Ich konnte bei Hausaufgaben der “Staatsbürgerkunde”, also des ideologischen Unterrichts, stundenlang vor einem Blatt Papier sitzen, ohne dass mir ein Wort zu schreiben einfiel, weil ich manchmal kaum verstand, wovon die Rede war. Aber plötzlich kam mir eine Idee: ich könnte doch das schreiben, was ich wirklich dachte und erlebte! Dieser Gedanke war ungewöhnlich und beflügelte mich. Mein familiärer Hintergrund war zudem der, dass mein Vater immer wieder kritische Briefe an die DDR-Regierung schrieb. Mit einer solchen Motivation machte es mir auf einmal Spaß zu schreiben; ich fand es aufregend. So schrieb ich in diesem Aufsatz beispielsweise, dass mir die sozialistischen Arbeiter nicht sehr motiviert zum Arbeiten schienen, sie lange Pausen machten und rauchten, oder auch dass ich zwar ab der siebendten Klasse in PA einige praktische Fertigkeiten erworben und eingeübt, in der zehnten Klasse aber so gut wie nichts gelernt hätte, da ich Aufgaben wir Sand mit einer Schubkarre zu transportieren erhielt, oder manchmal über längere Zeit gar nichts zu tun war. Ich erinnere mich, wie ein Klassenkamerad und ich zusammen die Benotung erhielten. Er hatte das genaue Gegenteil von mir geschrieben, eine reine Lobeshymne. Der Lehrer gab uns beiden eine Eins und sagte, dass er meinen kritischen Text gut fand. Über diese Entscheidung beiden gegenüber bin ich ihm heute noch dankbar.
Die zweite Erfahrung mit Kritik war mein Abituraufsatz im Deutschunterricht. Ich wählte unter mehreren Möglichkeiten ein offenes Thema, bei dem ich mir selber einen Roman aussuchen konnte. Dabei entschied ich mich für die Richtstatt von Tschingis Aitmatow. Ich schrieb über die Figur eines tief überzeugten Kommunisten in diesem Roman, der an der gesellschaftlichen Wirklichkeit in seinem Dorf zugrunde geht. Diese Geschichte verknüpfte ich mit den damals aktuellen Bewegungen der Perestroika in der Sowjetunion, mit dort geübter Kritik und Veränderungen, die wie ich weiter ausführte, auch in vergleichbarer Weise in der DDR verwirklicht werden sollten. (Die DDR hatte sich seit dem Beginn der Perestroika konsequent geweigert, auch nur ein Minimum an Öffnung und Kritik, der Sowjetunion vergleichbar, zuzulassen.) Unsere Deutschlehrerin sagte uns ein paar Tage später, dass zwei der Abituraufsätze, darunter auch meiner, dem Direktor der Schule vorgelegt worden waren. Dieser Direktor war ein unkritischer Mitmacher im Staat, und wie sich nach der Wende herausstellte, bei der Stasi. Ich erhielt eine Drei für den Aufsatz mit der Begründung, dass ich das gestellte Thema nicht ganz erfasst hätte. Für mich gab es natürlich keinen Zweifel daran, dass die relativ schlechte Bewertung am politischen Thema lag. Das verschlechterte meine Abiturnote von Eins auf Zwei, aber ich bin heute noch froh darüber, dass ich geschrieben habe, was ich wirklich dachte, und was mir tatsächlich am Herzen lag.
Und sollte das, was mir damals am Herzen lag, nach der Grenzöffnung 1989 und bis heute, nicht mehr ein Herzensthema sein?
Während der Maueröffnung war ich während mehrerer Monate bei der Armee der DDR, der NVA; mein Dienst begann dort am 1.11.1989, und der Mauerdurchbruch geschah am 9.11. In diesen Monaten im Herbst wurde viel über Wiedervereinigung gesprochen. Mich irritierte das, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie zwei so unterschiedliche Gesellschaften und politischen Systeme zu einem Land werden sollten. Würde es sozialistisch oder kapitalistisch sein? Als ich diese Frage einem Kommilitonen stellte, sagte er: natürlich kapitalistisch. Mir war augenblicklich klar, dass er Recht hatte. Aber mir war eiskalt dabei zumute.
Wenige Monate zuvor, im September und Oktober 1989, als die Demonstrationen und Runden Tische bereits sehr aktiv waren, hatte ich ein Praktikum im Physiologischen Institut der Charité in Berlin gemacht. Während dieses Praktikums durfte ich immer wieder an den dortigen Vorlesungen teilnehmen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich irgendetwas davon verstand. Aber ich weiß noch, dass die Studenten gemeinsam Stellungnahmen verfassten, in denen sie Dialog und Toleranz forderten. Am Ende dieser Stellungnahmen wurde immer betont, dass sie selbstverständlich keinen Zweifel daran lassen, dass sie am Sozialismus festhalten. – Wenige Monate später schien sich kein Mensch mehr daran zu erinnern.
War an dieser letzten Versicherung überhaupt nichts Wahres dran, war diese nur Lüge, nur eine Phrase im Sinne einer Pflichterfüllung gewesen?
Damals nahm ich weder an den Montagsdemonstrationen noch den Runden Tischen teil. Erst Jahre später erkannt ich klarer, dass in diesen letzten Wochen vor der Maueröffnung eine fast messianische Erwartung wuchs, in der, zumindest bei einigen Kreisen der Bevölkerung, eine Umwälzung hin zu einem Sozialismus von der Basis her zum Greifen nahe schien: Christa Wolf redete am 4.11. bei einer Demonstration auf dem Alexanderplatz in Berlin von einem Sozialismus, “der den Namen auch wirklich verdient”; die Runden Tische, die eine hohe gesellschaftliche Repräsentanz verkörperten, “erfanden” die Demokratie neu, indem sie politische Entscheidungen trafen; die Regierung der DDR näherte sich der Zivilgesellschaft an, wie dies noch nie vorgekommen war, und arbeitete direkt mit dem Zentralen Runden Tisch in Berlin zusammen; das Team der Wirtschaftsministerin Christa Luft innerhalb der Regierung von Hans Modrow erarbeitete einen Reformvorschlag für die Wirtschaft der DDR, die sich sowohl marktwirtschaftlich öffnen sollte, als auch öffentliches Eigentum des Landes und der großen Betriebe beibehielt, und der zentrale Runde Tisch akzeptierte diesen Reformvorschlag.
Das entscheidende Totschlagargument gegen solche Veränderungen lautete wenige Wochen später, man brauche das Fahrrad doch nicht ein zweites Mal zu erfinden.
In den darauffolgenden Jahren lernte ich über längere Zeit England kennen, begann in Göttingen zu studieren, wo ich jeweils die Atmosphäre genoss, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, bzw. dann Deutschlands, kamen. Es faszinierte mich, mit diesen unterschiedlichsten Menschen in lebendigen, erfrischenden Kontakt zu kommen. Die Ferne verwandelte sich in Nähe. Als ich 1992 in Münster begann, Theologie zu studieren, vermisste ich zu meiner Überraschung die vielgestaltige, internationale lebendige, aufbruchsfreudige Stimmung; es war mir, als sei ich erneut in eine provinzielle Gesellschaft hineingeraten, wo die meisten Menschen, die ich nun im Studium kennenlernte, aus der näheren Umgebung stammten; der Geist der Wanderschaft, der Internationalität, aber auch des Neuanfangs war mir überhaupt nicht mehr zu spüren, und ich fühlte mich eher wie ein seltener Fremdling unter Menschen, die keine geschichtlichen Brüche erlebt hatten. Der Osten war weit weg, die “Zone”, wie manche Leute, es witzig findend, sagten. Vor allem erlebte ich nun nicht mehr die “Nähe in der Ferne”, die lebendigen Begegnungen der Menschen auf Reisen, auf Wanderung, die mich in England und Göttingen, aber auch in Taizé und in Schottland begleitet hatten.
Jetzt fühlte ich mich oft depressiv und verlassen. Dieses Gefühl hatte sicher verschiedene Ursachen, persönliche, solche die mit der neuen Umgebung zusammenhingen, aber es lag auch (da ich in der relativen Einsamkeit jetzt weniger abgelenkt war) an der abgekoppelten, abgefertigten, dem Vergessen ausgelieferten Geschichte. Es gab keine DDR-Geschichte mehr, sondern nur noch Neue Bundesländer, als ob diese auf ein leeres Blatt gezeichnet worden wären. So haben auch die Eroberer Amerikas den Doppelkontinent “Neue Welt” genannt, als ob es dort keine Jahrtausende lange humane Geschichte gegeben hätte. Die politische ist von der seelischen Wirklichkeit nicht zu trennen. Mit der politisch ausgelöschten Erinnerung war ich auch mit meiner eigenen lebendigen Vergangenheit vereinsamt.
“Doch wo Gefahr ist, wächst ein Rettendes auch.” Langsam lernte ich durch Theologie und jüdische Philosophie (wie Walter Benjamin, Franz Rosenzweig, Eveline Goodman-Thau), dass wir aus jüdischer, semitischer Tradition heraus die Zeit auch ganz anders betrachten können, als es in unserer indoeuropäischen Kultur üblich ist: die Geschichte ist nicht zu Ende; die Hoffnungen und Träume der Vergangenheit leben weiter und wirken in die Zukunft hinein; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht radikal voneinander getrennt, sondern ineinander verwoben; der Gedanke der Erlösung bedeutet, dass sich der Gesamtzusammenhang der Geschichte verwandelt.
Und was mich immer mehr von der depressiven Stimmung befreite, war es, dass ich die Befreiungstheologie Lateinamerikas kennenlernte, sowie die westeuropäische Linke; es waren studentische Protestbewegungen seit 1997, darüber hinausgehende Proteste gegen den neoliberalen Kapitalismus seit 1998. Bei den studentischen Protesten erlebte ich für einen kurzen Moment, was es bedeuten kann, wenn sich auf einmal die Studierenden einer Fakultät selber organisieren und in kleinen Gruppen anfangen, Politik zu gestalten. Das war ein wenig wie die Runden Tische am Ende der DDR. Ein Augenblick der Basisdemokratie.
Diese verschiedenen Protestbewegungen, auch die Gründung von Attac, der Weltsozialforen, der globalisierungskritischen Kundgebungen waren auf einmal eine internationale Welle, in der ich wieder etwas von der vermissten Nähe in der Ferne erlebte, eine übergreifende Nähe von Mensch zu Mensch, über alle kulturellen Abgründe hinweg.
Nach Abschluss meine Theologiestudiums im Jahre 2000 begab ich mich als Menschenrechtsbeobachter nach Chiapas im südlichen Mexiko. Hier hatte etwas Unglaubliches stattgefunden. Mit der “Revolution der Frauen” 1992 und einem Aufstand 1994 hatten Menschen indigener Bevölkerung es unternommen, “das Fahrrad neu zu erfinden”, was in Ostdeutschland versäumt worden war, nämlich das soziale, mitmenschliche, politische Zusammenleben neu zu gestalten. Die Zapatisten benennen sich nach dem Namen Emiliano Zapata, der während der Mexikanischen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts für Gerechtigkeit kämpfte. Diese Namenswahl zeigt, dass auch hier die Geschichte nicht zu Ende ist, dass die Gegenwart “eine schwache messianische Kraft” besitzt, an welche die Vergangenheit einen Anspruch hat, wie Walter Benjamin formulierte. Nach Agamben sollen diese Worte auf Paulus zurückgehen, der sagte, dass die messianische Kraft in der Schwäche liege. Das, was diese Menschen, die materiell arm sind, “schwach” gegenüber Militär und kapitalistischer Wirtschaft, verwirklichen, verdient meines Erachtens den Namen der Revolution. Durch ihre basisdemokratische Praxis, und indem für sie die Veränderung der Welt mit Selbstveränderung beginnt, kommen sie nicht nur der “umwälzenden Praxis”, von der Marx sprach, nahe, sondern sie haben entscheidend zu einer Erneuerung der weltweiten politisch linken, kapitalismuskritischen Bewegung beigetragen, die nun viel weniger dogmatisch ist als früher, bei geteilten Fragen verschiedene Antworten zulässt, und die statt auf Hierarchien nun auf Entscheidungen durch Konsens setzt.