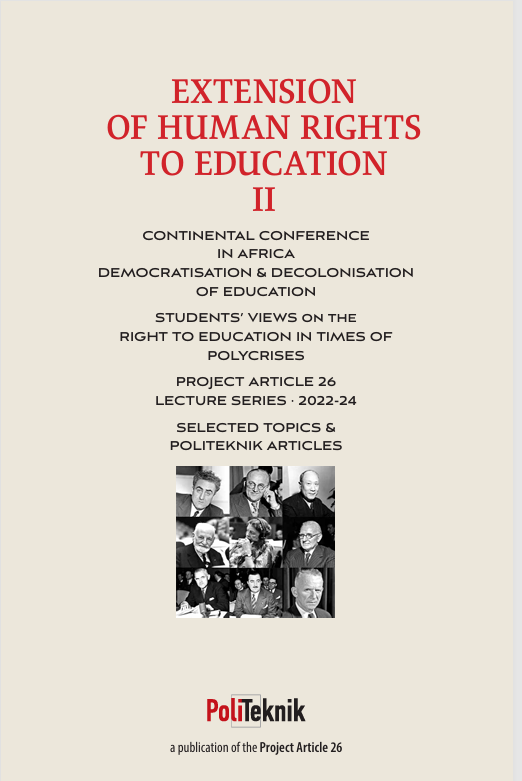Heute leben wir in einer Welt, die auf einer globalisierten Wirtschaft beruht, wenngleich es inzwischen die Tendenz gibt, die Globalisierung zu halbieren, China und Russland wieder von Lieferketten und Handelsströmen abzuschneiden. Aber noch umgreifen sie den Globus. Der globale Süden ist Rohstofflager und Objekt von Agrarspekulation. Die wirtschaftliche Umwälzung verschont keine Region. Außerdem haben die Kriege der nordatlantischen Mächte den Nahen Osten und die Sahelregion destabilisiert. Die Klimakatastrophe zwingt zusätzlich zur Aufgabe herkömmlicher Lebensweisen und teilweise zur Flucht. Die Telekommunikationstechnik erreicht das letzte Dorf. Da ist kein Platz mehr für kulturelle Idyllen. Als Ersatz wählt man erfundene Traditionen, religiöse und nationale Heilsgeschichten, die teils militant verteidigt werden. Hierzulande werden pädagogische Bemühungen vom Lernen im alltäglichen Konkurrenzkampf konterkariert. Mehrfache Krisen machen empfänglich für Rassismus und andere ideologische Angebote. Ihnen zum Trotz bleibt eine Bildungsarbeit, die Selbstreflexion anstrebt, unverzichtbar. Sie kommt aber meines Erachtens nicht ohne politische Aufklärung aus.
Eigenen Erfahrungen einst und heute
Vor dem geschilderten Szenario verwundert es nicht, dass sich die Migration verändert hat. Um die unterschiedlichen Konstellationen zu verdeutlichen, ein kurzer Rückblick auf meine unterschiedlichen Erfahrungen, die ich vor vier Jahrzehnten und dann noch einmal vor wenigen Jahren im Kontakt mit Migrantenfamilien und Migrant:innen gemacht habe. Den Hintergrund bildet einmal die Arbeitsmigration des vorigen Jahrhunderts, einmal die Fluchtmigration der jüngsten Zeit.
Ende der 1970er Jahre habe ich an der Uni Marburg mit circa 15 Studierenden angefangen, Schülern und Schülerinnen einer Gesamtschule in einer kleinen Industriestadt Lernhilfen anzubieten, was sich zu einem zehnjährigen Projekt entwickelte. Die Eltern der Schüler und Schülerinnen waren Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, wie man damals sagte. Ihre Familien kamen alle aus der Türkei. Die Väter arbeiteten in einer Eisengießerei, viele Mütter in einer Strumpffabrik. Von Ausnahmen abgesehen, kamen sie aus anatolischen Dörfern. Ich habe damals öfters den srilankisch-britischen Schriftsteller Ambalavaner Sivanandan zitiert: „Bauern, die migrieren“. Bei der Hilfe für die Schüler spielte Kulturdifferenz selten eine Rolle. Die Eltern hatten sicher andere Vorstellungen von Schule und von Lehrern, aber es kam ihnen nicht in den Sinn, sich dazu zu äußern. Im Kontakt mit ihnen war aber die Kulturdifferenz unübersehbar – eine vielschichtige Differenz, Ergebnis der bäuerlichen Wirtschaftsweise, der anderen Familienstrukturen und der fremden Religion. Die von der dörflichen Lebensweise mitgebrachten Regeln waren mit dem religiösen Pflichtenkanon kombiniert. Aber der Sinn der kulturellen Praktiken war aufgrund der neuen Lebensverhältnisse gezwungenermaßen oft modifiziert.2 Türkische Lehrer:innen, die türkische Sozialberaterin, Studierende aus der Türkei versuchten sich in der Rolle der Kulturvermittler (Volkstanzgruppe etc.). Aber sie waren selbst Fremde in der Community.3
Als 2015 die Betreuung der Geflüchteten, die massenhaft aus den zerstörten Ländern des Nahen Ostens kamen, auf ehrenamtliche Helfer angewiesen war, habe ich mich zur Verfügung gestellt. Ich wohnte inzwischen als Ruheständler in einer Kreisstadt in Oberbayern. Dort habe ich ab 2015 zweimal je einer Gruppe von sechs bis zehn Berufsschüler:innen Sprachhilfen angeboten. (Ich spreche nicht von Sprachkursen, weil ich kein Sprachlehrer bin.) Alle kamen aus Afghanistan, auch Nematullah, ein Bäckerlehrling, dem ich später individuelle Nachhilfe gegeben habe. Für diese jungen Leute, vom jahrzehntelangen Krieg und der oft jahrelangen Flucht durch mehrere Länder geprägt, war „ihre“ Kultur belanglos geworden, so mein Eindruck. Sie war deshalb auch kein Hindernis für ihre Integration. Hinderlich dafür waren ihr niedriger Bildungsstand, und damit verbunden, die geringen beruflichen Perspektiven, die Hürden des Asylrechts und Vorbehalte in der Gesellschaft. Gesprächsthema war für Nematullah die Schwierigkeit, über Whatsapp die Reste seiner Familie in Afghanistan zu kontaktieren. Gesprächsthema war die Schwierigkeit, hier eine Freundin zu finden. Er beklagte sich auch, dass er in dem Fußballverein, in dem er mitspielte, nur immer als Ersatzspieler eingesetzt wurde. Über den Islam wusste er nicht viel. Das merkte ich, als ich ihm half, für die Berufsschule ein Referat über den Islam zu erstellen. Identitätspolitisch war der Islam für ihn bedeutungslos, mehr als für die „Gastarbeiterfamilien“ Jahrzehnte vorher.
Die Gründe dafür waren aber in beiden Fällen unterschiedlich. Für letztere waren die religiösen Pflichten einfach selbstverständliche Alltagspraxis gewesen, für Nematullah war der Islam nicht lebensbestimmend. Waren für die einen Gebet und Moscheebesuch noch nicht für die Selbstrepräsentation bedeutsam, so waren sie für die geflüchteten Jugendlichen kaum noch kulturelle Praxis. Das schloss nicht aus, dass sie sich später zur Profilierung gegenüber der Aufnahmegesellschaft auf den Islam besinnen würden.4
Die Folgen der westlichen Militär-Interventionen im Nahen Osten5
Kulturen sind mit der jeweiligen Wirtschafts- und Lebensweise verknüpft. Kultur verstehe ich als die diskursiv verhandelte Antwort auf die Herausforderungen der jeweiligen Lebensverhältnisse. Diese wurden aber durch die Kriege in Afghanistan, im Irak, in Syrien, im Jemen, in Somalia, im Sudan, in Libyen und in den Ländern der Sahelzone radikal verändert. Die Kriege haben nicht nur Millionen Tote, Invaliden, Traumatisierte hinterlassen, sondern, teils bildlich gesprochen, aber auch buchstäblich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Da in den meisten dieser Länder kein staatliches Gewaltmonopol mehr da ist, herrschen anarchische Verhältnisse. In Libyen gibt es beispielsweise nach über zehn Jahren noch immer zwei rivalisierende Regierungen, jeweils unterstützt von zahlreichen Milizen und einem Warlord, im Jemen eine Exilregierung ohne Legitimation. Irak und Syrien sind zerstückelt. Es herrschen Gewalt und Terror, soweit nicht noch Krieg herrscht. Dschihadisten und andere Milizen, oft von außerhalb unterstützt, bekämpfen sich. Das Ergebnis all dieser Kriege sind failed states.
Schlimm auf andere Art ist das theokratische Regime, das die Taliban in Afghanistan errichtet haben, nachdem die USA mit ihren Verbündeten Hals über Kopf das Land verlassen haben. Das Regime lässt die Menschen nicht nur mit den Traumata eines vierzigjährigen Krieges allein, sondern terrorisiert sie. Den Frauen will man jede Entwicklungsmöglichkeit nehmen. Das Regime lässt sich als der verzweifelte Versuch deuten, unter Rückgriff auf die heiligen Schriften eine Ordnung zu etablieren. Aber diese Ordnung ist nicht gewachsen, sondern basiert auf Willkür. Nicht einmal Sicherheit von Leib und Leben können die Taliban garantieren, seit der Islamische Staat, die Konkurrenzorganisation, Terroranschläge verübt.
Im Irak sorgt neben dem Staatsversagen der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten für ständige Unruhe. Dieser Konflikt ist von der US-Besatzung verschärft worden, weil sie nach 2003 die Funktionseliten ausgetauscht und Positionen einseitig mit Schiiten besetzt hat. In Syrien bedingen die harten Wirtschaftssanktionen und die Teilung des Landes Perspektivlosigkeit. Teile werden von der Regierung, andere von den Kurden und wieder andere von der Türkei kontrolliert. In Libyen herrscht Chaos. Die Zerstörung des Landes hat den Terrorismus in der ganzen Sahelzone gefördert. Die dortigen Landkonflikte zwischen den oft christlichen Bauerndörfern und den islamischen Viehzuchtclans werden zum Religionskonflikt umgedeutet und von islamistischen Predigern vereinnahmt.
Dass bei so viel Zerstörung, bei Flucht vor Terror und Krieg herkömmliche Lebensweisen nicht mehr beibehalten werden können, und dass dies nicht ohne Folgen bleibt auf die kulturellen Orientierungsmuster und Praktiken, ist einsichtig. Selbst wer die heutigen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnisse länger und intensiv studiert, ist auf soziologische Fantasie angewiesen, um sich die dortigen Zustände vorzustellen. Bücher, Reportagen und Film-Dokus vermitteln nur ein unzureichendes Bild. Aber Der Verlust der herkömmlichen Lebensgrundlagen und sozialen Netze durch Vernichtung der Häuser, Geschäfte, Felder oder durch Vertreibung führt auch zum Verlust bewährter Orientierungsmuster. Tradierte Kulturen – wir reden nicht von „ursprünglichen“ – können nicht mehr gelebt werden. Der Versuch dazu muss in Formelhaftigkeit erstarren. Besonders traurig ist übrigens im Nahen Osten der Verlust der friedlichen, multireligiösen Nachbarschaften. Ein Bewohner von Mossul erinnert sich: Wir sind gut miteinander ausgekommen, haben gemeinsam die Feste gefeiert. Da mag Nostalgie mitschwingen, aber vielerorts stimmte das. Viele christliche Gemeinden im Irak und in Syrien wurden vernichtet, extrem dezimiert oder entwurzelt. Ein ähnliches Schicksal hat der Islamische Staat den Jesiden bereitet.
Auf die gewaltsame Destruktion der gewohnten Lebensweise gibt es meines Erachtens mehrere mögliche Reaktionsweisen: (a) Anomie. „Wenn ein Land von der Hand in den Mund lebt, wird es anfällig für Gesetzlosigkeit“. Man sei dann nur noch mit „der Sorge ums Überleben beschäftigt“, so ein Somalier.6 Andere suchen (b) Halt beim Festhalten an scheinbar traditionellen Werten und Praktiken bzw. dem Rekurs auf sie. Eine Alternative dazu ist (c) die Suche nach neuen Orientierungsmustern, die Sicherheit versprechen. Diese ist (d) in der Regel begleitet von einer reflexiven Haltung gegenüber dem, was bisher als selbstverständlich gegolten hat.
Nach dem, was man von den vorhin genannten Ländern weiß, werden teils „westliche“ Lebensstile nachzuahmen versucht. Die Wohlstandsinseln im Westen sind für viele zu Sehnsuchtsorten geworden. Andere suchen ihr Heil in der Hinwendung zu religiösen Fundamenten des Islam, die für Islamisten einst eine großartige Welt voller Wohlstand begründet haben. Auch der Wechsel vom Verehrer westlichen Fortschritts zum Dschihadisten ist möglich. Auf jeden Fall aber ist es mit dem naiven Leben im Herkömmlichen vorbei. Die Welt hat endgültig ihre Selbstverständlichkeit verloren, und zwar auch im letzten Dorf. Verstärkt wird das noch dadurch, dass man medial mit aller Welt in Verbindung treten kann, und sieht, wie anderswo gelebt wird.
Die Folgen der kapitalistischen System-Integration durch neokoloniale Politik
Die wirtschaftliche Globalisierung – die Diskussion über Lieferketten hat sie ins allgemeine Bewusstsein gerückt – diese Globalisierung hat auch die Lebensverhältnisse und die Lebensweisen außerhalb Europas umgewälzt und ebenfalls Traditionen entwertet, weil sie ihre Orientierungsfunktion verlieren. Seit 1980 wurden circa zwei Milliarden Arbeitskräfte neu in das kapitalistische Weltsystem einbezogen, womit sie zugleich Konsument:innen wurden. Die „verlängerte Werkbank“ kapitalistischer Unternehmen reicht heute bis in die entlegensten Ecken der Welt. Inzwischen wird zwar die Auslagerung von Produktionsschritten, das sog. Offshoring, aufgrund der Verunsicherung durch abgerissene Lieferketten wieder in Frage gestellt. Aber so leicht lässt sich das nicht rückgängig machen. Die Verwertungsbedingungen aufgrund niedriger Löhne, niedriger arbeitsrechtlicher Standards etc. sind zu günstig. Die Beschäftigung in der Industrie bedingt eine Universalisierung von Verhaltens- und Denkmustern. Überkommene Familiensysteme, nicht nur die Geschlechterordnung, werden in Frage gestellt.
Afrika dient weniger als verlängerte Werkbank denn als Rohstoff- und Nahrungslieferant. Mächtige Akteure, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika, haben spätestens seit 1990 viel daran gesetzt, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu einer „marktorientierten“ zu machen und für den Weltmarkt zu öffnen. Das heißt, die Subsistenzproduktion, eine bäuerliche Landwirtschaft, die primär den Eigenbedarf deckt, wurde in vielen Regionen in eine industrielle Landwirtschaft transformiert. Das hat viele Familien brotlos gemacht und in die Städte getrieben. Freihandelsabkommen, die dazu geführt haben, dass Produkte aus der EU, auch aus den USA und China den afrikanischen Markt überschwemmen, vernichten ebenfalls viele Existenzen. Andere werden Opfer von Landraub, d.h. des Kaufs oder der Pacht riesiger Agrarflächen durch Investoren, d.h. von Unternehmen, Agrarfonds, Versicherungen. Bauernfamilien sind nicht sicher vor Landnahme. Die Pachtverträge gelten in der Regel für 99 Jahre. Auch Bergbauprojekte führen zu Landraub, meist verbunden mit Wasserraub durch Verseuchung der Gewässer.
Die Abhängigkeit von Geldeinkommen verändert die Lebensverhältnisse und Denkmuster auch bei bäuerlichen Haushalten, zum einen deshalb, weil sie auch Bauernfamilien zur Gelegenheitsarbeit oder zur Saisonarbeit nötigt. Die Männer sind oft über Monate weit weg. Die Lebensverhältnisse sind unsicher geworden. Zum anderen sind bäuerliche Haushalte nicht mehr vor Verschuldung sicher, nachdem man ihnen die Verwendung von Kunstdünger und Pestiziden aufgedrängt hat, die aber der Staat nicht mehr subventioniert. Er nimmt ihnen auch die Ernte nicht mehr wie früher zum Festpreis ab. Solche Auflagen verbindet der Internationale Währungsfonds mit der Kreditvergabe an finanzschwache Staaten.
Die Klimakrise birgt weitere Bedrohungen, nicht nur Dürre und Überschwemmungen. In der Sahelzone hat sie die traditionelle Symbiose zwischen Ackerbauern und nomadischen Viehzuchtclans beendet. Stattdessen kommt es regional zu heißen Kämpfen um Land, weil die Weideflächen im Norden schwinden, so dass die Viehzüchter nach Süden drängen.
In den Slums gibt es ethnische Communities als Teil der Überlebensstrategie. Aber sie eint keine traditionelle Ordnung, nur die symbolische Kraft der gemeinsamen Herkunft, die gegenseitige Hilfe garantieren soll. Beschäftigung findet man innerhalb der städtischen Konglomerate am ehesten im informellen Sektor mit Garküchen, kleinen Läden und handwerklichen Hilfsangeboten. Die Schwierigkeiten des Überlebens bedingen das, was Louis Henri Seukwa den „Habitus der Überlebenskunst“ nennt.7 Die generative Eigenschaft des Habitus hilft bei der Bewältigung neuer Situationen und Aufgaben, selbst bei biographischen Brüchen, wie sie die Migration mit sich bringt.
Wenn die Welt unberechenbar wird, suchen die einzelnen auf je eigene Art ihr Heil – Stichwort Individualisierung. Chancen werden darin gesehen, dass die Familie sich in eine Investitionsgemeinschaft verwandelt, die ein Projekt finanziert, sei es ein kleiner Laden oder die Migration eines jungen Familienmitglieds.
In der Migration bewährt sich der „Habitus der Überlebenskunst“. Außerdem verschaffen sich zumindest die jungen Migrant:innen mit ihrem Smartphone schnell Einblicke in die fremde Wohlstandsgesellschaft des Nordens, sind quasi weltläufig, wenn auch vielleicht nur scheinbar. Der indisch-amerikanische Medienwissenschaftler Siva Vaidhyanathan hat 2005 gemeint: „Für Kinder, die heute in Indien aufwachsen, ist es nicht möglich, den Rest der Welt zu ignorieren“.8 Das gilt nicht nur für Indien. Selbst die ganz begrenzten Welten sind heute „überschwemmt mit kosmopolitischen Handlungsrepertoires“, meinte der Anthropologe Arjun Appadurai schon 1991.9
Neue Identitätskonstrukte und hybride Kulturen
Die Kulturen sind reflexiv geworden, nicht in dem Sinn, dass alle darüber nachdenken, aber nichts mehr versteht sich von selbst. Weniger missverständlich sollte man wohl sagen: Die eigene Kultur kann Objekt der Kommunikation sein. – „So ist das bei uns“, sagt man. Wo Menschen ihre Kultur bedroht sehen, werden sie sich ihrer bewusst. Auch der spielerische Umgang mit kulturellen Symbolen und Praktiken ist nichts Ungewöhnliches mehr. Wenn man TV-Reportagen von Protesten der Indigenen aus der Amazonas-Region sieht, wird deutlich: Sie haben nichts mehr mit den „Eingeborenen“ von früher gemein, wie ihr Outfit zeigt. Federschmuck und Tattoos sind bewusst gewählte Identitätsmarker.
Die Verwendung kultureller Symbole und Praktiken als Identitätsmarker ist universell geworden. Diese sind wiederum wichtig, weil Identitäten wählbar geworden sind. Überall die Frage: wer möchte ich sein? Womit mich identifizieren? Gerade der völlige Verlust eines kulturellen Erbes mag das verbissene Festklammern an einer imaginären Tradition fördern. Anders Zeitgenossen, die eine solche Verlusterfahrung thematisieren können. Sie können sich unter Umständen noch neue Mittel der Selbst- und Fremdrepräsentation erarbeiten. Der argentinische Künstler Tiziano Cruz sagt nicht ohne Trauer, wie mir scheint, er sei der „Erbe einer Kultur der Leere“. Er spreche weder Aymara noch Quechua, habe kein Land, könne keine andinen Gesänge und Tänze – Resultat verschiedener Machtsysteme…“10 Aber er drückt sich in seiner Kunst aus.
Vielleicht ist der Zwang zur Selbstdefinition noch zu sehr dem westlichen Denken verhaftet. Möglicherweise ist alle zukünftige Kultur eine Hyperkultur im Sinn von Byung-Chul Han. Sein Bezug auf die fernöstliche Weltvorstellung erscheint mir sehr plausibel. Zitat: „Hyperkultur basiert auf einem dichten Nebeneinander unterschiedlicher, Vorstellungen, Zeichen, Symbole, Bilder und Klänge.“11 Alle losgelöst von ihrem Ursprungsort.
Zweifellos ist der Sieg der Moderne inzwischen durch die globale Marktgesellschaft universell geworden. Markt, Geld und Vertrag, aber auch wirtschaftliche Macht bilden die Universalia. Der Nationalstaat gibt den Rahmen für den Konkurrenzkampf ab. Das fördert bei verknappten Ressourcen und sozialer Ungleichheit den Kampf um die Zugehörigkeitsordnung.12 Rechtsextreme, teils rechtspopulistische, teils definitiv faschistische Bewegungen breiten sich weltweit aus.13 Die vielfältigen Ängste vor sozialem Abstieg, vor Verarmung, Umweltzerstörung, Seuchen bilden den Nährboden. Fundamentalisten machen fixe Identitätsangebote.
Nationalismus prägt die Regierungspolitik in zunehmend mehr europäischen, vor allem osteuropäischen Staaten, wo man nach der Auflösung der Sowjetunion um nationale Identität ringt. In den baltischen Staaten und der Ukraine ist ein extremer Nationalismus hegemonial geworden. Man versucht dort alles auszulöschen, was an russische Kultur erinnert.14 Von den russischen Minderheiten wird Assimilation verlangt. Da ist nichts mehr mit multikultureller Gesellschaft.
Pädagogische Konsequenzen und Dilemmata
Im Hinblick auf Migration braucht es vor allem politische Bildung, um aus den wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen heraus zu verstehen, was die Menschen in die Fremde treibt und mit welchem „Gepäck“ sie, metaphorisch gemeint, ankommen. Konzepte von „Global Education“ bieten einen Ansatz dazu, wenn sie die Triebkräfte der Globalisierung nicht unter den Teppich kehren.15 Interkulturelle Bildung als gegenseitiges Aufspüren von kulturellen Unterschieden, soweit es je so verstanden wurde, macht kaum noch Sinn. Es geht um die Anerkennung von Identitätsentwürfen, was die Erkundung dafür bedeutsamer kultureller Narrative und Praktiken, aber auch der jeweiligen Diskriminierungserfahrungen verlangt. Lernarrangements, in denen man seine eigenen Vorurteile reflektieren kann, halte ich für ein hilfreiches pädagogisches Angebot.
Ich sehe die Pädagogik einerseits mit einer teils fundamentalistischen Identitätspolitik konfrontiert, mit der missionarischen Forderung nach politisch korrekten Benennungen und Erzählungen – für mich teils magische Praktiken.16 Andererseits sieht sie sich nicht nur einer erschreckenden Zunahme von Rassismus gegenüber, sondern auch der Konjunktur von Nationalismen und Feindbildern. Auch der Ausbau der Festung Europa bleibt nicht ohne Einfluss auf die gesellschaftliche Atmosphäre und erschwert rassismuskritische Bildungsarbeit.
(Umfang: 19.522 Zeichen ohne Leerzeichen)