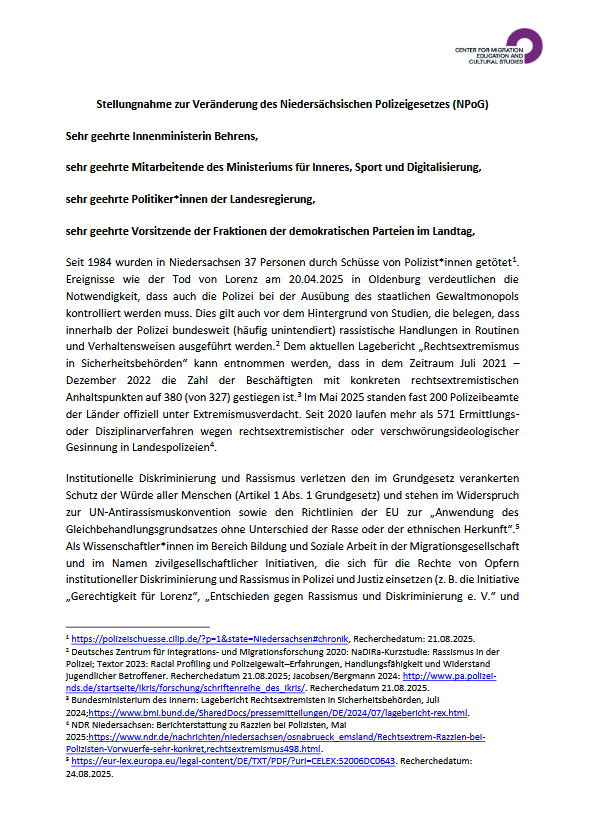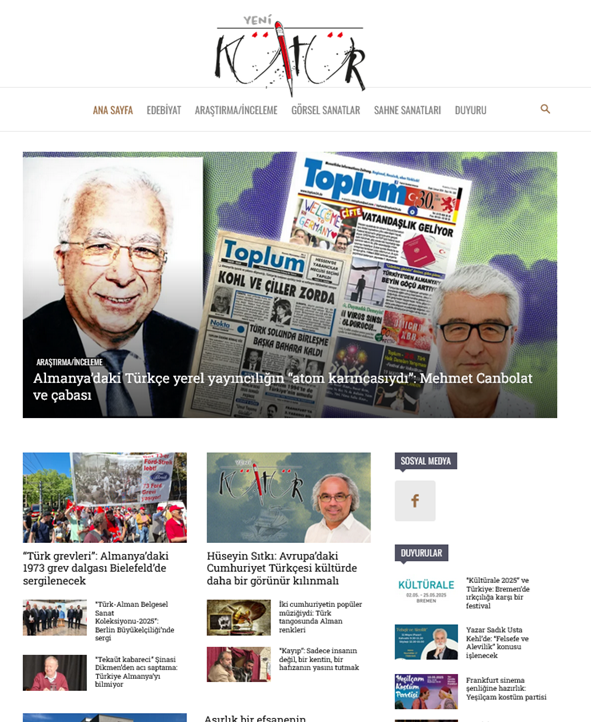Univ.-Prof. Dr. Werner Nell
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism e.V.)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Queen’s University, Kingston ON, Kanada
Städte und Universitäten heißen nach ihren Gründern oder Förderern. Fußballstadien wechseln ihre Namen mit den Sponsoren und zeigen so, dass neben Macht und Einfluss vor allem auch Geld eine Rolle spielen kann, wenn es darum geht, öffentliche Plätze und Aufmerksamkeit, das heißt mitunter auch Gemeinplätze in der Sprache oder eben Diskurse zu nutzen und zu besetzen. Aber die wechselnden Namen und Auseinandersetzungen um Begriffe zeigen auch, dass es schon immer Änderungen und Geltungsansprüche im gesellschaftlichen Verkehr gegeben hat und dass es sie immer wieder gibt. Vor allem aber belegen sie, dass es sich bei Kultur und ihren Erscheinungen niemals um etwas Statisches oder gar autoritativ Festlegbares handelt. Vielmehr stellen kulturelle Einrichtungen, Codierungen und andere In-Szene-Setzungen jeweils Diskurs-Arenen (Werner Schiffauer) dar. Es handelt sich um Aushandlungsorte, an denen diverse gesellschaftliche Gruppen, Erfahrungen und Interessen aufeinander treffen und sich miteinander ins Benehmen setzen müssen. Auf diese Weise können sie zum einen versuchen, sich selbst und ihren Vorstellungen eine Stimme zu geben. Zum anderen müssen sie aber auch – es ist die von Ralf Dahrendorf beschriebene „ärgerliche Tatsache der Gesellschaft“ -, erkennen und wohl auch anerkennen, dass sie es mit anderen zu tun haben, die auch andere Vorstellungen und Erfahrungen, auch eigene Wünsche und Setzungen vertreten könn(t)en und die es dem entsprechend auch auf Wahrnehmung und Anerkennung, durchaus aber auch auf Dominanz und ggf. konflikthafte Vertreibung anderer anlegen.
In früheren Zeiten waren diese Prozesse und Kämpfe hierarchisch geordnet. Es wurde oben bestimmt, was unten (und auch in der Breite) gelten sollte; mitunter gab es auch Gegenmacht und Impulse von unten. Je demokratischer, je pluralistischer, je egalitärer und je integrativer aber Gesellschaften auf ihren Wegen in multiple Modernen wurden und sich in ihren Perspektiven auch so verstehen konnten bzw. wollten, je deutlicher traten damit auch die Ansprüche vieler Verschiedener in Erscheinung, sich an der Besetzung von Öffentlichkeit, sei es in Straßennamen oder in Diskursbegriffen, Politikfeldern oder alltagsbezogenen Verhaltensmustern zu zeigen und entsprechende Anerkennung einzufordern. Eine erste Formation, die dies programmatisch im Blick auf die Gestaltung der ganzen Gesellschaft – in ihrem Namen – einzusetzen suchte, war das Bürgertum im 19. Jahrhundert (bspw. Schillerfeiern und Schillerdenkmäler zu seinem 100jährigen Geburtstag 1859); eine zweite, darauf reagierende und zugleich diese kulturelle Formation überwinden wollende findet sich dann in den europäischen Arbeiterbewegungen, eine dritte mit der im späten 19. Jahrhundert aufkommenden Frauenbewegung. Bestimmte Felder gesellschaftlicher Aushandlung können dabei im eigenen Namen ebenso angeeignet werden wie sie dann auch zur Repräsentation eines übergreifend Allgemeinen zu nutzen sein sollen.
Fragen, Ansatzpunkte für Veränderung und Widerstände dagegen finden sich bis heute und beleuchten, dass kulturelle Erinnerung unter den Bedingungen der Moderne ein ebenso umkämpftes wie offensichtlich wichtiges Feld darstellt. Ist es ein Unterschied, ob, wenn und warum eine Straße Hindenburg-, Adenauer- oder Riesling-Straße heißt? In einer pluralistischen, von Gruppen und Milieus, zudem auch noch von „Singularitäten“ (Andreas Reckwitz) geprägten Gesellschaft lassen sich Diskursfelder ebenso wie öffentliche Plätze, Leselisten und Begrifflichkeiten deutlicher als vielleicht früher als „verhandelbar“ erkennen. „Gemacht“ waren sie schon immer, sei es von herrschender Politik oder dominierenden Schichten, durch vermeintlich selbstläufige Geschichte oder gefundene, auch „erfundene“ Traditionen. Freilich geht es bei alten und neuen Kaperfahrten auf den Meeren der Begriffsbildung und ihrer Umsetzung in materielle Zeichen immer auch um mehr als nur um die Repräsentation der eigenen Stellung zur Beeinflussung, Tönung oder Prägung ihres jeweiligen Umfelds: Es geht um die Dimensionen der Zukunft: sie soll unter dieser mit den besetzten Begriffen und benannten Orten verbundenen Perspektive gestaltet werden, und es geht um die Aushandlungen der Gegenwart, die im Raster der jeweiligen Begriffe, Namen und Orientierungsgrößen einer bestimmten Anordnung und Ausrichtung, auch Definitionsmacht und Programmatik unterworfen wird. Schließlich und vielfach im Besonderen geht es auch um die Bezugnahme, die Deutung und die Legitimation der eigenen Position aus Bezügen zu einer entsprechend in Szene gesetzten Vergangenheit, aus der heraus dann wieder Gegenwart und Zukunft entsprechend gestaltet bzw. angeeignet werden sollen.
Tatsächlich wurden und werden solche Debatten schon länger geführt, auch unter damaligen „Deutschen“ schon, etwa bei der Umbenennung einer Lenin-Straße in eine Magdeburger Straße oder auch im Blick auf Kasernen, die nach NS-Kriegsverbrechern benannt waren. Die aktuell aufkommende Schärfe ist aber dem Umstand geschuldet, dass sich in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft nunmehr eben auch die Stimmen derjenigen einzelnen und Gruppen zu Wort melden, die bislang bspw. wie Gastarbeiter und deren Kinder und Enkelkinder oder people of color seitens der Dominanzkultur als nicht zugehörig und damit auch nicht beteiligungsberechtigt betrachtet wurden. Inzwischen sind diese und deren Nachkommen allerdings gebildet, erfahren und selbstbewusst genug, um als Mitglieder dieser Gesellschaft auch ihren Anteil an der Repräsentation einzufordern, wenn es um den Erhalt bzw. die Neubestimmung, auch die Umbenennung öffentlicher Plätze und die Ausgestaltung von Diskursen und Narrativen geht. Wie alle anderen auch verfolgen auch Sie den Wunsch, dass die Ausgestaltung des öffentlichen Raums und der die Gesellschaft tragenden Prozesse und Institutionen (z. B. Schulen und anderer kultureller Einrichtungen) auch ihrer Erfahrung und ihren Ansprüchen auf Da-Sein (Repräsentation) und Da-Sein-Wollen Rechnung trägt. Hierzu hat – im Rahmen internationaler Entwicklungen wie der us-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung – insbesondere die in den 1970er Jahren einsetzende zweite Frauenbewegung die Wege vorgezeichnet, auf denen nunmehr, noch einmal erweitert um die Stimmen derjenigen Menschen und Gruppen, die seitdem in der Bunderepublik eine Stimme finden konnten, Aushandlungsprozesse um das Selbstverständnis und die Repräsentation von Geschichte im öffentlichen. Raum, auch hinsichtlich der Frage von Leselisten und zu Fragen des kulturellen Gedächtnisses geführt werden – und zwar von allen die hier leben und sich beteiligen möchten.
Aktuell hat freilich eine Zuspitzung dieser Debatten – vor allem in Medien und Feuilleton – Konjunktur. Sie besteht vor allem darin, dass von besorgter, teils gutwilliger, mitunter auch unbedarfter, zum Teil aber auch bewusst die Zusammenhänge dramatisierender Seite diverse Ansatzpunkte aus unterschiedlichen Zusammenhängen gerissen und aufeinander gehäuft über einen Leisten geschlagen werden. Hatten in den letzten Jahren unterschiedliche wissenschaftliche Studien (u.a. die von Wilhelm Heitmeyer verantworteten „Deutschen Zustände“ oder die „Mitte“-Studien der Friedrich Ebert Stiftung) ein weiteres Auseinanderrücken der Gesellschaft vor allem durch Armut, Unterversorgung und deren ideologischen Überformung durch Rassismus, Neonazismus und Fremdenfeindlichkeit herausgestellt, so werden nun im Gegenzug gerade die Ansätze für einen weitergehenden bzw. drohenden weiteren Zerfall der Gesellschaft in die Verantwortung genommen, die auf eine Milderung der sozialen Spannungen, auf eine Abwehr von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und eine Förderung von Möglichkeiten des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichen Herkommens, mit unterschiedlichen Erfahrungen und kulturellen, auch religiösen Orientierungen zielen. Derzeit scheint es aus konservativer, ggf. reaktionärer, weit in die Medien ausstrahlender Sicht so auszusehen bzw. wird es so dargestellt, als ob eine Quadriga unangemessener Forderungen es in einem gemeinsamen Angriff darauf anlegte, die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik in Gestalt ihrer kulturellen Repräsentationen in Gefahr zu bringen.
Es geht dabei um vier Felder, die historisch und auch praktisch durchaus unterschiedliche Ursprünge, Ansätze und Zielvorstellungen aufweisen, nun aber in der Weise zusammengebracht werden, dass es sie alle a) auf einen Umsturz der bislang für die Dominanzkultur der Bundesrepublik, falls es sie gab, in Anspruch genommenen Homogenität ihrer Grundlagen und Erscheinungsformen zielen und b) von Menschen oder Gruppen vertreten werden, denen noch bis vor zwei Jahrzehnten jeder Platz und jede Mitbestimmung als Mitbürger versagt wurde bzw. worden wäre. Tatsächlich haben die Vorstellungen einer multikulturellen Gesellschaft, die Ansatzpunkte zur Stärkung der Identität einzelner und sozialer Gruppen durch Empowerment und Anerkennung, die Überprüfung historischer Erinnerung und ihrer Manifestation im Blick auf deren Repräsentanz (für was) und die Forderung nach einem Sprachgebrauch, der darauf ausgeht, Beleidigungen und die Herabwürdigung der jeweiligen Gegenüber zu vermeiden, darin etwas Gemeinsames , dass sie alle daran orientiert sind, den im Grundgesetz für die Bundesrepublik im Artikel 1(1) gesetzten Maßstab: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ für alle Menschen, die in Deutschland leben einzufordern, ja mehr noch dies nicht nur den Staatsorganen als Aufgabe zuzuschreiben, sondern diesen Anspruch in die Handlungsfelder der Gesellschaft und in die Verantwortung der vielen einzelnen zu tragen.
Sicherlich mag dies im Einzelnen und im Alltag nicht nur zu Konflikten, sondern auch zu Überforderungen und Enttäuschungen, auch zu Punkten des Unverhandelbaren führen. Dass aber statt alter Nazigeneräle Widerstandskämpfer erinnert werden, statt Kolonialverbrechern den Opfer dieser Gewalt ein Platz im kulturellen Gedächtnis eingeräumt wird, dass ein Sprachgebrauch, der durchaus in historischer Tradition und manchmal volkskulturellem Gebrauch Menschen verletzt und entwürdigt, als vermeidbar oder unhöflich und verletzend erkannt wird, trägt ebenso zu einem zivileren Umgang unter Menschen in einer pluralistischen Gesellschaft bei wie die im Multikulturalismus enthaltene Vermutung, jeder Mensch, jede Gruppe könne auf seine bzw. ihre Weise einen eigenständigen und schätzenswerten Beitrag zur Gestaltung eines auf Freiheit und Gleichheit beruhenden Zusammenlebens leisten. Eine offene Gesellschaft braucht die Beteiligung aller, die an ihr teilhaben, und sie darf es dafür nicht an Anerkennung ihrer persönlichen Würde fehlen lassen. Solange Rassismus oder Antisemitismus genau diese aber zerstören, solange Frauen noch immer mit Wörtern benannt werden, die jedem so vertraut sind, dass ich sie hier nicht nennen muss, sind die Bedingungen eines solchen Zusammenlebens nicht geschaffen. Eine Germania auf dem Niederwald, die mit bösem Blick nach Frankreich schaut, braucht heute niemand (noch nicht einmal der Tourismus, denn der Blick ist auch ohne sie schön) und es bricht niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn er die berüchtigten Schimpfwörter nicht mehr gebrauchen kann. Kommunikation bleibt weiterhin möglich, auch wenn bestimmte diskriminierende Wörter nicht mehr benutzt werden. Es ist wie bei der noch immer in Wittenberg als historisches (Kultur-?)Dokument (für was?) öffentlich gezeigten „Judensau“. Wie jede Obszönität beschämt sie all diejenigen, die sie anzuschauen (müssen) und dies trifft auch die diejenigen Menschen, die sich keiner Opfergruppe zurechnen müssen oder wollen, also eigentlich auch viele der Einwohner dort.
Soweit der noch für Ernest Renans Nationen-Vorstellung maßgebliche Wille besteht, „das gemeinsame Leben fortzusetzen“ (1882), bedeutet dies auch, zuzulassen, dass viele Stimmen, viele Erinnerungen und Erfahrungen, viele Vorstellungen und auch Ansprüche von allen zur Sprache kommen, die in dieser Gesellschaft leben. Es sind dies die Ansatzpunkte, die sich teilweise von Debatten und Verhältnissen in den USA ausgehend, mit Konzepten wie Identitätspolitik, Political Correctness, multikultureller Gesellschaft und gendergerechter Sprache auch in Deutschland verbinden und darauf zielen, sowohl den Alltag als auch das gesellschaftliche Selbstverständnis um die Erinnerungen und Erfahrungen derjenigen zu erweitern, die hier leben, auch wenn sie eine jüngere Migrations- und/oder Mobilitätsgeschichte haben als sie die meisten Deutschen ansonsten für sich in Anspruch nehmen. Vernünftigerweise wären die hier aufgeworfenen Fragen und Vorschläge wohl jeweils im Einzelnen auszuhandeln, von denjenigen, die daran beteiligt sind und von denjenigen, die davon betroffen sind, nicht zuletzt aber sollten all die Gehör finden, die das Leben in dieser offenen Gesellschaft miteinander fortsetzen möchten.