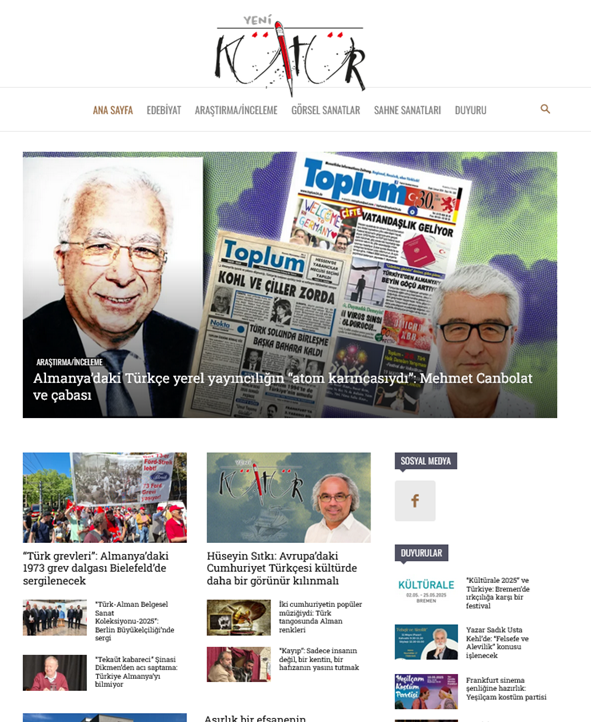Prof. Dr. Werner Nell
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Queen’s University Kingston ON, Kanada
Wieder einmal wird um die Heimat in Deutschland debattiert. Für die deutschen Verhältnisse und ihre Deuter bzw. auch Beobachter ist es dabei durchaus charakteristisch, dass das Thema Heimat wie auch andere Gespenster immer wieder in Erscheinung tritt und dass die Bannung an einen Ort, die viele Gespenster plagt, auch die Heimaten und ihre Liebhaber betrifft. Zunächst geht es um Orte, Plätze oder Landschaften und um die Frage, wem sie wohl gehören und ob diejenigen, die an diesen Orten leben „wohl zu Deutschland gehören“? Es geht also um Landnahme der Befugten und um die Landwegnahme der dort und dazu Unbefugten. Wer das im Einzelnen sein kann, sein darf und/oder auch nicht sein sollte, unterliegt verschiedenen Regel- und Ausschließungssystemen. Je nach Ansprüchen des Rechts (Passbesitz und Staatsbürgerschaft), der Biologie („Rasse“, sonstige „natürliche“ Gegebenheiten des Menschseins), Religion („christliches Abendland“), Herkommen (Geburtsort, Familiengeschichte) oder auch Kultur (Sprache, Tradition, Folklore) soll erkenn- und bestimmbar sein, wer in wessen Heimat wie „zuhause“ ist und sein darf.
In diesem Rahmen verbinden sich Territorialansprüche mit Rechtsansprüchen. Aber auch Identitätsfragen, Zugehörigkeit und Anerkennung werden im Heimat-Diskurs an räumliche, vor allem aber an biografische Erfahrungen oder aber an deren Herleitung gebunden. Es ist diese Verknüpfung von Raum und Zeit auf einer äußeren Ebene mit den Dimensionen eines inneren, persönlichen Erlebens, die sowohl die soziale als auch individuelle Attraktivität der Heimat-Vorstellungen ausmacht. In dieser Konstellation dürfte sie etwas umschreiben, das für alle Menschen überall auf der Welt, also nicht nur in Deutschland, einen Orientierungspunkt bildet und doch zugleich etwas hervorhebt, was – um Ernst Blochs (1885-1977) Bestimmung von „Heimat“ zu zitieren – allen in der Kindheit aufscheint“, worin aber zugleich „noch niemand war: Heimat.“ Zum einen beschreibt Heimat also offensichtlich etwas, das Menschen suchen, vielleicht sogar brauchen und das in diesem Sinne für Individuen ein Grundbedürfnis anspricht, das ihnen im Rahmen von Verfassungs- und Rechtsordnungen ermöglicht werden sollte. Zum anderen aber stellen Ansprüche auf Heimat, zumal wenn sie sich auf bestimmte Gruppen und konkrete Landschaften beziehen leicht auch die Möglichkeit der Überforderung nach beiden Seiten vor Augen: Weder ist es dem einzelnen Menschen zuzumuten, „ganz“ seiner oder ihrer Heimat anzugehören, noch können einzelne Gruppen fordern, dass ihnen eine bestimmte Landschaft alleine oder „natürlich“ gehören oder zur Verfügung stehen sollte. Immanuel Kant (1724-1804) hat in diesem Zusammenhang auf den „gemeinschaftlichen Besitz der Erde“ für alle hingewiesen, „auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein, mehr Recht hat, als der andere.“ (Zum ewigen Frieden, 1795)
Noch immer glauben allerdings viele Deutsche, dass das Wort „Heimat“ nur im Deutschen seinen besonders innigen Klang und darin auch seine für das Zustandekommen von individueller, vor allem aber kollektiver Identität maßgebliche Funktion habe. Dass auch Menschen anderswo sich mit den räumlichen Umwelten und biografisch erfahrenen Nahbereichen identifizieren können, in denen sie aufgewachsen sind oder mit denen sie ihre sozialen, auch familiären Erst- und Naherfahrungen verbinden, scheint dagegen noch immer unvertraut, Nachhall jener mit dem 18. Jahrhundert populär gewordenen Bilder, in denen dem „frivolen Franzosen“ der (!) „tiefsinnige Deutsche“ (Ruth Florack) gegenüber gestellt wurde und die offensichtlich aktuell auch wieder – sei es durch Comedy oder Propaganda-Aktionen – neue Geltungsmacht erlangen können. In diesem Rahmen, und hier spielen dann „deutsche“ Besonderheiten ebenso eine Rolle wie sich andere Besonderheiten in anderen nationalstaatlich ausgerichteten Traditionslinien, historischen und sozialen Umständen finden lassen, sind dann Vorstellungen, erst recht politische oder kulturelle Entwürfe von „Heimat“ immer auch Inszenierungen, in denen das vermutlich „natürlich“ Bedürfnis von Menschen, irgendwo sein (und ggf. dazu gehören) zu können, aufgenommen, vielfach allerdings dann auch vor den Karren unterschiedlicher sonstiger Programme (Ermächtigungs- und Abgrenzungsdiskurse, Machtstrategien, Gewalt- und Vernichtungsphantasien, mitunter auch wirtschaftliche Interessen oder religiöse Orientierungen) gespannt werden. Die Formate der Inszenierung können dabei zwischen heimischer Küche und Brauchtum über Folklore und Infrastrukturentwicklung bis zum Grenzlandkonflikt und damit zur schieren Mobilisierung von Aggression reichen und sind ihrerseits sowohl Antrieb als auch Treibstoff in weiter reichenden sozialen und politischen, auch kulturellen und historischen Entwicklungen und Diskursen.
Tatsächlich gibt es für die besondere Aufmerksamkeit, auch Macht zur Differenzsetzung und ggf. Ausschließung, die dem Heimat-Begriff innerhalb der historischen und aktuellen Debatten in Deutschland zukommt, zwei Wurzeln. Allerdings ist auch noch eine bedenkliche, gegenläufige Unterströmung zu berücksichtigen. Zunächst lässt sich eine theologisch-religiöse Dimension erkennen, etwa wenn in Texten des 17. Jahrhunderts von einer „himmlische Heimat“ die Rede ist. Ein Streben nach ihr wird Frömmigkeit, nicht zuletzt Nächstenliebe und individuelle Redlich- und Verantwortlichkeit erfordern. In wieweit dies kollektiv, ggf. sozial vorzustellen oder zu erreichen ist, bleibt freilich diesseits der Kreuzzugspropaganda zumeist unbestimmt. Neben der Auszeichnung des damit Gemeinten als eines heilsgeschichtlich bedeutsamen Orts ist es aber vor allem die imaginäre, imaginative Dimension, die hier angesprochen wird und natürlich späteren Inszenierungen vorarbeitet. Im Gegensatz aber zu nachfolgenden Territorial- und Grenzkämpfen um die Heimat an bestimmten Orten ist der hier angesprochene Raum zunächst einmal „nicht von dieser Welt“, was seinen Bedarf an Versinnbildlichung, aber auch seine Möglichkeiten zur Inszenierung verstärkt.
Eine zweite Wurzel findet sich in rechtlichen Überlieferungen. Hier ist ebenfalls vom 17. Jahrhundert an von Heimatrecht und von „der“ Heimat im Sinne eines Anspruchs die Rede, der es einem Menschen (vielleicht auch seiner Familie) erlaubt, an einem bestimmten Ort sein (und bleiben) zu dürfen. Allerdings ist (und war) dieses Besitzrecht an einem Ort unter den Bedingungen der Vormoderne keineswegs allen zugänglich, sondern vielfach nur jener kleineren Gruppe von Bauern, Adligen und Bürgern, die über Land- und andere dingliche Besitzrechte verfügen konnten. Angesichts der für die europäische Vormoderne und ebenso für die deutschen Lande charakteristischen räumlichen Mobilität insbesondere auch der ländlichen Unterschichten, der von Flucht, Vertreibung, Arbeitsmigration und Glückssuche angetriebener Ortlosigkeit großer Bevölkerungsgruppen, stellen Heimatrechte und deren Nutzungsmöglichkeiten in der Vormoderne, anders als es Heimatideologen gerne sehen wollen, ein vielen gar nicht erst zugängliches Privileg dar. Ihre Konjunktur und Attraktivität beschreiben aber damit natürlich auch Wunschvorstellungen, Träume und Ansprüche, die gerade auch von denen geteilt werden, die nicht über diese materiellen Grundlagen verfügen.
Mit der im 19. Jahrhundert aufkommenden und sich seitdem umfassend durchsetzenden Industriemoderne sind dann zwei unterschiedliche Entwicklungen verbunden, die gerade in ihrer Gegenläufigkeit auf jene mit der Moderne grundsätzlich verbundene Zwiespältigkeit hinweisen, die offensichtlich alle Orientierungen, Bewegungen und Resultate im Zusammenhang der Moderne in jenes Feld einer innerweltlichen Ambivalenz einrückt, das Zygmunt Bauman (1925-2017) beschrieben und Max Weber (1864-1920) als Wechselspiel von Rationalisierung und Entzauberung erkundet hat. Heimat wird in diesem Rahmen zu einem Ziel, ja einem Gut, das potentiell allen zustehen könnte, zustehen kann, und das durch eben die mit der Industriemoderne verbundenen Erfahrungen und Zumutungen weitergehender Ortsveränderungen und Ortsverluste und durch die damit erneut zunehmende räumliche und soziale Mobilität – auch über die vielfach gerade erst gezogenen nationalstaatlichen Grenzen hinweg – umso wertvoller und zugleich gefährdeter erscheint. Der englische Soziologe Anthony Giddens (*1938) hat diesen Entwicklungsweg westlicher Modernisierung als einen sukzessiven Prozess der „Entbettung“ beschrieben, der zugleich Möglichkeiten der „Rückbettung“ sucht bzw. diese gerade auch dann und dort fordert, wenn und wo sie sich realistisch nicht erkennbar bzw. herstellbar zeigen.
Insoweit als „Heimat“ als solche (und traditionell schon immer) über einen hohen Bedarf und Anteil an Imaginationsansprache verfügt, ja gerade von ihrer imaginativen (mitunter auch fiktionalen) Aufladbarkeit ihre Kraft und Attraktivität gewinnt, bietet sie sich in der aktuellen Situation einer zunehmend (wieder einmal) bewusst werdenden Diskrepanz zwischen erwünschter/erhoffter Zugehörigkeit und erfahrener oder befürchteter Ortlosigkeit als ein immer wieder nutzbares und vielfältig modifizierbares Diskursfeld an, wenn es darum geht die Unruhe und damit die Zumutungen der Moderne zu bearbeiten, diesen zumindest auf der Ebene imaginativer Bilder und kultureller Diskurse sogar etwas entgegen zu setzen. Hier nun muss aber auch noch eine dritte Bezugsgröße, die oben bereits genannte gegenläufige „Unterströmung“ im Heimatbegriff angesprochen werden. Es war Sigmund Freud, der in seiner viel zitierten Studie „Das Unheimliche“ (1919) auf die wortgeschichtliche, aber auch innerliche Verwandtschaft von „heimlich“, „unheimlich“ und „heimelig/anheimelnd“ hingewiesen und das „Unheimliche“ als ein verstelltes, verschobenes Vertrautes bestimmt hat. Folgen wir dieser Spur, so geht es bei Heimat also nicht nur um einen Ort des Vertrauens und des Vertrauten, sondern auch um einen Ort der verschobenen, ja auch gefährdeten Erfahrungen und Sinnansprüche, um einen Ort, an dem Gespenster lauern und der selbst als Gespenst erscheinen kann. Heimat als Ort, zumal auch der Kampf um die Heimat, können damit zugleich auch zu Plätzen und Erfahrungen eines Entzugs von Vertrautheit und Zugehörigkeit werden; das Heim ein Ort des Massakers sein. Im Maße ihrer Besetzung als „Heimat“ können Landschaften und Nahwelten gerade auch zu gefährdeten, herausgeforderten, nicht zuletzt umkämpften Orten gemacht werden; Kriegerdenkmäler, die von Heimatvereinen gepflegt werden, können dies ebenso bezeugen wie die Kirmesschlägerei noch auch zum heimischem Brauchtum zählen mag.
Freilich geht es unter den Bedingungen „flüchtiger Moderne“ (Z. Bauman) sowohl individuell als auch kollektiv nicht nur um eine blutige Nase als Ehrenzeichen und Zeichen der Zugehörigkeit, sondern immer auch um den Schmerz des selbständig Werdens, einen Prozess der Individuation, der keinem Erwachsenwerden erspart bleibt und der im Zuge weitergehender Individualisierung ebenso unaufhaltsam erscheint, wie dieser Vorgang nach Kompensation, Innehalten oder eben auch nach Gestaltung, und sei sie reflexiver bzw. inszenierter Art, verlangt. Hier nun lässt sich die aktuelle Konjunktur der Debatten um Heimat verorten. Dass dies gerade in einem Deutschland, das sich aufgrund seiner föderalen Struktur, seiner konfessionellen historischen Aufgliederungen und nicht zuletzt seiner landschaftlichen Unterschiede immer schon eher als eine Sammlung unterschiedlichster Identitäts- und Gesellschaftsentwürfe sehen musste auf fruchtbaren Boden trifft, mag deshalb nicht verwundern, auch wenn diese Vielfalt seit dem 18. Jahrhundert, zumal in der Sicht seiner Eliten, häufiger als Mangel denn als Ressource und Chance gesehen wurde. Hinzu kommt, dass die späte, vielleicht insgesamt verfehlte und nur kurzfristig erfolgreiche Reichseinigung von 1871 einen zusätzlichen Überschuss an (national) inszenierter Beheimatung mit sich brachte, sogar hervorrief, der spätestens dann nach dem Desaster des Ersten Weltkriegs große Teil der Bevölkerungen für die Blut-, Boden- und Volkstumsideologie der Nazis anfällig machte und mit dem Verlust „der Heimat“ für viele, den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und dem Zivilisationsbruch der Vernichtungslager endete.
„Heimat“ war damit im deutschsprachigen Raum nicht nur zu einem Gespensterort geworden, sondern in der in Heimatliebe und Heimatkampf vermittelten Mischung aus „Kitsch und Tod“ (S. Friedländer) zu einem Menetekel an der Wand der danach entstandenen bundesrepublikanischen Gesellschaft, die sich in langen, oft widersprüchlichen und auch prekären Lernprozessen der Ermöglichung von Heimat zunächst für die „Vertriebenen“, später auch für Migranten und Flüchtlinge zuzuwenden suchte. Offensichtlich lassen sich Heimat-Diskussionen vor diesem Hintergrund immer wieder auch als eine Art Seismograph nutzen, wenn es darum gehen soll, sich entlang der Konjunkturen der damit verbundenen Fragen, was sie sei, wem sie zukomme und vor allem auch wem sie nicht zugestanden werden könne, eine Art Gefühlsgeschichte, ja „Angstgeschichte“ (Frank Biess) der deutschen Gesellschaft(en) im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert vor Augen zu stellen. Dass dabei aktuell Ansatzpunkte der Ermöglichung von Heimat neben solchen der Inszenierung stehen, ist zum einen dem teils aus realen Erfahrungen und Verwerfungen, teils aus imaginären Wünschen, Ansprüchen, aber auch Besessenheiten bestehenden Mischungsverhältnis zuzuschreiben, das die Vorstellungen und Diskurse von Heimat ausmacht. Vielleicht ließe sich als Faustregel nutzen: Je mehr Inszenierung nötig ist (oder für nötig befunden wird, bspw. durch die Gründung eines Heimatministeriums), desto prekärer, also auch gefährlicher ist der Umgang mit ihr – für alle Beteiligten und Betroffenen.
Für ein gegenläufiges Projekt, Heimat nicht (nur) zu inszenieren, vielmehr auch zu ermöglichen, und zwar nicht nur für die bereits Anwesenden, sondern auch für Flüchtlinge und Migranten, Menschen „aller Herren Länder“, hat Heinrich Böll (1917-1985) in seinen Frankfurter Vorlesungen von 1964 bereits einen Ansatzpunkt benannt. Es gehe dabei, so Böll zu Thema „Heimat und keine“, um „die Suche nach einer bewohnbaren Sprache für ein bewohnbares Land“.