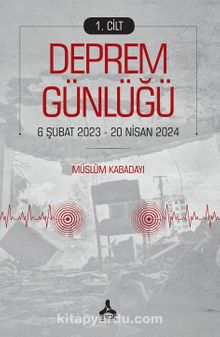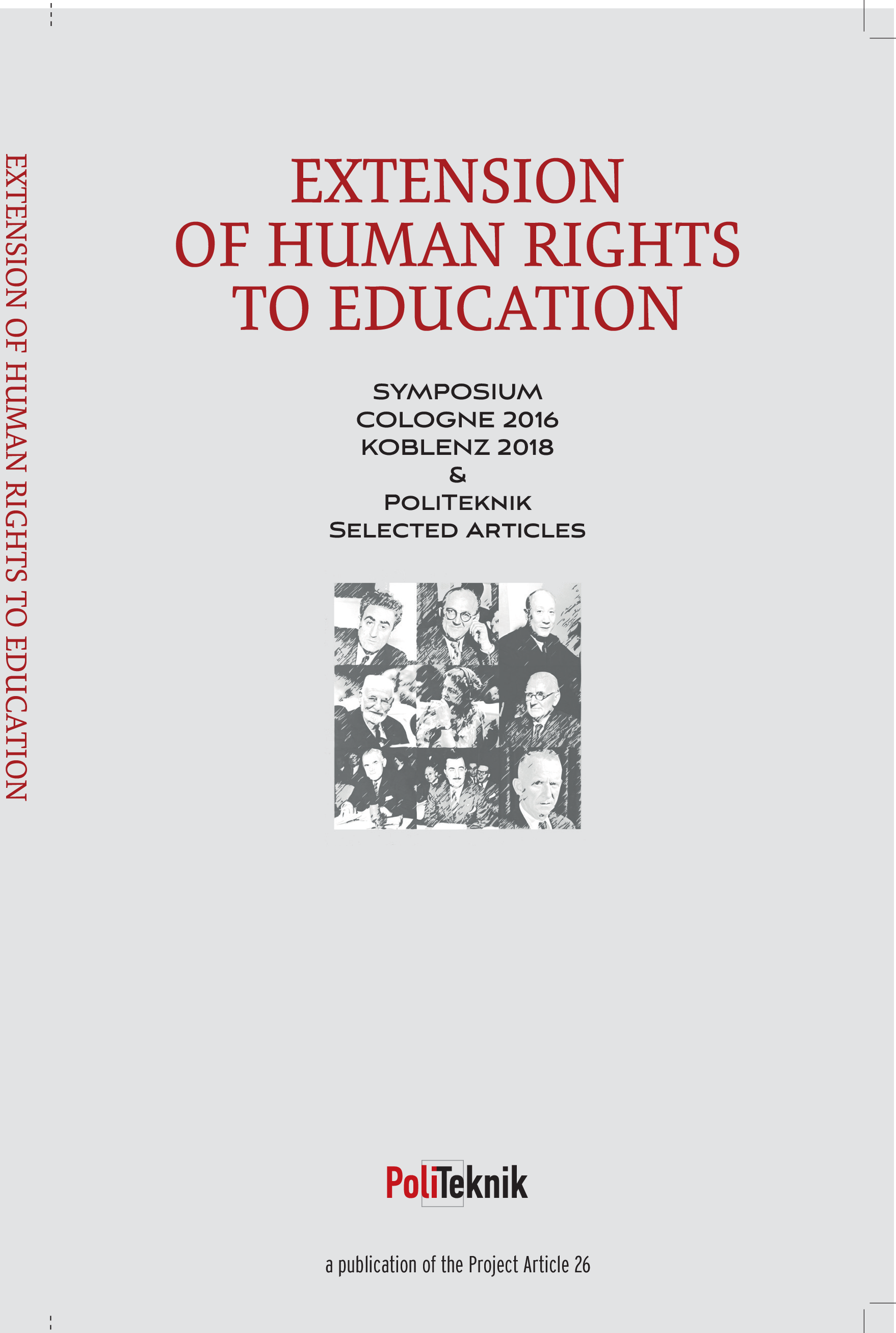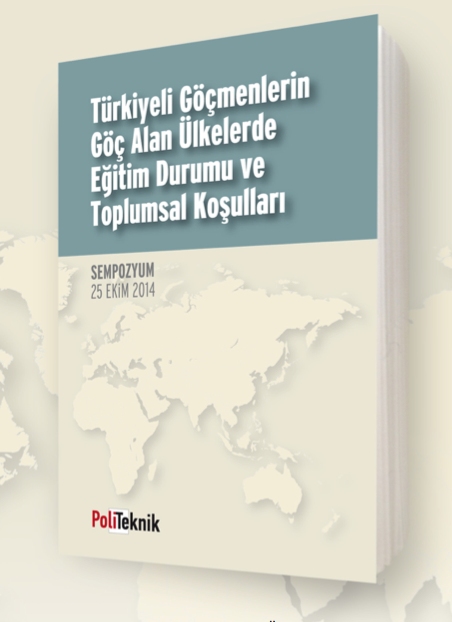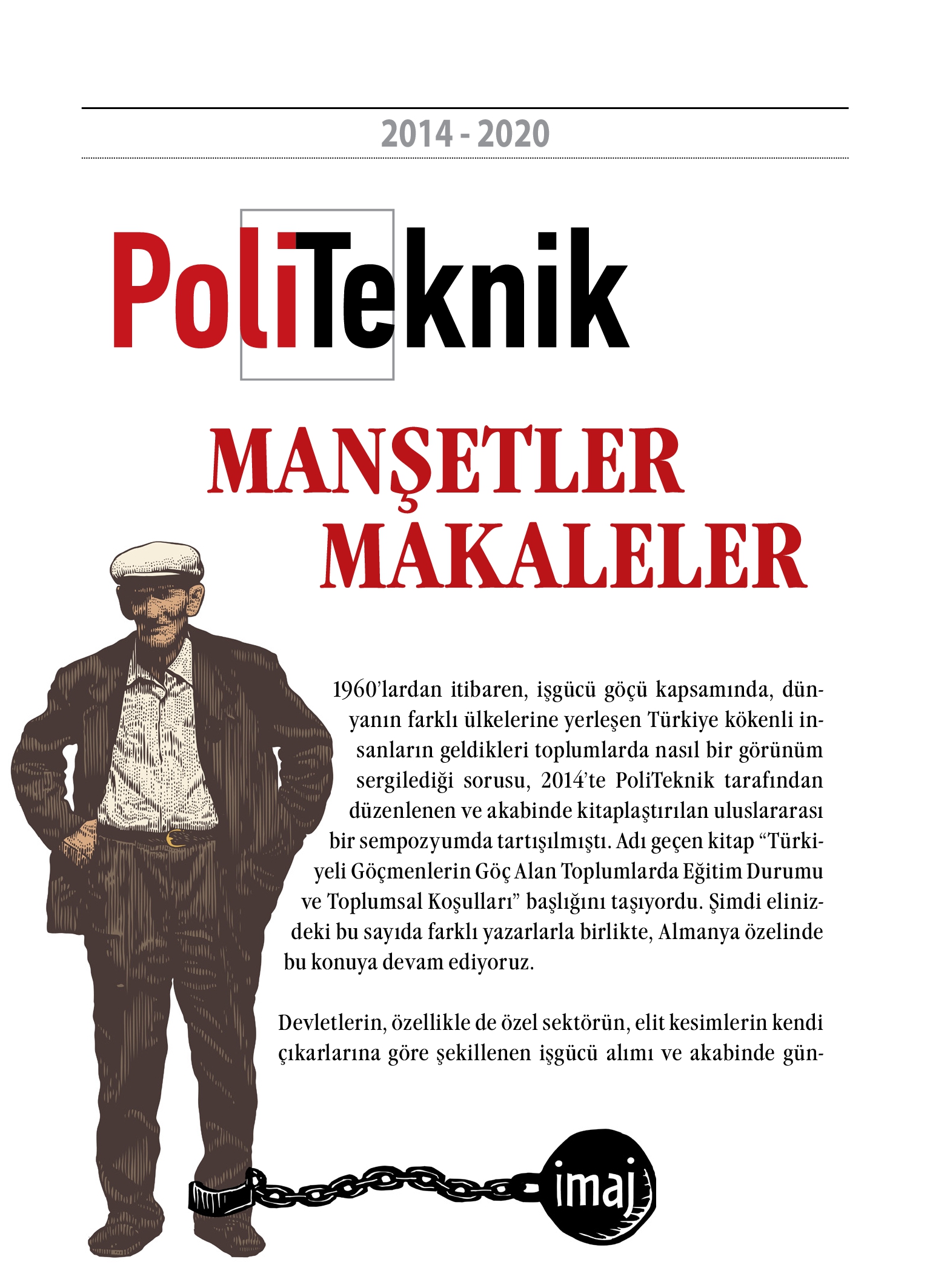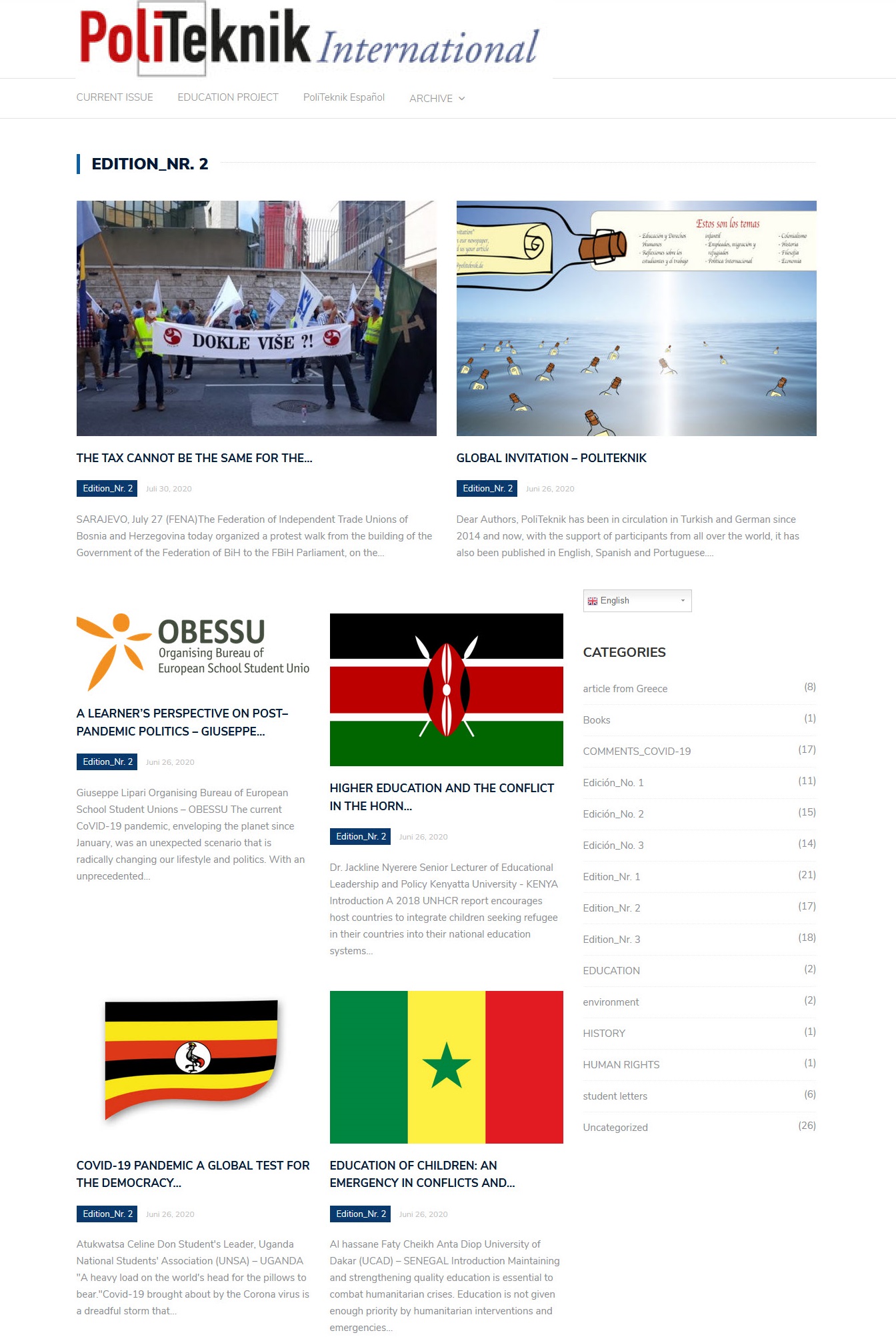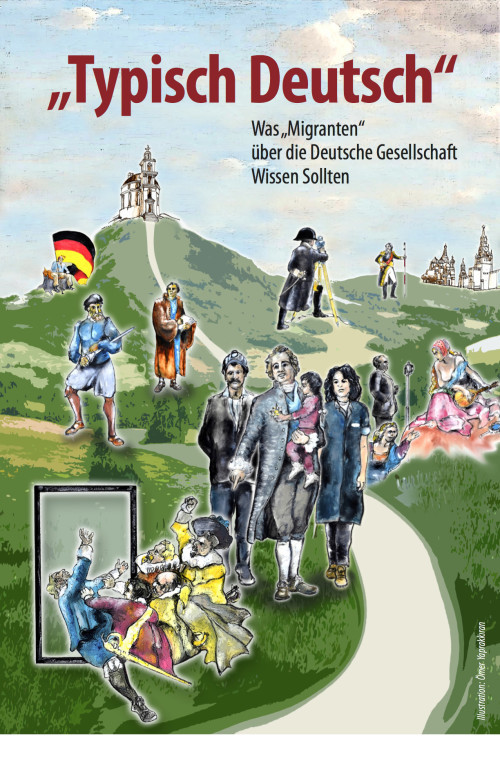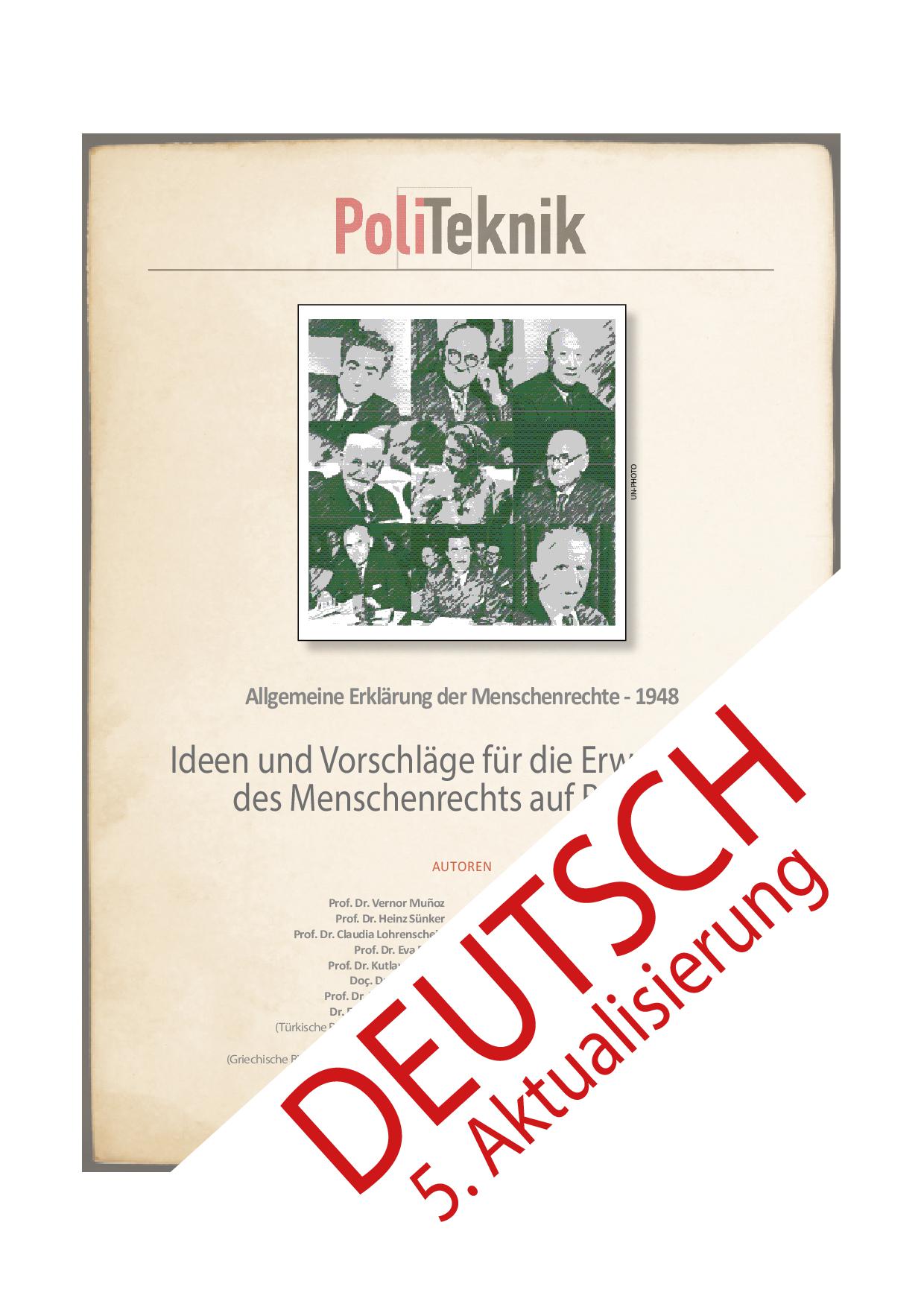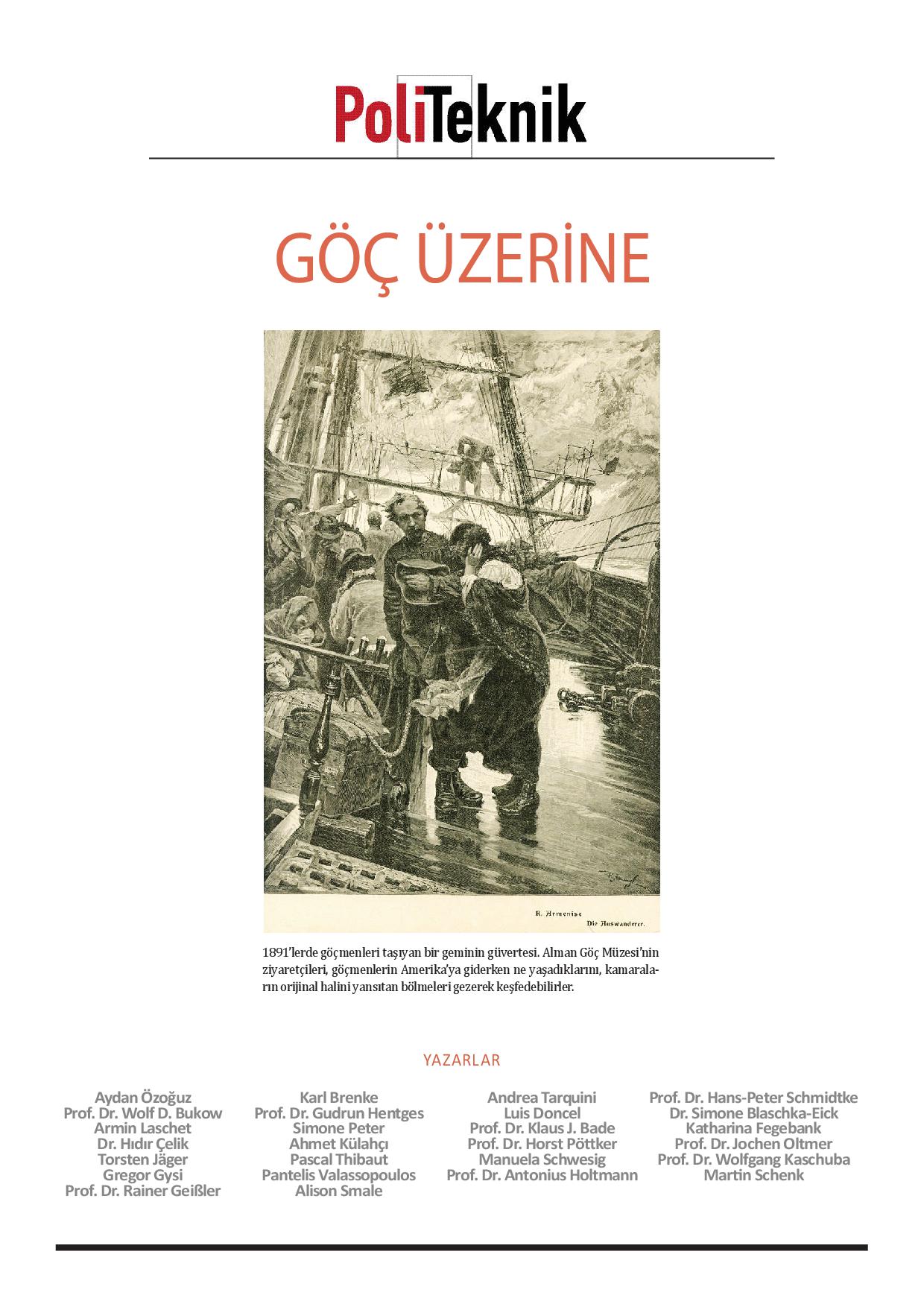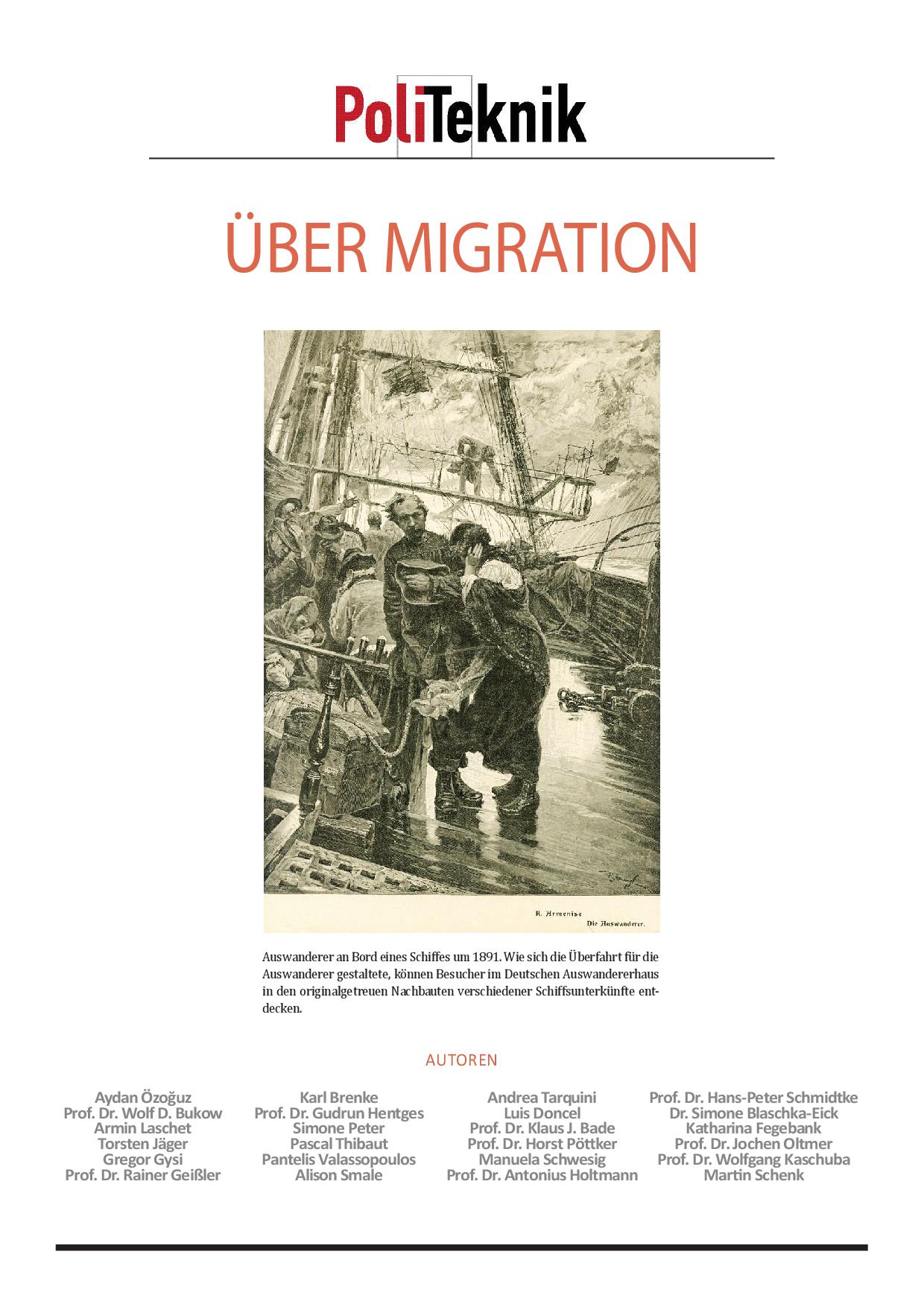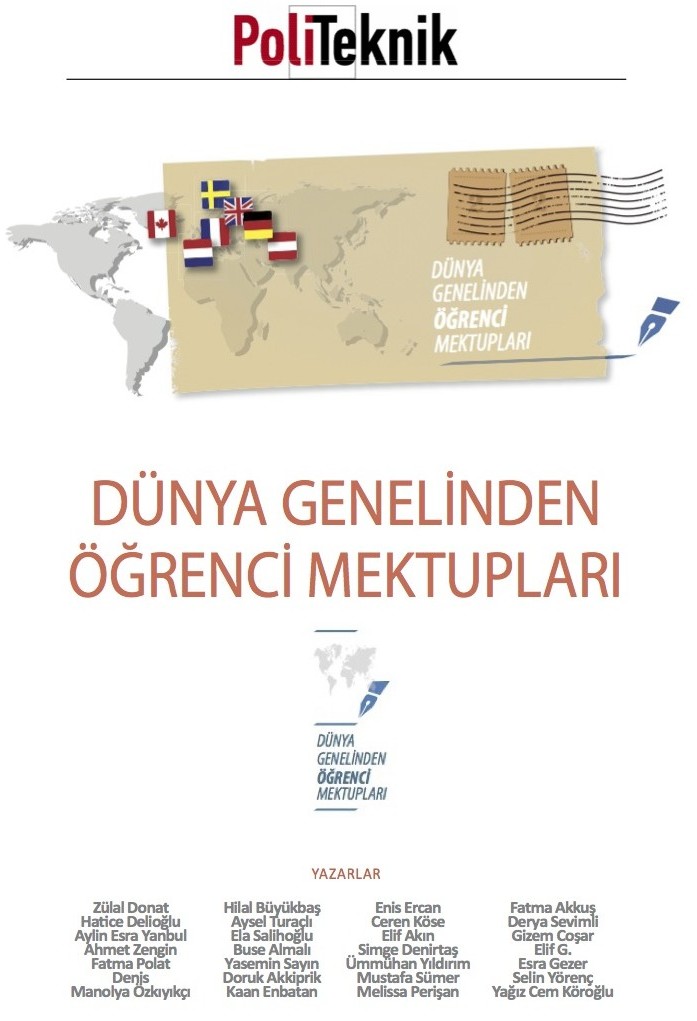Innerlichkeit ist ein Begriff, mit dem die Deutschen lange Zeit eine nationaltypische Eigenschaft ihres Wesens und ihrer Kultur bezeichneten. Heute weckt dieser Begriff eher negative Assoziationen. Der Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff, der selber zu den Repräsentanten der deutschen “Kultur der Innerlichkeit” zählt, schrieb einmal: “Die deutsche Nation ist die gründlichste, innerlichste, folglich auch die beschaulichste unter den europäischen Nationen, mehr ein Volk der Gedanken als der Tat. Wenn aber die Tat nichts ist ohne den zeugenden Gedanken und nur erst durch den Gedanken ihre weltgeschichtliche Bedeutung erhält, so dürfen wir wohl sagen, daß diese beschauliche Nation dennoch eigentlich die Weltgeschichte gemacht hat. Dieser Hang, die Dinge in ihrer ganzen Tiefe zu nehmen, scheint von jeher der eigentliche Beruf der germanischen Stämme zu sein”.
In diesem Zitat verbindet sich die zutreffende Beschreibung eines historischen Sachverhalts mit nationaler Arroganz auf eine Weise, wie sie im deutschen Schrifttum des 19. Jahrhunderts und danach bis in die Hitler-Zeit allenthalben zu finden ist. Die Sätze wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben, als die Deutschen sich einerseits noch mit Shakespeares Hamlet verglichen, in dem sie einen zur Tat unfähigen Geistmenschen sahen, während sie andererseits bereits das Gefühl hatten, anderen Nationen geistig überlegen zu sein. Heute würde niemand in den Exportweltmeistern eine zum “Beschaulichen” neigende “Innerlichkeit” vermuten, doch die “Gründlichkeit” wird noch immer für einen Grundzug der Deutschen gehalten, zumindest nehmen sie selber diese Eigenschaft für sich in Anspruch; und auch “Tiefe” ist ein Wert, der bei ihnen weit oben rangiert. Nun sind nationaltypische Eigenschaften nichts, was sich von einer Generation zur nächsten ausbildet und dann wieder verschwindet. Es sind Verhaltensweisen und Wertnormen, die der Einzelne mit der Muttermilch aufnimmt, so dass sie bereits angelegt sind, bevor Erziehung und gesellschaftliche Verhältnisse sie weiter ausformen. Deshalb können solche Eigenheiten selbst dann fortbestehen, wenn sie den aktuellen Verhältnissen nicht mehr entsprechen. Die heutigen Deutschen mögen noch so hart arbeitende, weltzugewandte und praktische Realisten sein, sie haben dennoch, ohne sich dessen bewusst zu sein, Haltungen und Wertnormen verinnerlicht, die eine ganz andere, anachronistisch anmutende Seite ihrer Mentalität darstellen. Bei einem Blick auf die deutsche Kulturgeschichte wird man unschwer erkennen, dass es darin Dinge gibt, die als besonders charakteristisch hervorstechen, und solche, die durch Abwesenheit auffallen. So nimmt beispielsweise die Musik in der deutschen Kultur einen besonderen Platz ein, während alles, was Ausdruck von Urbanität ist, auffällig fehlt. Dazu zählen beispielsweise Komödien, Gesellschaftsromane und weltläufige Essayistik. Ganz besonders fehlt das tragende und alles durchdringende Medium urbaner Kultur, die Kunst der Rede, die z. B. in England schon früh an den Schulen in debating societies geübt wird und sich im Parlament oft eindrucksvoll entfaltet. Auch in Frankreich spielt Rhetorik eine zentrale Rolle. Beide Nationen haben darüber hinaus eine hochentwickelte Konversationskultur. In Deutschland glänzen weder die Politiker durch brillante Reden noch die Bürger durch geistreiche Konversation. Da die Deutschen bis zur Reichsgründung von 1871 keine Hauptstadt hatten, die eine mit London und Paris vergleichbare Urbanität hätte entwickeln können, fehlt in ihrer Kultur das, was sich in Kaffeehäusern, Clubs, auf Rennbahnen und selbst in Bordellen ausbildete: das Leichte, Frivole, Geistreiche und Elegante. Im 19. Jahrhundert gab es nur einen wahrhaft urbanen deutschen Dichter, Heinrich Heine, der es bezeichnenderweise in Deutschland nicht aushielt und nach Paris emigrierte. Während die Franzosen Esprit zu einem Leitwert entwickelten und die Briten sich für Humor und Commonsense entschieden, setzten die Deutschen, bei denen das protestantische Pfarrhaus mehr Einfluss ausübte als die Kaffeehäuser, auf “Geist” und “Gemüt”. Noch heute stehen diese beiden Begriffe bei ihnen hoch im Kurs. Das brachte ihnen den Ruf ein, schwerblütig, ernsthaft und humorlos zu sein. Wahrscheinlich war es aber nur das Fehlen von Urbanität, was sie veranlasste, mit Goethes Faust zu den Müttern in die Tiefe zu dringen, statt sich in die gesellschaftliche Breite zu entfalten. Auf ihrer höchsten Ebene ist die deutsche Kultur kosmopolitisch, auf den unteren Ebenen blieb sie provinziell. Darum ist es kein Wunder, dass die Musik für sie so wichtig wurde; denn die ist eine Weltsprache, die die gesamte Menschheit erreicht, während gleichzeitig die deutsche Volksliedkultur ein provinzielles Verlangen nach “Gemütlichkeit” befriedigt. Nicht ohne Grund sieht man im Ausland in diesem Verlangen etwas typisch Deutsches, wofür in der englischsprachigen Welt sogar das deutsche Wort “gemütlich” als Fremdwort gebraucht wird. 1935 schrieb der Philosoph Helmuth Plessner, der wegen seiner jüdischen Abstammung 1933 zunächst in die Türkei und bald darauf in die Niederlande emigrierte, im dortigen Exil das Buch “Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche”, das 1959 unter dem Titel “Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes” neu herauskam. Darin heißt es: “Eine Kultur ohne weltanschauliche Tiefe, ohne den persönlichen Einsatz aus ihr und für sie ist in deutscher Selbstauffassung undenkbar. In diesem spekulativen Bekennertum bleibt sie, wenn auch indirekt, protestantisch. Darum bevorzugt die deutsche Kultur der Neuzeit Musik und Philosophie als ihre Ausdrucksgebiete, welche bedeutsamerweise diesen Zug miteinander gemeinsam haben, daß sie im Konflikt mit der normalen sprachlichen Mitteilung liegen. Das Eigentliche der Musik läßt sich in Worten nicht sagen. Vokalmusik ist immer an der Oberfläche. Sie erlebte ihre Blüte in Italien, nicht in Deutschland. Erst da, wo die Rede verstummt, beginnt die Musik. Und erst da, wo die Rede zerbricht, dann, wenn sie der über alles hinweggleitenden Mitteilung entrissen und zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wird, beginnt die Philosophie.” Hier findet man das Wesen der deutschen “Kultur der Innerlichkeit” auf typische Begriffe gebracht: “spekulatives Bekennertum”, “Protestantismus”, “Instrumentalmusik” und “Philosophie”. Unausgesprochen schwingt in der Abwertung der “Rede” aber auch die Anti-Aufklärungs-Haltung mit, die nach Kant in Deutschland immer mehr an Boden gewann. Das “Eigentliche” – Adorno schrieb eine gegen Heidegger gerichtete Schrift unter dem Titel “Jargon der Eigentlichkeit” – ist aus deutscher Sicht etwas, das sich der Rede und damit der rationalen gesellschaftlichen Kommunikation entzieht. Es liegt unter der “Oberfläche”, auf der Plessner die Vokalmusik sieht, folglich in der Tiefe, also dort, wo der deutsche Geist glaubte das Hausrecht zu haben. In einem letzten Aufbäumen gegen die als Bedrohung empfundene Verwestlichung hatte Thomas Mann noch im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs seine “Betrachtungen eines Unpolitischen” publiziert, in denen er aus seiner konservativ-royalistischen, antidemokratischen Haltung keinen Hehl machte, als er das dem deutschen Wesen und der deutschen Geschichte gemäße Kulturideal auf die Formel “machtgeschützte Innerlichkeit” brachte. Für ihn hatte nur Deutschland eine Kultur, die diesen Namen verdient, während die liberaldemokratische Kultur des Westens, vor allem diejenige Frankreichs, bloße Zivilisation war. Die besondere Pikanterie seiner Polemik liegt darin, dass sie gegen den eigenen Bruder Heinrich gerichtet war, der in seinen Augen ein Repräsentant und Anwalt der zum Trivialen tendierenden Verwestlichung war. Von dieser früheren Selbsteinschätzung ist bei den heutigen Deutschen nur noch wenig zu spüren. Die “Spekulation” hat selbst bei Fachphilosophen ausgedient, “protestantisches Bekennertum” sucht man vergebens, und in der Musik ist Deutschland, obwohl es die höchste Dichte an Sinfonieorchestern und Opernhäusern in der Welt aufweist, nicht kreativer als andere Nationen. Bei den Worten “machtgeschützte Innerlichkeit” dürften sich selbst bei den Älteren, für die Demokratie noch keine politische Selbstverständlichkeit war, die Nackenhaare sträuben. In ihrem Alltagsverhalten sind die heutigen Deutschen nüchterner als fast alle ihre europäischen Nachbarn, was sich allein schon darin zeigt, dass ihnen jegliches patriotisches Pathos fehlt. Doch unter der rauen, zuweilen geradezu ruppigen Schale ihrer Nüchternheit steckt immer noch die romantische Sehnsucht nach einer gemütlichen Innenwelt. In Biergärten, bei Familienfesten und erst recht im Karneval wird diese Sehnsucht auf eine Weise befriedigt, die in den Augen von Engländern und Franzosen etwas Provinzielles hat. Auch die weltbürgerliche Seite der deutschen Innerlichkeit ist noch deutlich zu spüren. Anders als die Franzosen, die ihr urbanes Franzosentum am liebsten mit einem nationalen Schutzwall umgeben würden, nehmen die Deutschen die Kultur des Auslands, vor allem des englischsprachigen, begierig auf, auch wenn es sich dabei um eine Einbahnstraße handelt; denn es werden erheblich mehr Bücher ins Deutsche übersetzt als umgekehrt. Auf dem “langen Weg nach Westen”, so der Titel des bekannten Buchs des Historikers Heinrich August Winkler, ist Deutschland inzwischen in der westlichen Kultur- und Wertegemeinschaft beinahe angekommen. Doch eine Jahrhunderte alte Prägung lässt sich nicht von heute auf morgen abstreifen. Bis auch die Deutschen zu einer urbanen Weltläufigkeit gefunden haben werden, wie man sie bei den westlichen Nachbarn antrifft, wird es noch eine Weile dauern. Man braucht nur einen Blick auf die deutschen Schriftsteller der Gegenwart zu werfen, um zu sehen, wie viele von ihnen sich in der Provinz eingerichtet haben. Günter Grass, Martin Walser, Botho Strauß und viele andere leben in ländlicher Idylle, und auch aus ihren Werken weht keine wirkliche Großstadtluft. Arno Schmidt, der anlässlich seines 100. Geburtstags in diesem Jahr erneut gewürdigt wird, ist ein geradezu klassisches Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Weltbürgertum und Provinzialismus bei völliger Abwesenheit von Urbanität. Schmidts literarische Götter waren Edgar Allan Poe und James Joyce, während er selber in einem winzigen Dorf in der Lüneburger Heide lebte, von wo aus er wie ein Papst
literaturkritische Dekrete erließ, was einer gewissen Lächerlichkeit nicht entbehrte. Allerdings – das sollte nicht verschwiegen werden – hat das Provinzielle auch gute Seiten. Wohl hat die neue/alte Hauptstadt Berlin noch nicht die normsetzende Ausstrahlungskraft, die Paris oder London haben, doch die vielen kleinen Hauptstädte der früheren Kleinstaaten sorgen dafür, dass so gut wie jeder Bürger, wo immer er in Deutschland leben mag, in weniger als zwei Autostunden ein Theater, ein Opernhaus, eine Konzerthalle, eine Universität und ein Museum erreicht. Um diese kulturelle Vielfalt und ihre gleichmäßige regionale Verteilung wird Deutschland von vielen anderen Nationen zu Recht beneidet, wobei als weiteres Plus hinzukommt, dass die Konkurrenz zwischen den größeren dieser Städte wie Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Leipzig und Dresden möglicherweise noch mehr produktive Kräfte freisetzt als die geballten Kultur-Arenen der großen Metropolen der Welt.