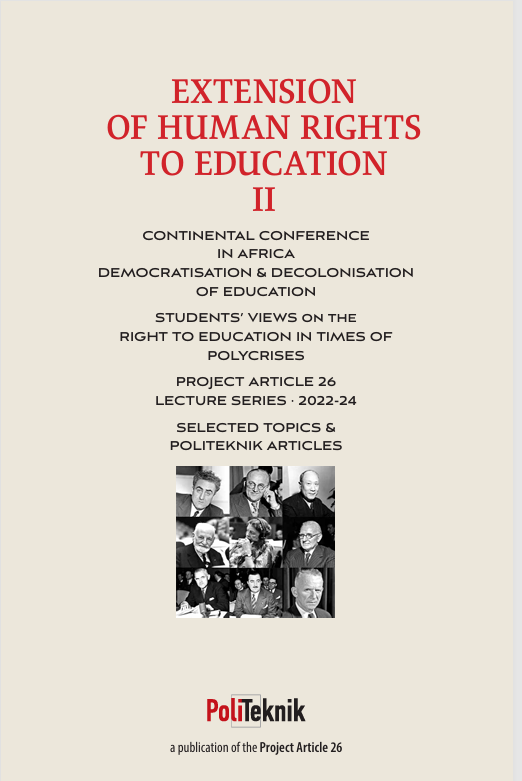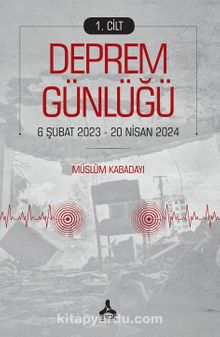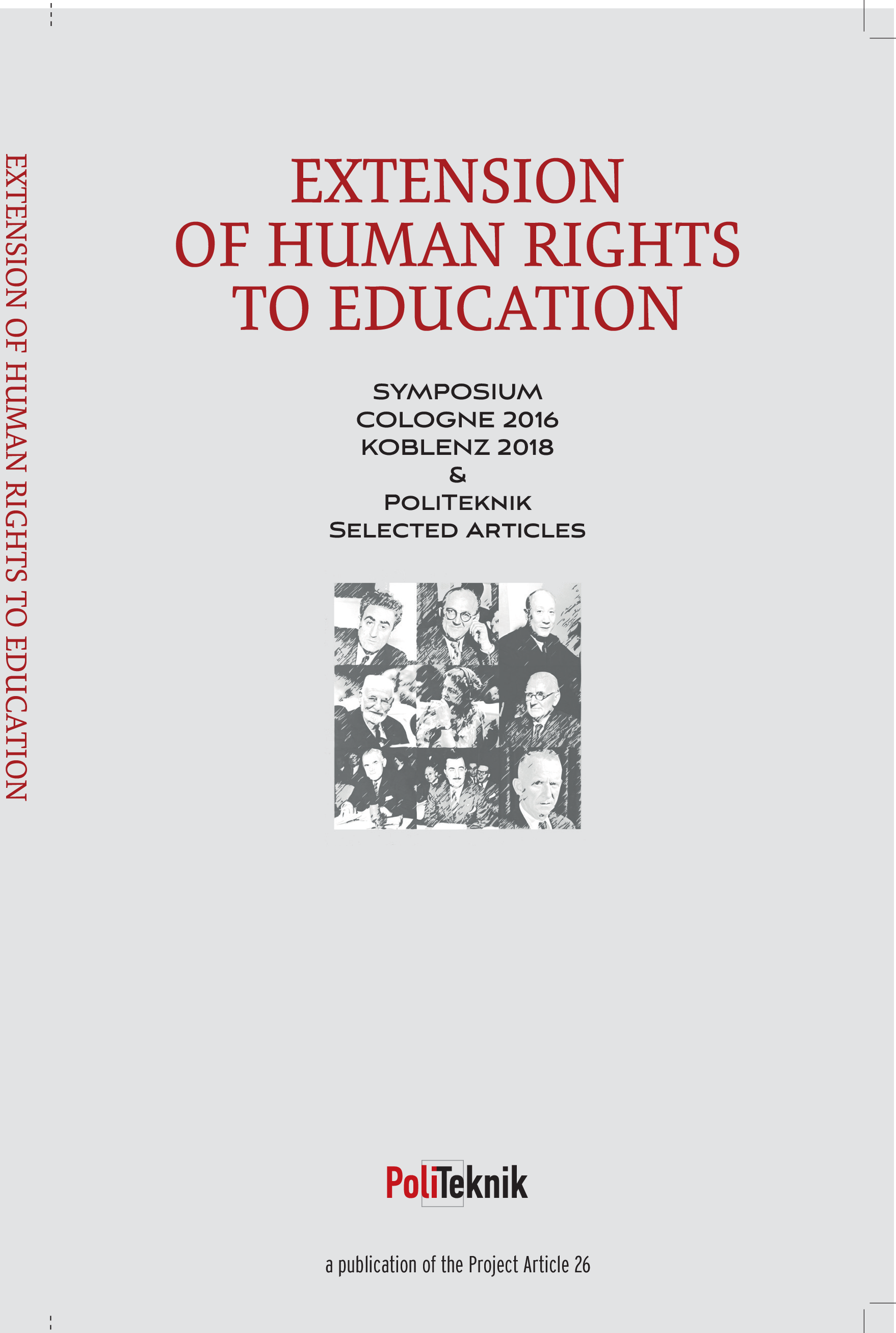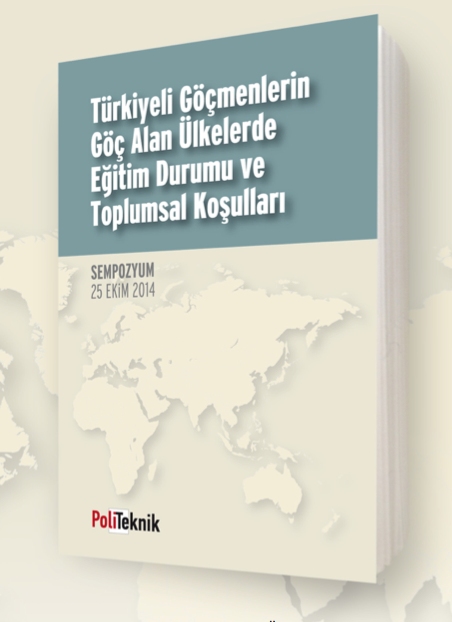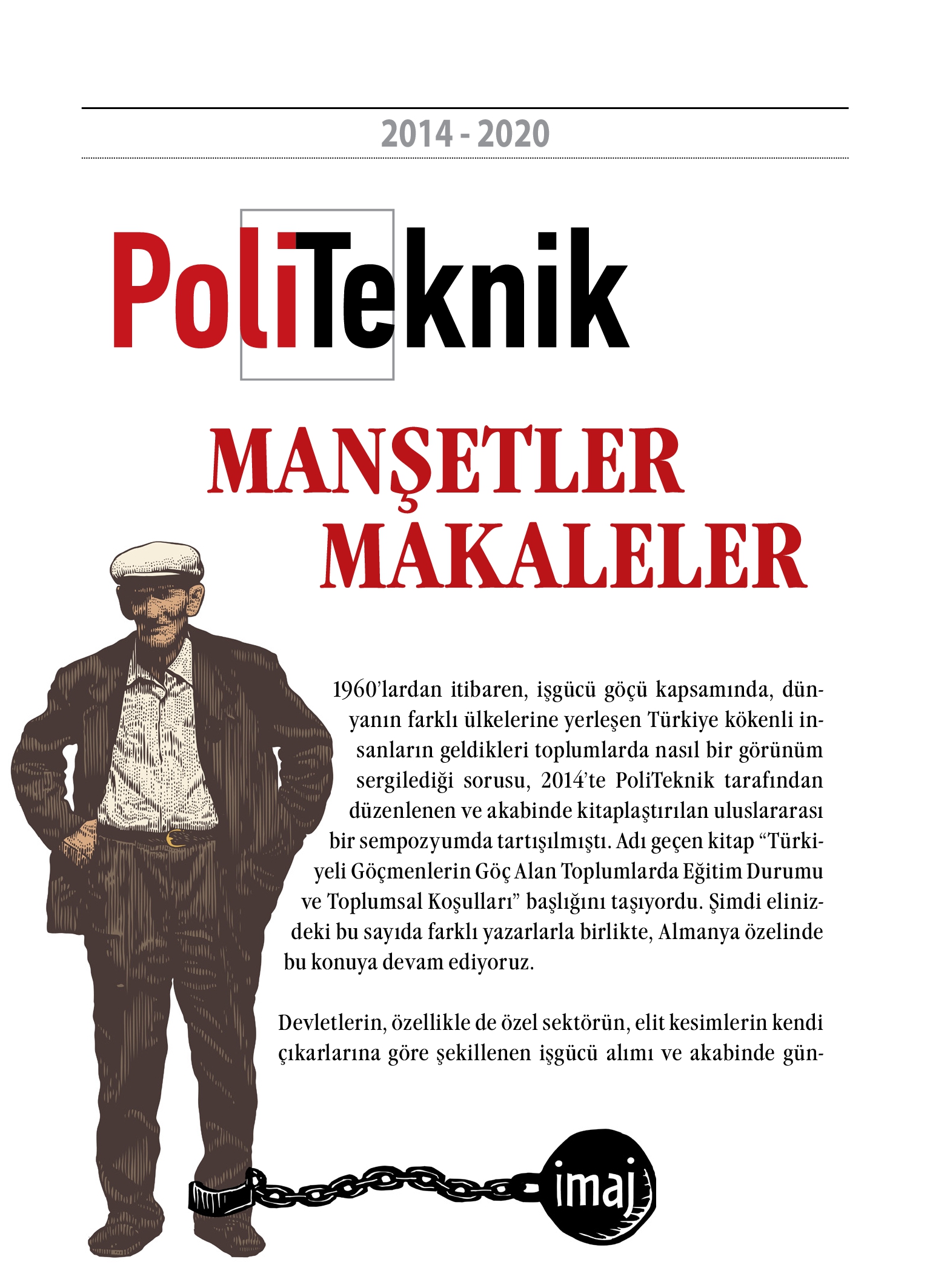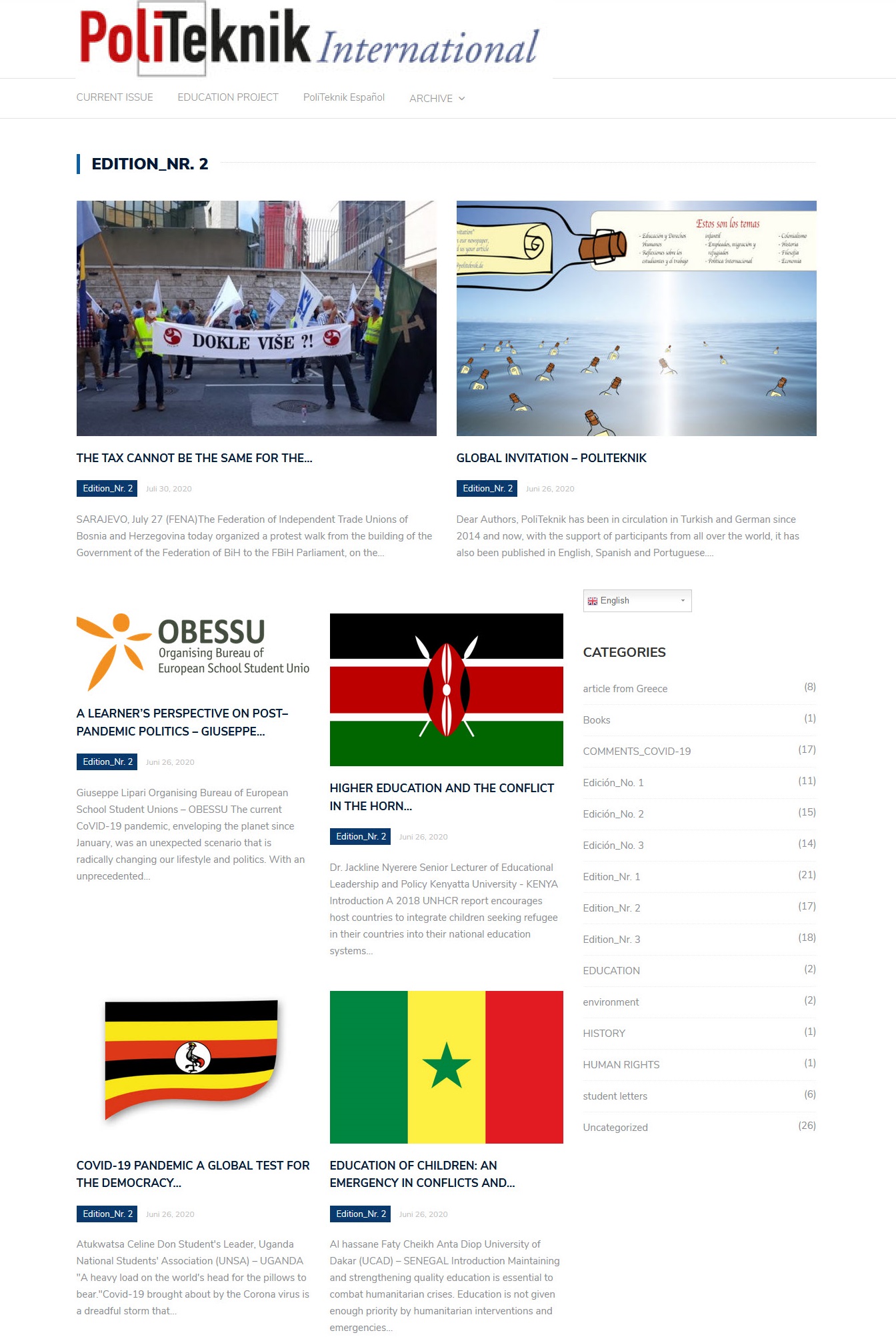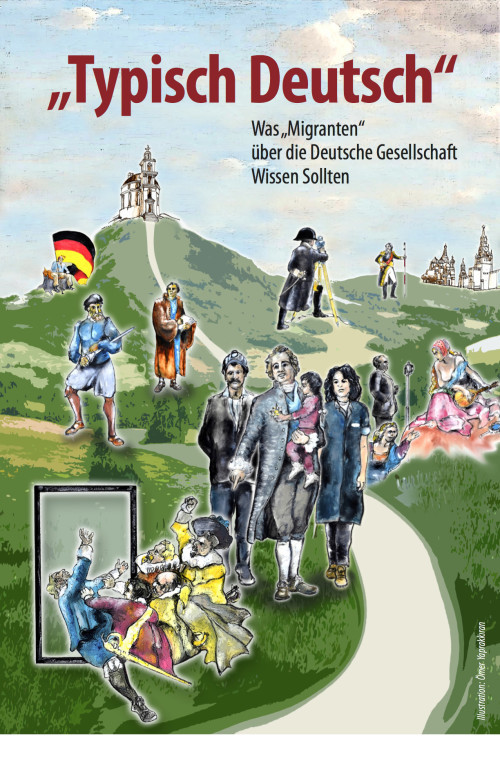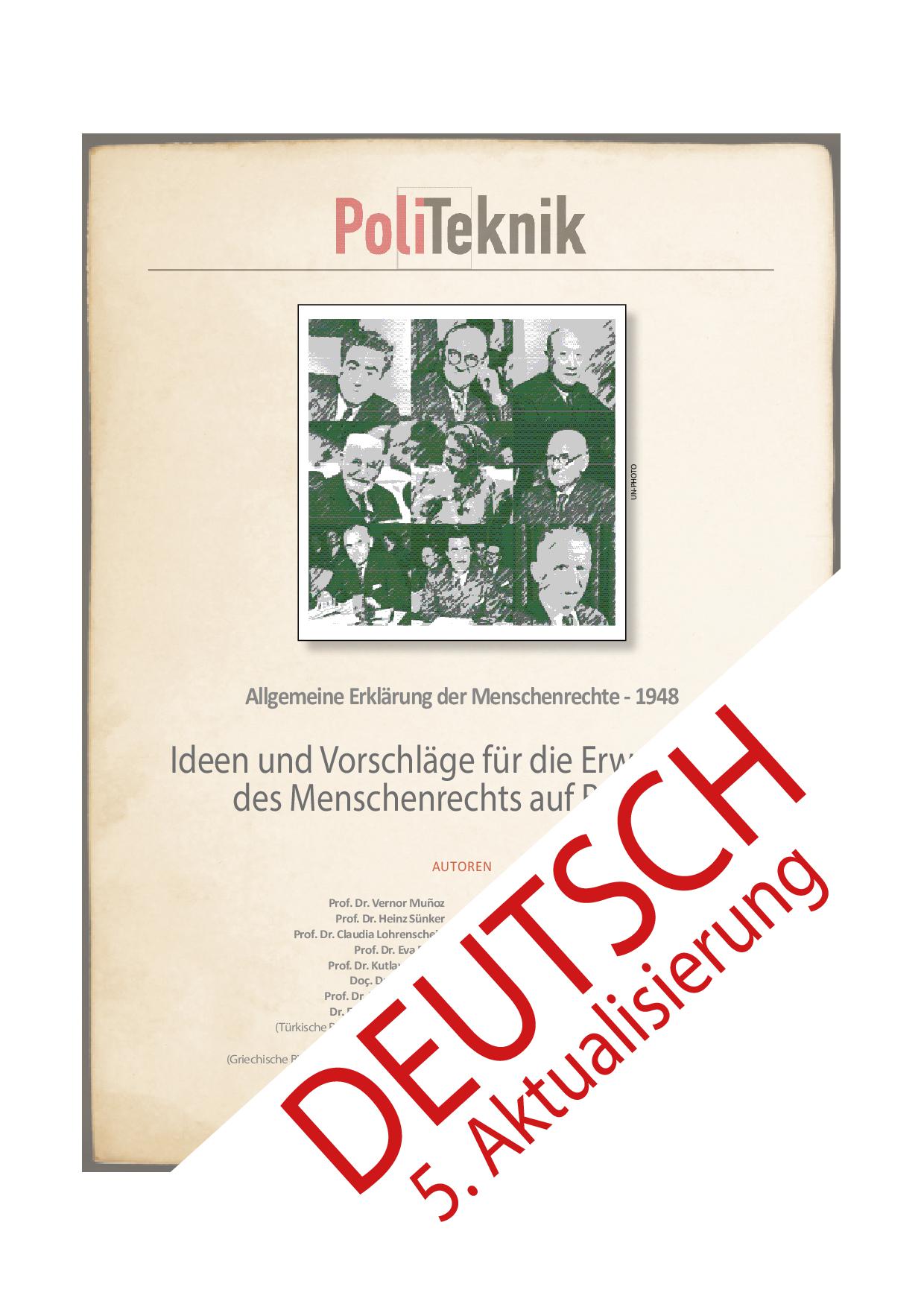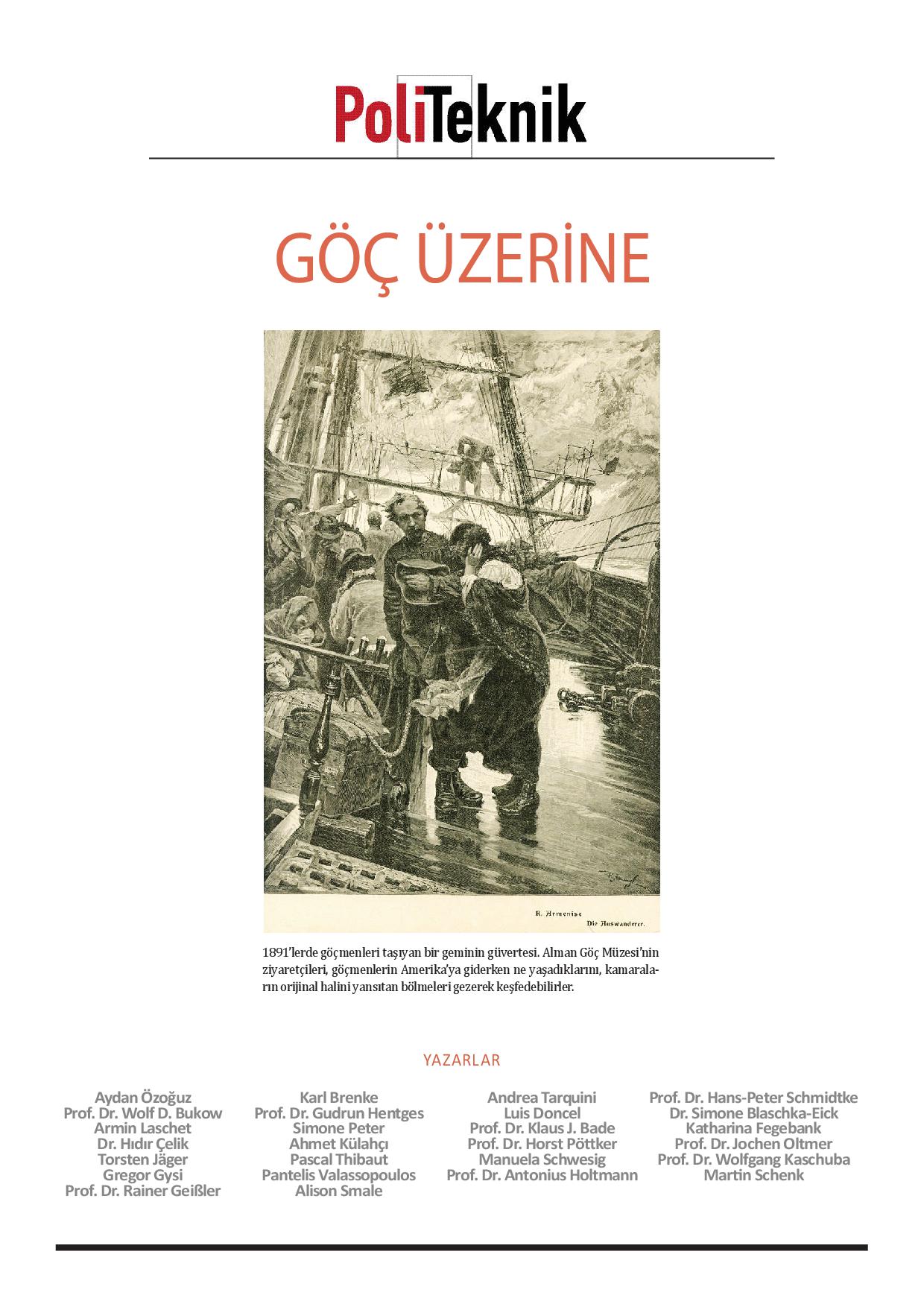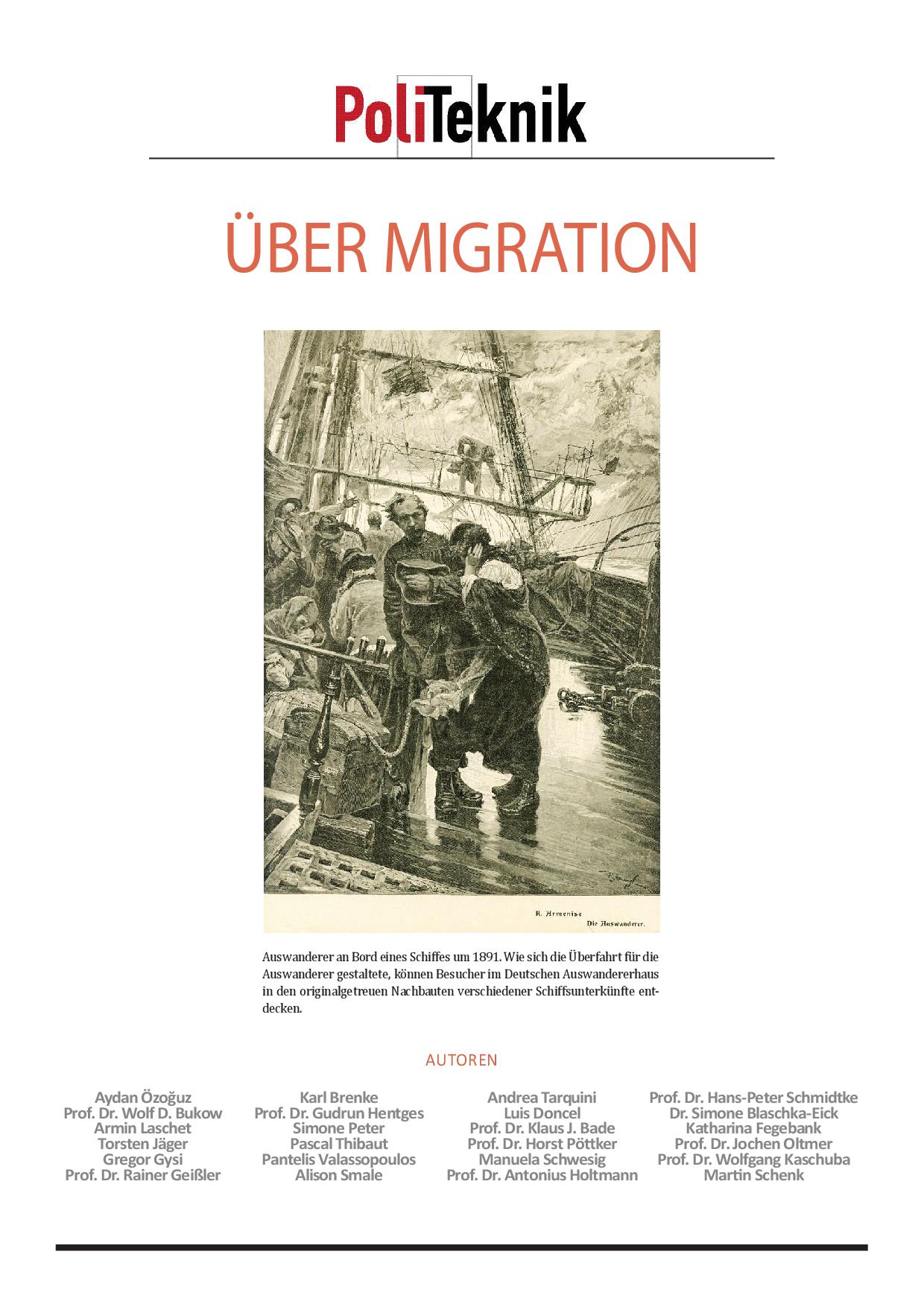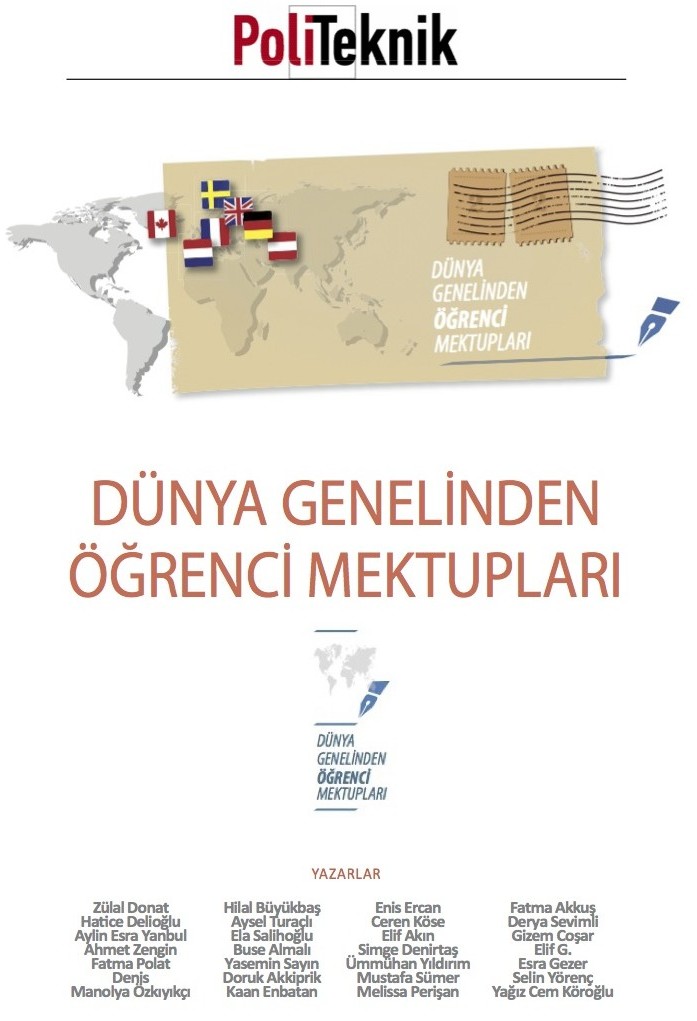Das Thema Stadt und Land ist wahrhaftig nicht für Deutschland reserviert. In fast allen Staaten dieser Erde gibt es einerseits Städte und andererseits ländliche Ansiedlungen. Man kann auch die Unterschiede benennen, die praktisch überall mit diesen Wohnformen verbunden sind. In den Städten ist die moderne Entwicklung weiter fortgeschritten; Urbanisierung und Modernisierung werden oft direkt gleichgesetzt. Der Lebensstil in den Städten ist anders als der auf dem Land; die Verhältnisse sind komplexer; der Alltag ist bunter, aber auch verwirrender. Aber das sind nur sehr allgemeine Charakterisierungen. Bei näherem Zusehen stellt man rasch fest, dass sich das Verhältnis von Stadt und Land in verschiedenen Ländern und Regionen sehr stark unterscheiden kann.
Das hängt zum Teil mit den natürlichen Voraussetzungen zusammen. Es gibt Gebiete, in denen weite Flächen unfruchtbar sind und auch jede Ansiedlung verbieten; man denke an die Wüsten, aber auch an Gebirge, große Wälder, Steppen und Moore. Und es gibt andererseits Erdregionen, in denen verschiedene Formen der Agrikultur in fast allen Teilen möglich sind, in denen deshalb überall ländliche Siedlungen entstanden sind. In diesem Fall spielt der ländliche Raum, wie die offizielle Bezeichnung heißt, eine wichtige Rolle. Das gilt für Deutschland in besonderem Maße, und nicht nur aufgrund der recht günstigen natürlichen Voraussetzungen, sondern auch als Konsequenz historisch-politischer Entwicklungen.
Wie stark die Vergangenheit, die Geschichte auch noch die gegenwärtigen Strukturen und Lebensformen bestimmt, kann durch einen Vergleich deutlich gemacht werden.
Die dezentrale Struktur Deutschlands, das große Gewicht der einzelnen Bundesländer hat dazu beigetragen, dass es hier Provinz in ausgeprägter Form kaum gibt. Für die Bewohner eines oberbayrischen Dorfs ist Berlin weit weg – aber man orientiert sich ja auch nicht an der Bundeshauptstadt, sondern blickt zunächst einmal nach München. Deutlicher als in anderen europäischen Staaten hat sich in den deutschen Bundesländern ein Bewusstsein der Gemeinsamkeit und oft auch ein eigener Lebensstil herausgebildet; man kann das an den Speisekarten der Gasthäuser ablesen, die zwar auch allgemein beliebte deutsche und immer häufiger auch ausländische Speisen anbieten, in vielen Fällen aber die regionale Tradition betonen.
Für die Erklärung der Spezifik des ländlichen Lebens in Deutschland ist aber noch ein weiterer Sachverhalt heranzuziehen. Wir müssen dabei in der nationalen Geschichte noch weiter zurück gehen. Die Länder, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammenschlossen, bestanden damals erst relativ kurze Zeit; sie waren um 1800 entstanden, dirigiert von Napoleon, der damals eine Neuordnung Europas anstrebte und vor seiner Entmachtung auch weithin durchsetzte. Für den deutschen Raum bedeutete das einen besonders tiefen Einschnitt, denn bis zu dieser großen Gebietsreform hatte es hier nicht nur ein paar Dutzend, sondern Hunderte von selbständigen Herrschaften gegeben. Zu diesen Territorien gehörten größere Staatsgebilde, die später als die Kerngebiete der neu formierten Länder fungierten, aber auch viele kleine und manchmal geradezu winzige Herrschaftsgebiete, die oft nur wenige Ortschaften umfassten. Diese Gebiete wurden von weltlichen Herrschern regiert, zum Teil auch von geistlichen Herren, und es gab auch reichsstädtische Gebiete, in denen die städtischen Ratsherren regierten. Konkret bedeutete dies, dass die Bewohner eines Territoriums schon nach wenigen Kilometern auf Grenzen stießen, die ins „Ausland“ führten – tatsächlich war das eine durchaus übliche Bezeichnung für benachbarte Gebiete, auch wenn dort die gleiche Sprache gesprochen wurde und ganz ähnliche Verhältnisse herrschten. Teilweise gab es allerdings auch Gegensätze; innerhalb der Herrschaftsgebiete war die konfessionelle Zugehörigkeit einheitlich, da sie vom regierenden Oberhaupt bestimmt wurde, aber zwischen verschiedenen Territorien spielte der Gegensatz von katholisch und protestantisch eine wichtige Rolle.
Wenn von dieser Phase der deutschen Geschichte die Rede ist, wird fast immer die Zersplitterung beklagt, die mehrere Jahrhunderte – vom späten Mittelalter bis zur napoleonischen Ära – die Struktur und das Leben bestimmte; und in der Tat blieb die staatliche Konsolidierung der deutschen Nation auf der Strecke. Aber die kleinteilige Gliederung des Raums hatte auch positive Wirkungen. Überall entstanden kleine Zentren, in denen nicht nur regiert wurde, die vielmehr auch auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung einwirkten. Für das Verhältnis von Stadt und Land bedeutete dies, dass meistens eine große Nähe vorhanden war, dass also die bäuerliche Bevölkerung ständig Kontakt hatte mit den Städten und ihren Bewohnern in der nächsten Umgebung.
Das heißt nicht, dass die Lebensbedingungen im Dorf die gleichen waren wie in der Stadt, und das Verhältnis zwischen den Städtern und den Bewohnern des ländlichen Raums war auch keineswegs spannungsfrei. Es war auch nicht einheitlich, sondern es gab verschiedene landschaftliche Traditionen. Viel hing von der Größe der Städte ab, von denen manche eine differenzierte Gliederung und eine anspruchsvolle, elitäre Kultur aufwiesen, während andere sich in ihrem Zuschnitt von den Dörfern in ihrem Umfeld nur wenig unterschieden. Und es bestanden auch gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Dörfern. Sie waren zwar alle bäuerlich geprägt, aber in manchen Gebieten – vor allem im Norden Deutschlands – verfügten die Bauern über ausgedehnte Ländereien, und diese Großbauern standen, was den Besitz und das Selbstbewusstsein anlangt, den Städtern gleichrangig gegenüber; in weiten Teilen Süddeutschlands dagegen gab es fast nur Kleinbauern, die mühsam um das tägliche Brot kämpfen mussten.
Diese Unterschiede werden hier eher vernachlässigt; dagegen sollen historische Entwicklungsetappen im Verhältnis von Stadt und Land kurz charakterisiert werden. Auch hierbei ist die Einschränkung zu machen, dass sich das konkrete Bild in verschiedenen Regionen unterscheidet, aber in einer groben Skizze bieten sich drei Entwicklungsphasen an: die deutliche Abwertung der bäuerlichen Bevölkerung und damit des ländlichen Lebens durch die Stadtbewohner; die Umkehr, also die betonte Hochschätzung der ländlichen Welt; und schließlich eine gewisse Neutralisierung, die Hand in Hand mit einer größeren Annäherung und einem immer stärkeren Austausch zwischen Stadt und Land erfolgte.
In alten historischen Quellen, aber auch in der älteren deutschen Literatur finden sich viele Belege für die Marginalisierung und manchmal Stigmatisierung der Bauern. Nicht nur die Angehörigen des Magistrats, auch die in den Städten konzentrierten Handwerker fühlten sich den Bauern überlegen. In den Schwankgeschichten, die mündlich erzählt und auch niedergeschrieben wurden, spielen Bauern und Bäuerinnen eine zentrale Rolle – aber fast nur als die Opfer, die von irgendeinem Herren (das kann ein Geschäftsmann aus der Stadt, aber auch ein Geistlicher, ein Akademiker oder ein Handwerker auf Wanderung sein) überlistet werden. Die Dummheit und der Aberglaube der bäuerlichen Bevölkerung werden in diesen Erzählungen ausgenützt; die Bauern zahlen für angebliche Wunderheilmittel viel Geld, sie verlieren schlau eingefädelte Wetten, und ihre Frauen sind schutzlos den Herren (auch den geistlichen) ausgeliefert. Das sind in den seltensten Fällen wahre Geschichten; aber in ihnen spiegelt sich die generelle Einschätzung. Diese Stoffe wurden Jahrhunderte lang erzählt und ausgeschmückt, vom hohen Mittelalter bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, und Reste davon sind immer noch lebendig – in Witzen spielen die Bauern und Bäuerinnen manchmal immer noch die Rolle der Ahnungslosen und Dummen, die sich in der modernen Welt nicht ohne Weiteres zurecht finden.
Von der allgemeinen Einschätzung weicht dieses Relikt aus der Welt der Witze jedoch ab. Ende des 18. Jahrhunderts begann sich eine geradezu gegensätzliche Einstellung zur ländlichen Welt und ihren Bewohnern durchzusetzen. Man deklassierte diese Welt nicht mehr, sondern sah sie in ihr eine Sehnsuchtslandschaft. Die Orientierung am einfachen Leben auf dem Land wurde zu einem wichtigen Bestandteil der deutschen Romantik. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts komponierte Ludwig van Beethoven seine 6. Sinfonie, die unter dem Namen Pastorale bekannt ist. Beethoven fügte in den Titel der Sinfonie „Erinnerungen an das Landleben“ ein, und er überschrieb den ersten Satz: „Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande“. Das war nicht nur ein Phantasiespiel – Beethoven quartierte sich tatsächlich bei Bauern in der städtischen Umgebung ein; er erfreute und erfrischte sich an dem Leben in der Natur und an der Naivität der ländlichen Bevölkerung. Diese romantische Einstellung entsprach zunächst einer eher elitären Haltung, die ihren Ausdruck vor allem in den Künsten fand – in der Musik wie auch in der Malerei und der Dichtung. Aber es kam bald zu einer durchgreifenden Popularisierung: In den Gesangvereinen wurden Heimatlieder gesungen, in denen die ländliche Natur gefeiert wurde; die Stadtbürger hängten Bilder von ländlichen Landschaften auf; Wandervereine entstanden, die an jedem Wochenende die ländliche Umgebung erkundeten. Die ländliche Bevölkerung war aber bald nicht mehr nur das Ziel und der Gegenstand städtischer Sehnsucht, sondern spielte aktiv mit; sie stilisierte sich in traditioneller Weise, es entstanden Vereinigungen, in denen alte Bräuche gepflegt und alte (oder auf alt gemachte) Trachten getragen wurden. Diese inszenierte ländliche Kultur wurde zu einer zusätzlichen Attraktion der städtischen Bevölkerung, die begeistert war von der vermeintlichen Ursprünglichkeit.
Lange Zeit, bis weit ins 20. Jahrhundert herein, blieb ein deutlicher Gegensatz von Stadt und Land bestehen. In der Stadt – und inzwischen waren ja wirkliche Großstädte entstanden – waren die industrielle Produktion und der Handel bestimmend, und sie war auch durch eine ausgedehnte Verwaltung und bürokratische Strukturen charakterisiert. Das Land dagegen war zwar nicht mehr ausschließlich Bauernland, aber die Dörfer und ländlichen Siedlungen waren immer noch ganz stark bäuerlich geprägt. Allmählich setzte aber ein gewisser Annäherungs- und Angleichungsprozess ein. Die Großstädte dehnten sich in die vorher rein ländliche Umgebung aus; in manchen Teilen Deutschlands wie im Ruhrgebiet wuchsen mehrere große Städte zusammen, sodass eine riesige Stadtlandschaft entstand. Aber auch in den meisten anderen Regionen kam es zu Ballungsräumen, in denen manche Dörfer aufgingen. Außerdem mussten für die gesteigerte industrielle Produktion räumliche Erweiterungsmöglichkeiten gefunden werden, die sich vor allem auf dem Land anboten. Und es kam auch zu einem Austausch der Bevölkerungsschichten. Dorfbewohner strebten in die Städte mit dem Blick auf Arbeits- und Einkaufschancen, aber auch wegen der größeren Möglichkeiten im Bereich von Bildung und Unterhaltung. Doch auch eine Gegenbewegung war zu registrieren: Städter zogen aufs Land, wobei neben dem Wunsch nach mehr Ruhe und der Liebe zur Natur auch ökonomische Überlegungen eine Rolle spielten – Wohnraum auf dem Land war und ist meist ganz erheblich billiger als der in der Stadt.
Beide Prozesse, Stadtflucht und Landflucht, sind nicht abgeschlossen. Der finanzielle Aspekt spielt bei der ländlichen Orientierung und Wohnungssuche junger Familien eine große Rolle; andererseits machen die wachsenden Verkehrsbehinderungen tägliche Fahrten in die Stadt beschwerlich und locken auch die besseren Schulangebote die Leute in die Stadt. Dieser Austausch und die partielle Angleichung haben dazu beigetragen, dass in die politischen Überlegungen zur Raumplanung und zur Gestaltung der Lebensverhältnisse grundsätzlich auch das Land einbezogen wird. Es ist ein Verfassungsauftrag der Bundesrepublik, dass gleichwertige Lebenschancen in Stadt und Land entwickelt werden. Dieser Auftrag kann nicht immer hundertprozentig erfüllt werden; die Stadt mit ihren differenzierten Strukturen und ihren ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bietet nun einmal größere Möglichkeiten in vielen Feldern. Und in manchen Dörfern haben sich gerade in jüngster Zeit die Verhältnisse verschlechtert: In manchmal schnell ablaufender Folge kommt es in kleineren Gemeinden zum Wegzug vieler Familien; die selbständige Verwaltung und damit das Rathaus verschwinden, zentrale Institutionen gehen verloren, das einzige Gasthaus macht zu, die Arztpraxis kann nicht mehr besetzt werden, das örtliche Ladengeschäft mit seinem bunten, aber doch relativ kleinen Angebot kann nicht konkurrieren mit den Supermärkten der Nachbarschaft – und so weiter. Im Blick auf solche Dörfer spricht man von der Gefahr, dass das Land leerlaufen könnte, und die Versuche der Gegensteuerung sind nicht immer erfolgreich.
Für weite Gebiete Deutschlands gilt allerdings ein positiver Befund. In den meisten Teilen der sogenannten alten Bundesländer hat sich das Ineinander, die wechselseitige Befruchtung von Stadt und Land bewährt und gehalten. In großen Teilen der neuen Bundesländer im Osten sieht es freilich anders aus. Hier ist die Abwanderung der Menschen aus dem ländlichen Raum sehr viel drastischer; die industriellen Arbeitsangebote fehlen vielfach, und der touristische Ausbau kann dies nur unvollkommen kompensieren. Was in den westdeutschen Bundesländern nur einzelne Gemeinden oder relativ kleine ländliche Gebiete betrifft, die Gefahr fortschreitenden Bevölkerungsrückgangs und des Absterbens wichtiger Lebensfunktionen des ländlichen Raums, bedroht im Osten Deutschlands weite Landstriche, ja ganze Bundesländer. Hier ist die Aufgabe, die Gleichwertigkeit von Stadt und Land zu sichern, die sonst nur ein geschicktes Ausbalancieren von Verwaltungsakten verlangt, sehr viel schwerer zu bewältigen. Sie fordert weitreichende politische Entwürfe und Entscheidungen, für die es bisher nur wenige Ansätze gibt.