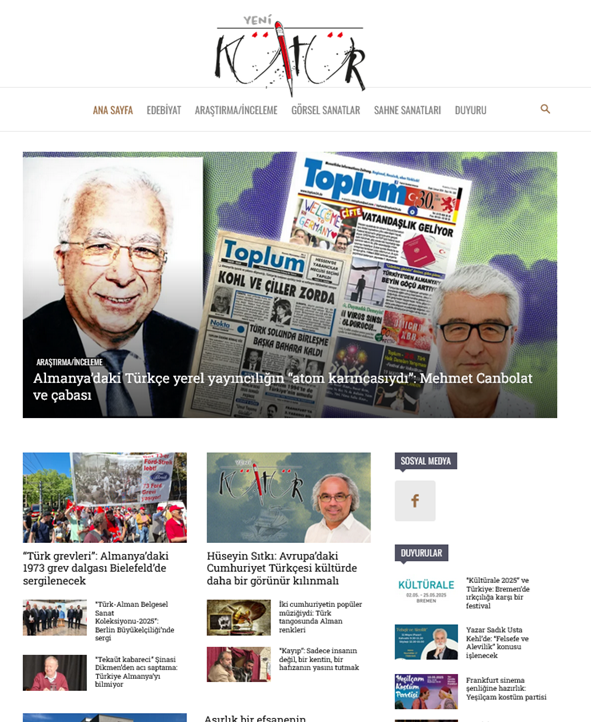Prof. Dr. Antonius Holtmann
Zahlen
Die Auswanderung aus der Landdrostei (vergleichbar einem Regierungsbezirk) Osnabrück im Königreich Hannover habe ich ausgewählt, weil ich mich vor allem mit ihr beschäftigt habe und weil die Zahl der nachweislich Ausgewanderten in den 1830er und 1840er Jahren einen Anteil an der deutschen Auswanderung von 11 % (1836) bzw. gut 14 % (1845) erreichte. 5,5 % betrug der Anteil Osnabrücker Auswanderung 1832-1840. 1841-1850 waren es noch 3.5 %, 1851-1866 nur noch 1,8 %. Aber nur ca. 1 % der Einwohner Deutschlands lebte in der Landdrostei Osnabrück.
Es war vor allem Auswanderung aus dem landwirtschaftlich genutzten Raum. Von 60630 Ausgewanderten (1832-1866) verließen nur 1209 (1,9 %) die Stadt Osnabrück (durchschnittlich 13500 Einwohner), während die 10 Ämter (vergleichbar heutigen Landkreisen) jeweils ca. 4500-9000 Ausgewanderte (Grafschaft Bentheim ca. 1500) aufzuweisen hatten. In jedem der erfassten 34 Jahre sind im Durchschnitt 1732 Menschen aus der Landdrostei Osnabrück ausgewandert, d. h. jährlich ca. 0.65 % bei im Schnitt 265000 Einwohnern. Sowohl die absoluten Zahlen als auch die prozentualen Anteile dürften geringfügig höher liegen, weil einige Berichte der Ämter fehlen, Volkszählungsdaten nicht vollständig erhalten sind und nicht wenige heimlich auswanderten. In den Jahren 1845, 1848 und 1852 wurden ca. 1,7 %, 1,8 % und 0,9 % erreicht, in manchen Kirchspielen auch darüber hinaus. Auf Altersgruppen und Ämter bezogen ergeben sich unterschiedliche absolute Zahlen und prozentuale Anteile. Unter den 1832-1866 aktenkundig gewordenen 60630 Ausgewanderten waren 15298 allein reisende Männer, 11071 allein reisende Frauen und 34261 Personen, die wohl 7992 Familien zugeordnet werden können.[1]
Strukturen, Institutionen, Motive
Die meisten sind also hier geblieben, trotz den für alle gültigen Lebensbedingungen, die sich als strukturelle Grundlagen, institutionelle Absicherungen und individuelle Anlässe und Motive, die angestammte Heimat zu verlassen, benennen und zu „Migrationstheorien“ abstrahieren und zuordnend verdichten lassen. Da mag man das Gewicht legen auf die Strukturen, auf die Institutionen oder auf die individuellen Motive: Verfehlt ist keiner dieser Zugriffe, wenn man sie nicht verabsolutiert. Am Ende entscheiden doch die einzelnen Personen und deren Wahrnehmungen der jeweiligen Lebensumstände über die je eigenen Akzentuierungen, was immer auch Wissenschaftler verallgemeinernd zu Papier bringen mögen.
Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert hatten sich im Osnabrücker Land die feudalen Besitzverhältnisse stabilisiert. Grundherren (Adel, Kirche, Städte, Bürger) waren die Eigentümer des Bodens, der von den Colonen (Bauern) bewirtschaftet wurde.
Diese grundlegende Struktur wurde institutionell, d.h. rechtlich, auch gewohnheitsrechtlich, und durch verfestigte akzeptierende Mentalitäten abgesichert.
Die bäuerliche Bewirtschaftung blieb in der Regel in Erbfolge der jeweiligen Familie erhalten. Der jüngste Sohn (seit 1722) erbte, mit Vorrang vor den Töchtern, das unteilbare Colonat. Über die Eigenbehörigkeit war er dem Grundherrn verpflichtet: Ohne dessen Zustimmung durfte er (sie) nicht heiraten, und wer in das Colonat einheiratete (Aufheirat), begab sich in die dem Colonat zugehörige Eigenbehörigkeit. Das bedeutete im Todesfall der verantwortlichen bewirtschaftenden Person Sterbfallsabgaben bis zur Hälfte des Privatvermögens des Verstorbenen , aber auch zu Lebzeiten Geldzahlungen und Dienstleistungen, vielfältige Naturalabgaben, vor allem aber die vorrangige Abgabe eines Zehntels (Zehnt) der Ernte auf den zehntpflichtigen Böden, deren Bewirtschaftung vom Grundherrn vorgeschrieben werden konnte. All diese Belastungen machten bis zu 30 % des Rohertrages aus. Hinzu kamen die vielfältigen Betriebsausgaben, die der Colon zu tragen hatte. Reich wurden nur wenige; viele waren verschuldet.[2]
Colonate waren auch verschuldet, weil abgehenden Söhnen und Töchtern bzw. Geschwistern ein Erbteil/eine Mitgift zustand. Wer von diesen das den gesellschaftlichen Stand und dessen Standesbewusstsein sichernde Ziel, in ein Colonat einzuheiraten, nicht erreichte, begnügte sich mit der Einheirat in eine Kleinbauernstelle, blieb unverheiratet auf dem Hof des Erben, verdingte sich, ledig bleibend, als Knecht oder Magd oder sicherte sich ein „Dach über dem Kopf“,eine Heuerstelle, die Eheschließung zuließ, weil Pacht und Nutzung eines kleinen, ärmlichen, landwirtschaftlich genutzten Anwesens (Heuerhaus) auf einem Colonat dies erlaubten. Schweine und Schafe und auch mal eine Kuh konnten dort gealten werden. Willkürlich vom Colonen eingeforderte Arbeit war dafür zu leisten, neben geringfügigen, aber schwer zu erarbeitenden Zahlungen, und willkürlich konnte der Pachtvertrag auch gekündigt werden.
Diese landlose Bevölkerungsschicht musste hinzu verdienen, um ihr Auskommen zu finden. Viele Männer gingen im Frühjahr in die Niederlande (Hollandgängerei), zwischen Einsaat und Ernte, in den Torfstich und in die Heuernte, während deren Frauen und Kinder auf den Colonaten dienten. Viele verdienten als Handwerker hinzu, vor allem in der Leineweberei, die sich im 18. Jahrhundert in den engen Heuerhäusern zur stabilen und für das Osnabrücker Land profitablen Protoindustrie entwickelt hatte, zur „dezentralisierten ländlichen arbeitsintensiven Warenproduktion für einen entfernten Markt“.[3]
Veränderungen
Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts, trotz Revolution in Frankreich (1789), erschien den meisten all dies als eine stabile Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur, die rechtsverbindlich institutionalisiert war und, in den sozialen Schichten mehr oder weniger bejaht oder wenigstens akzeptiert, auch weitgehend religiös gerechtfertigt war. Adel und Kirche bezweifelten nicht ihre Herrschafts- und Besitzansprüche, Colonen akzeptierten ihre relative Teilhabe, und Heuerleute fügten sich, meist noch gottergeben, in ihre prekären Abhängigkeiten und Knechte und Mägde ins bittere Los des ärmlichen Dienens.
Die Landlosen nahmen an Zahl zu aus eigener „Kraft“, aber auch durch die „Zuwanderung“ aus den Colonaten. Nur wenigen gelang der Aufstieg: Stagnation und „Abstiegsmobilität“ dominierten, zunehmend vom 18. zum 19. Jahrhundert.[4]
Dass sich die Gesellschaft „in fortschreitender Bevölkerung“ befinde, registrierte 1818 der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 1818, und dass sie gegen das „Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise“ keine Mittel aufzuweisen habe. Bei einem „Übermaße des Reichtums“ sei die „bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug,[…] dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern“.[5]
Hans-Ulrich Wehler vermutet „drei Hauptursachen“ für das Anwachsen der Bevölkerung:
– die „Ausdifferenzierung“ und „Kommerzialisierung“ der Landwirtschaft;
– die zunehmende Exportorientierung des „protoindustriellen Heimgewerbes“;
– die verbesserte „internationale Konjunktur seit dem Siebenjährigen Krieg“ (1756-1763).
„Das explosive Bevölkerungswachstum ist mit absoluter Vorrangigkeit ein Wachstum der ländlichen Unterschichten.“[6]
Im Osnabrücker Land reagierte man auf die sich abzeichnende Krise der feudalen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse so, wie Menschen, Politiker vor allem und Wissenschaftler auch, es in der Regel versuchen, und dies vor allem nach außen mit überzeugen wollender Selbstsicherheit. Man versucht, das Bestehende abzusichern, das Gewohnte zu rechtfertigen. Die Nutzung des überweideten und durch Plaggenentnahme (Dünger!) ruinierten Gemeindelandes, der Marken, wurde um die Jahrhundertwende den Colonaten parzelliert zugeschlagen, d.h. den Heuerleuten nun gänzlich entzogen (Markenteilung). Durch die hannoversche Domizilordnung von 1827 wurde die Heiratserlaubnis „vom Nachweis ausreichenden Besitzes oder aber gesicherter Arbeit und Wohnung“ abhängig gemacht in Verbindung mit einer Verschärfung der Mobilitätsbeschränkung meist auf den Geburtort, in dem man ein Heimatrecht besaß. Erst seit 1867/1868 gab es in der seit 1866 preußischen Provinz durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes „völlige Freizügigkeit“ und „völlige Freiheit der Eheschließung.“ Preußens „unbeschränkte Verehelichungsfreiheit“ wurde durchgesetzt.[7]
Die Stärkung der Colonate, auch nach Beginn ihres Freikaufs (Ablösung) seit 1831[8], die trotz zunehmender Verschuldung den Colonen mehr Selbstbewusstsein ermöglichte, verbesserte nicht die Lebensbedingungen der Heuerleute. Sie hatten jetzt nicht mehr mit eigenbehörigen, also auch abhängigen Bauern zu tun, und ihre Arbeitskraft war stärker gefordert denn je. Feudale Strukturen wurden modernisiert, und Modernität wurde durch verzögerte Industriealisierung hinausgeschoben. Was aus der Krise hinaus führen sollte, verstärkte sie.
Revolutionen veränderten Europa: Die amerikanische (1776), die französische (1789) und noch einmal eine französische (1831). Aber es hat in diesem Zeitraum keine deutsche Revolution gegeben, nur z.T. „defensive Modernisierung“, nachdem Napoleons Kontinentalsperre, seine nordwestdeutschen Annexionen (1807-1810) und seines Bruders Königreich Westfalen mit der Schlacht bei Waterloo (1815) eine Ende gefunden hatten.[9]
All dies hatte auch im Osnabrücker Land Spuren hinterlassen. Die belastende, aber bisher einträgliche Saisonarbeit in den Niederlanden (Hollandgängerei) brachte schon in den 20er Jahren nicht mehr viel ein. Seefahrt und Außenhandel hatten auch dort unter der Kontinentalsperre gelitten, und Bevölkerungswachstum war eine europäische Gemeinsamkeit. Vor allem aber konnten die verloren gegangenen Märkte für Osnabrücker Leinen nicht mehr zurückgewonnen werden. In England be- und verarbeitete Baumwolle trat nach und nach an die Stelle des Leinens und dies bald auch in deutschen Staaten, zunächst noch zaghaft in den „besseren Kreisen“ des Osnabrücker Landes. Der Preisverfall konnte schon in den 30er Jahren nicht mehr durch erhöhte Produktion wettgemacht werden, so dass gegen Ende des Jahrzehnts die Produktionsmenge zurück ging. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) setzte sich auch im Nordwesten die industrielle Flachs- und vor allem Baumwollverarbeitung und deren Versand mit Hilfe der Eisenbahn durch.[10]
Die Neue Welt
Im Osnabrücker Land begann die Auswanderung 1831/1832 in einem Ausmaß, dass die Landesregierung die Zahlen zu erfassen begann. Die zunehmenden wirtschaftlichen Nöte der Landlosen und der von Landlosigkeit bedrohten Colonen-Kinder drängten viele von ihnen zur gefürchteten Seereise in die verlockende Neue Welt, die Arbeit und fünf- bis zehnfachen Lohn versprach und Land vor allem und nicht zuletzt die „völlige Freiheit der Eheschließung“.
Erste Briefe berichteten davon, und mehr und mehr auch Zeitungen und Zeitschriften. „Etwas über Auswanderungen nach Nordamerika, insonderheit den vereinigten Staaten“ zu erfahren bot Der Oldenburgische Hauskalender oder Hausfreund auf das Schaltjahr 1833 an. Und wer z.B. Osnabrücks Neue Beiträge zum Nutzen und Vergnügen vom 14. April 1832 in die Hände bekam, stieß auf diesen Vergleich:
Dort – ruft der Auswanderer – reges heiteres Leben, Freiheit in Rede und Schrift,
Sicherheit vor Kriegen, Entledigung der Staatsschuld, Geringfügigkeit der
Abgaben, Unnötigkeit des Militärs, freundliche Geselligkeit und heitere
Aussichten in die Zukunft: – hier Beengung und Schranken; hohe Abgaben und Zölle,
Ständekasten und Scheidewände, stete Furcht vor dem Kriege und daher große und
kostbare Heermassen und trübe Blicke in die Folgezeit.[11]
Der Colonen-Sohn Johann Heinrich zur Oeveste hat es im zweiten Brief an seine Eltern und Geschwister in Rieste bei Bramsche am 30. September 1834 in einem Satz zusammengefasst: . . . weil es hier ein freies Land ist der eine gilt hier wie der andere es Respektiert hier auch keiner den andren.“[12]
Die Jahre von 1776 bis 1815 und die von Ihnen bewirkten politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen haben auch Mentalitäten verändert, selbst in den „untersten Schichten des Volkes“, in die „eine Masse von Kenntnissen und Fähigkeiten, von Begriffen und Ideen“ eingedrungen sei. Bernhard Wechsler, Landrabbiner in Oldenburg, hat es im Dezember 1846, am Vorabend der Revolution (1848/1849), im „Verein für Volksbildung zu Oldenburg“ vorgetragen, als er über „Die Auswanderer“ sprach:
Da nimmt dann auch die Empfindlichkeit und die Gereiztheit gegen die Mängel
und Gebrechen der gegenwärtigen Zustände zu, und was man sich sonst hat gefallen
lassen,[…] das wird jetzt eine drückende Last, die man sich nicht weiter will aufbürden
lassen. Der Schmerz über Ungleichheit, über Rechtlosigkeit, über wirkliche oder
vermeintliche Zurücksetzung, über Nichtbeachtung von Ansprüchen usw. steigert
sich in dem Maaße, in welchem die Empfänglichkeit für Recht und Gleichheit, für
Wahrheit und Menschenwürde zunimmt, in welchem diese Begriffe und Ideen
Gemeingut werden. […] Es ist daher nicht nöthig, daß das Maaß des Widerwärtigen,
Unvollkommenen an sich größer werde, […] es kömmt nur darauf an, daß es als
solches erkannt werde, daß in den Menschen der Gedanke immer lebendiger
werde, es sollte nicht so sein.[13]
Die Auswanderungswilligen wurden hinausgedrängt und zugleich angezogen: Push- und Pull-Faktoren nennen es die Migrationsforscher. In den alltäglichen Lebensverhältnissen zuhause und in den nicht risikolosen Chancen in der Neuen Welt erfahren, erahnen und erkennen nun viele die politischen Bedingungen ihrer Existenz. Auswanderung in die USA wird auch für die Regierten mehr oder weniger zum Politikum.
Auswanderungspolitik
Mit wohlwollender Zurückhaltung hat die Regierung des Königreichs Hannover ihre Auswanderungspolitik praktiziert. Die Staatsbürgerschaft wurde den Auswandernden nicht entzogen; sie wurden nicht staatenlos, behielten also das Heimatrecht in ihrem Herkunftsort auch für den Fall mittelloser Rückkehr, so lange sie nicht, frühestens nach 5 Jahren, die Staatsbürgerschaft der USA angenommen hatten. Einen Auswanderungkonsens benötigten nur junge Männer im wehrpflichtigen Alter. Dennoch auswandern zu dürfen bzw. zu können war nicht schwer. Gegen Bezahlung waren Stellvertreter für die 5 Jahre Wehrdienst (Losentscheid wegen Überangebot) leicht zu finden, und schließlich konnte man auch „bei Nacht und Nebel“ verschwinden. Makler und Schiffseigner in Bremen/Bremerhaven drückten schon mal ein Auge zu.
Hannovers Regierung richtete ihr Augenmerk aber sehr wohl auf die Anwerbung von Auswanderungswilligen. Die Agenten vor allem bremischer Makler bedurften der Lizenz, und Regierungsstellen versuchten, den Versprechungen „wilder“ Agenten einen Riegel vorzuschieben. In den Osnabrücker öffentlichen Anzeigen boten die anerkannten Agenturen die Dienste der Makler an. All dies trug dazu bei, Auswanderungwillige nicht zu entmutigen und die Bedenken besorgter Gemeindevertreter, sich um verarmte Rückkehrer kümmern zu müssen, zu reduzieren. Wer mit dem Gedanken an Auswanderung spielte, wurde nicht schon vorab, wie in der preußischen westfälischen Nachbarschaft (allerdings dort ohne nachdrücklichen Erfolg) von drohender Staatenlosigkeit als Rückkehrhindernis entmutigt. Das schaffte Platz für viele, die blieben, auf dem Arbeits- und auch zuweilen auf dem Heiratsmarkt.[14]
Weniger zurückhaltend und nur selten wohlwollend behandelte die Regierung des Königreichs Hannover „Verbrecher […], Landstreicher und ähnliche der Sicherheit gefährliche oder gemeinschädliche Personen“. 865 „Übersiedelungen“ in den Jahren 1836-1846 hat das Ministerium des Innern dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten eingeräumt. Gut 3000 dürften es von 1832-1866 gewesen sein. Darüber wurde offiziell geschwiegen, aber viele wussten davon, und zuweilen stand auch etwas in der Zeitung. Auch Gemeinden waren an der Finanzierung von Überfahrt, Einkleidung und Handgeld beteiligt. Wachsame Begleitung gab es bis Lehe bei Bremerhaven, und die Verbringung der „gemeinschädlichen Personen“, mit sauberen Pässen versehen, an Bord eines Schiffes, wurde möglichst unauffällig bewerkstelligt. Proteste aus den USA und bremische Einsprüche haben die hannoverschen Aktivitäten, wenn sie denn mal publik wurden, nur kurzzeitig unterbrechen können. Hinhaltend und ausweichend zu antworten schlug das Ministerium des Innern dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten im Jahre 1847 vor: Es sei „im Interesse der öffentlichen Sicherheit sehr zu beklagen, wenn die Übersiedelung solcher begnadigter Verbrecher nicht mehr thunlich sein sollte“, zumal durch diese Maßnahmen die „öffentliche Casse […] von einer nicht unerheblichen Ausgabe befreit“ werde. „Mörder, Räuber und Schwerverbrecher“ habe man in aller Regel nicht verschifft, auch wenn „es „Ausnahmen hiervon hin und wieder“ gegeben habe.[15]
Die Überzusiedelnden wurden „begnadigt“, verbunden mit dem Hinweis, bei Rückkehr wieder inhaftiert zu werden. Die Auswanderung wurde ihnen nahegelegt, nicht selten aber auch selbst beantragt. Denn auch die Entlassung in die Heimatgemeinde war hinreichend belastend. Die Domizilordnung (1827) gewährte nur dort ein Bleiberecht, und „Landstreicherei“ hätte wieder zur Verhaftung geführt. Man hätte es sehr schwer gehabt, in die sozialen Bezüge des Herkunftsortes positiv aufgenommen zu werden. Also war Amerika auch eine Chance für einen Neuanfang.
Da wird z.B. der 37 Jahre alte alkoholkranke Franz Joseph Schulte aus Hagen 1838 nach Amerika „transportiert“. Man hatte ihn wegen „Trunkenheit“ arrestiert, bei „Wasser und Brot“, und durch den Gefangenenwärter Verwold bekam er „12 Stockschläge gereicht“. Diebstahl kam hinzu und „Vagabondieren“. Er erklärt sich bereit, nach Amerika auszuwandern. Die Gemeinde Hagen und die Behörden in Osnabrück werden handelseinig in Bezug auf die Kosten: 37 Taler für die Passage, 4 Taler für „Utensilien zur Reise“ („Wollene Decke, gefüllter Strohsack, Blechernes Eß- und Trinkgeschirr, Taschenmesser, Gabel und Esslöffel, Seife und Handtuch, Tabak und Rasiermesser“), 2 Taler für die beaufsichtigende Begleitung nach Lehe und 9 Taler Handgeld für den Neubeginn in den USA. Am 21. August 1838 ist die „Triumph“ in Bremerhaven mit Franz Joseph Schulte an Bord „in See gegangen“, nach Baltimore.
Da werden z.B. die „Musikanten- und Zigeuner-Familien Böhmer und Tewitz“ 1839 aus Hunteburg nach Amerika „fortgeschafft“. „Sie vermehren sich wie die Monatstauben“ durch Inzucht und „Hurerey“, berichtete der Amtsvogt Meyer dem Amt Wittlage. Er würde es sich „stets zum Vorwurf machen, wenn er nicht Alles […] zur Fortschaffung dieser Zigeuner […] gethan hätte“. Für 1213 Taler war, so heißt es im abschließenden Bericht, das „arme Kirchspiel Hunteburg auf einmal von 19 unnützen und zum Theil gefährlichen Subjecten gesäubert“ worden. Einige Musikinstrumente gab man ihnen doch mit auf den Weg. Dafür zahlte man dem Instrumentenhändler Höffert in Osnabrück 22 Taler.
Da wird z.B. der Zuchthäusler Conrad Jansen aus Leer 1843 nach Amerika „übergesiedelt“. 6 von 10 Jahren hatte er noch abzusitzen. Er beantragte „die Auswanderung nach Westen“, um nicht wieder im Armenhaus zu landen und „auf der Bahn fortschreiten zu müssen, die ihn bereits in so großes Unglück gebracht“ habe. Das Criminal-Amt berichtet der Rentkammer: „Des Königs Majestät haben gnädigst geruht, den hiesigen Züchtling […] Conrad Jansen […] unter der Bedingung der Übersiedelung nach Amerika zu begnadigen“.[16]
Heimatliches im Gepäck
Die Ausgewanderten hatten auch ihr bisheriges Leben im Gepäck, zumindest Versatzstücke der Alten Heimat, die sich mehr oder weniger ins Neue einzufügen hatten. Sie zu bewahren, um Sicherheit im Ungewohnten zu gewinnen, war zunächst ihr Anliegen, am besten in ethnisch und konfessionell homogenen Siedlungen und/oder Organisationen. Die Norddeutsche Lutherische Kirche in Cincinnati/Ohio[17] ist ein beredtes Beispiel dafür.
Sie wurde auch „Osnabrücker Kirche“ und „Plattdeutsche Kirche“ genannt. Johann Heinrich zur Oeveste schrieb am 31. Oktober 1839 an seine Eltern und Geschwister in Rieste: „Die Deutschen-Lutherischen haben diesen Sommer eine schöne Kirche gebaut welche sie heißen die Norddeutsche Lutherische Kirche diese sind lauter plattdeutsche und haben sich von den Hochdeutschen welche merst kommen aus den südlichen Gegenden von Deutschland, getrennt“.[18] Im Streit hatte sich „Osnabrück und Umgebung“ von der „Deutschen Lutherischen und Reformierten St. Johannes-Gemeinde“ getrennt, des Glaubens (Union!) und der Sprache wegen, aber wohl auch, weil seit 1832/1833 die Osnabrücker Eingewanderten überhand nahmen und der Kirchenraum zu eng wurde. Osnabrücks Lutheraner grenzten sich ab durch § 10 der „Constitution“: „Niemand kann in den Kirchenrath gewählt werden, der der plattdeutschen Sprache nicht mächtig ist“. Die „Hochdeutschen“ Unierten konterten postwendend mit § 15 ihrer neuen „Verfassung“: „Um allen provinzialischen Vorurteilen vorzubeugen findet es die Gemeinde für notwendig, nur drei Gemeindeglieder aus einer Provinz zu wählen. Alle Norddeutschen zählen zusammen jedoch nur eine Provinz“.[19]
Die heimatliche Sprache und die Sprache Martin Luthers waren den Eingewanderten wichtig. Die St. Johannes-Gemeinde legte 1839 in § 2 ihrer „Verfassung“ fest: „Es soll in unserer Kirche niemals in englischer Sprache gepredigt werden, sondern für alle zukünftige Zeiten für deutschen Gottesdienst offen sein“. Ein wenig abgemildert hat es auch ein Ableger der „Plattdeutschen Kirche“, die „Deutsche Evangelische Lutherische St. Johannes-Gemeinde am White Creek“ bei Columbus/Indiana zu Beginn der 1850er Jahre in ihre „Constitution“ hineingeschrieben, dass nämlich, „solange noch drei Gemeindeglieder“ es wünschen, „jederzeit allein in der deutschen Sprache“ zu predigen sei. Erst am 11. Oktober 1903 beschloss die Gemeindeversammlung, „dass unser Pastor manchmal Englisch Predigen soll“.
Damit konnten wohl die meisten Gläubigen umgehen. Am 1. Oktober 1905 trugen John H. Hormann und H. F. Eckelmann ins Protokollbuch ein: „5ten Beschloß die Gemeinde das die zwei Öfen in die Kirche double drum sein sollten, und in die Schule were es nicht nötig so ein großer sondern single drum were groß genug. 6ten wurde beschloßen das die Fenster und sills auswendig painted werden und sollte grained werden.“.[20]
Von 1942 an, wenige Wochen nach der Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die USA (11. Dezember 1941), wird in St. Johannes nicht mehr in deutscher Sprache Gottesdienst gehalten. Das Sternenbanner steht nun neben dem Altar.[21]
Die Nachfahren der Osnabrücker Ausgewanderten waren jetzt endgültig in den USA angekommen. Ihre lutherische Gemeinde hatte ihren Vorfahren schon in der “Plattdeutschen Kirche” in Cincinnati und danach auch den folgenden Generationen in St. Johannes (St. John) am White Creek in Indiana nahezu 100 Jahre lang die Möglichkeit gegeben, im englischsprachigen Umfeld ”beheimatet” zu bleiben. Über Jahrzehnte fanden so zunächst vor allem die Männer und die Kinder mit Hilfe der Notwendigkeit, die englische Sprache zu benutzen und sie auch in der deutschsprachigen Gemeindeschule als “Fremdsprache” zu lernen, in die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Traditionen des angloamerikanischen Umfeldes hinein. Erleichtert wurde dies durch die amerikanische Gesetzgebung, die den in den USA Geborenen vom ersten Lebenstag an die amerikanische Staatsbürgerschaft verlieh. Als “Deutsch-Amerikaner” verstanden sich die meisten. Schon mit dem Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg (1917) gab man mehr oder weniger bereitwillig dem Druck nach, auch in den Gemeindeschulen weitgehend englischsprachig zu unterrichten und im Gottesdienst englisch zu predigen und den Bindestrich aufzugeben. Endgültig geschah dies im Zweiten Weltkrieg mit der Kriegserklärung Deutschlands an die USA (Dezember 1941) in den Jahren 1942/43. Der Bindestrich ist heute nur noch ein ethnische Reminiszenz.
Anmerkungen:
[1] Anne-Katrin Henkel: „Ein besseres Loos zu erringen, als das bisherige war.“ Ursachen, Verlauf und Folgewirkungen der hannoverschen Auswanderungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. Hameln 1996, S. 41, 216-218. – Karl Kiel: Gründe und Folgen der Auswanderung aus dem Osnabrücker Regierungsbezirk, insbesondere nach den Vereinigten Staaten, im Lichte der hannoverschen Auswanderungspolitik betrachtet (1832-1866). In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 61(1941), S. 86-176, hier S. 176. – Walter D. Kamphoefner: Westfalen in der Neuen Welt. Eine Sozialgeschichte der Auswanderung im 19. Jahrhundert. Göttingen 2006, S. 25.
[2] Karl Heinz Schneider/Hans Heinrich Seedorf: Bauernbefreiung und Agrarreformen in Niedersachsen. Hannover 1989, S. 22-31.
[3] Kamphoefner: Westfalen (s. Anm. 1), S. 28. – Franz Bölsker-Schlicht: Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterwanderung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Sögel 1987. – Franz Bölsker-Schlicht: Sozialgeschichte des ländlichen Raumes im ehemaligen Regierungsbezirk Osnabrück im 19. und frühen 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Heuerlingswesens und einzelner Nebengewerbe. In: Westfälische Forschungen 40(1990), S. 223-250.
[4] Jürgen Schlumbohm: Lebensläufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650-1860. Göttingen 1994, S. 55, 373: „Von den Kindern der
großbäuerlichen Eltern konnten knapp zwei Drittel sich den Status ihrer Geburt erhalten; fast ein Viertel stieg in die Heuerlingsschicht ab, den restlichen 11 % gelang es immerhin, auf eine kleinbäuerliche Stelle zu kommen. – Schlechter waren die Bedingungen für die Söhne und Töchter von Kleinbauern: über 40 % von ihnen blieben ohne Eigentum an Haus und Grund.“
[5] Zitiert nach Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Zweiter Band. Von der Reformära bis zur industriellen und politischen „deutschen Doppelrevolution“ 1815-1845/49. München 1987, S. 7.
[6] Wehler: Gesellschaftsgeschichte (s. Anm. 5), S. 8f..
[7] Schlumbohm: Lebensläufe (s. Anm. 4), S. 111. – Klaus-Jürgen Matz: Pauperismus und Bevölkerung. Die gesetzlichen Ehebeschränkungen in den süddeutschen Staaten während des 19. Jahrhunderts. Stuttgart 1980, S. 175, 178-181. – Schneider/Seedorf: Bauernbefreiung (s. Anm. 2), S. 83-101.
[8] Schneider/Seedorf: Bauernbefreiung (s. Anm. 2), S. 60-75.
[9] Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Erster Band. Vom Feudalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära 1700-1815. München 1987, S. 347-546.
[10] Kamphoefner: Westfalen (s. Anm. 1), S. 28-66.
[11] W. Hardebeck: Die Auswanderung nach Amerika aus unserer Gegend. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde des Hasegaues 14(1905), S. 24-37, hier S. 27f.. – Etwas über Auswanderungen nach Nordamerika, insonderheit den vereinigten Staaten. In: Der Oldenburgische Hauskalender oder Hausfreund auf das Schaltjahr 1833 7(1832). – Vgl. auch Bernd Jürjens: Das Amerikabild im Jahrhundert der Auswanderung. Untersucht am Beispiel der Oldenburger Presse von 1814-1875. In: Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde 76(2001)2, S. 227-245. (Verfügbar auf der Website www.dausa.de unter „Quelleneditionen“.)
[12] Antonius Holtmann (Hrsg.): „Ferner thue ich euch zu wissen . . .“. Die Briefe des Johann Heinrich zur Oeveste aus Amerika 1834-1876. Bremen 1996, S. 40. (Verfügbar auf der Website www.dausa.de unter „Veröffentlichungen“.)
[13] Bernhard Wechsler: Die Auswanderer. Ein Vortrag, gehalten im Verein für Volksbildung zu Oldenburg am 20. December 1846, mit einem Vorworte. Oldenburg 1847. (Verfügbar auf der Website www.dausa.de unter „Quelleneditionen“.)
[14] Antonius Holtmann: Auswanderungs- und Übersiedelungspolitik im Königreich Hannover 1832-1866. In: Kornelia Panek (Hrsg.): Schöne Neue Welt. Rheinländer erobern Amerika. Band 2. Wiehl 2001, S. 190-194. (Verfügbar auf der Website www.dausa.de unter „Veröffentlichungen“.)
[15] Holtmann: Auswanderungspolitik (s. Anm. 14), S. 195-199. – Zum bremischen Umgang mit eigenen und fremden Übersiedelungen vgl. Horst Rössler: Hollandgänger, Sträflinge und Migranten. Bremen-Bremerhaven als Wanderungsraum. Bremen 2000, S.193-260 („Unnütze Subjekte, Vagabunden und Verbrecher“ – Zur Emigration von Sträflingen in die Neue Welt (1830-1871)). – Vgl. auch Günter Moltmann: Die Transportation von Sträflingen im Rahmen der deutschen Amerikaauswanderung des 19. Jahrhunderts. In: Günter Moltmann (Hrsg.): Deutsche Amerikaauswanderung im 19. Jahrhundert. Sozialgeschichtliche Beiträge. Stuttgart 1976, S. 147-196.
[16] Holtmann: Auswanderungspolitik (s. Anm. 14), S. 200-210, hier S. 200-204.
[17] Holtmann: Ferner thue ich euch zu wissen . (s. Anm. 12), S. 50f.. – Wolfgang Grams: The North German Lutheran Church in Cincinnati. An “Osnabrück” Congregation. In: Reichmann/Rippley/Nagler (Hrsg.): Emigration and Settlement Patterns of German Communities in North America. Indianapolis 1995, S. 50-79.
[18] Holtmann: Ferner thue ich euch zu wissen. (s. Anm. 14), S. 48-52.
[19] Vgl. Anm. 17. – „Constitution“ und „Verfassung“ und die Kirchenbücher beider Gemeinden befinden sich auf Mikrofilm in der Forschungsstelle DAUSA.
[20] Antonius Holtmann: Die deutsche evangelisch-lutherische St. Johannes-Gemeinde am White Creek, Indiana. In: Paul Heinz Pauseback /Thomas Steensen (Hrsg.): AMERIFRISICA – Übersee-Auswanderung aus den drei Frieslanden und benachbarten Ländern. Bräist/Bredstedt 1996, S. 165-183, hier S. 174. – „Constitution“, Kirchen- und Protokoll-Bücher der White Creek-Gemeinde befinden sich auf Mikrofilm in der Forschungsstelle DAUSA. – Zum Sprachenproblem vgl. die sehr gründliche Auswertung der Kirchenbücher einiger Kirchengemeinden und der Schriften der Missouri-Synode in der Dissertation von Harro Eichhorn: Stellenwert und Funktion von Gemeinde, Pastor und Lehrer in Kirchengemeinden der Missouri-Synode des 19. und 20. Jahrhunderts. Auf den Alltagsspuren deutscher Auswanderer in Kirchenbüchern, Protokollbüchern und religiösen Periodika. Oldenburg 2006, S. 333-342. (Verfügbar auf der Website www.dausa.de unter “Veröffentlichungen”)
(http//docserver.bis.uni-oldenburg.de/publikationen/dissertation/2006/eicste06/eicste06.html)
[21] St. John, White Creek: History of the St. John Evangelical Lutheran Church. Columbus, Indiana 1990.
Die vollständige Fassung dieses Beitrages in verfügbar auf der Website der Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA (DAUSA): www.dausa.de unter “Veröffentlichungen”, auch in englischer Sprache unter „Publications“.