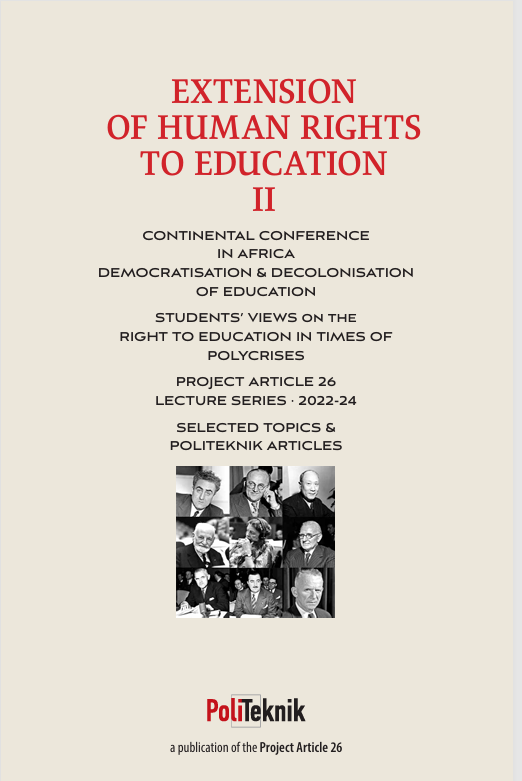Michael Winkler
(Universität Jena)
Was könnte typisch deutsch sein, wenn es um Familie und Erziehung geht? Bekanntlich lassen einen immer die zunächst harmlos erscheinenden Fragen verzweifeln. Will man sie nämlich ernsthaft beantworten, wären erst ein paar Gegenfragen zu stellen – was man ja eigentlich nicht tun darf, wenn man ordentlich erzogen ist. Die ersten würden lauten: Was ist denn überhaupt Erziehung? Und was ist eine Familie, wer gehört zu dieser? Die Antworten fallen gar nicht eindeutig aus, übrigens weder in Deutschland noch in den Ländern und Gesellschaften, aus welchen Menschen in dieses Land einwandern. Vor allem liegt das Problem jedoch darin, dass man für die Antworten auf ein paar sozialwissenschaftliche Einsichten zurückgreifen muss. Sie aber machen die Angelegenheit dann noch komplizierter, weil sich die Aufmerksamkeit darauf richten muss, worin eigentlich die die sozialen und pädagogischen Tatsachen bestehen, die eine Gesellschaft als solche tatsächlich auszeichnen – und zwar ganz unabhängig davon, was die Menschen sich im Verhältnis der Generationen vornehmen, was ihnen subjektiv wichtig erscheint, übrigens ganz unabhängig davon, wo sie herkommen. Die Aufmerksamkeit müsste sich also eigentlich darauf richten, was die objektiven gesellschaftlichen Tatbestände sind, die sich jenseits der subjektiven Hoffnungen und Erwartungen dann durchsetzen und das pädagogische Geschehen bestimmen.
Eine Gebrauchsanleitung für Deutschland in Sachen Erziehung, wie Paul Watzlawick solches Wissen genannt hätte, fehlt jedoch. Das hat viele Gründe, vielleicht kann es ein solches Wissen spezifisch für Deutschland gar nicht geben. Denn es gilt ein etwas widersprüchlicher Sachverhalt:
Zum einen könnte es nämlich sein, dass Erziehung, Familienerziehung insbesondere im Vergleich der Gesellschaften und Kulturen sich gar nicht so unterscheiden. Erziehung stellt eine universell anzutreffende Praxis dar, sie unterscheidet sich nur insoweit, als mit der Komplexität von Gesellschaften und Kulturen die Aufmerksamkeit für die Erziehung wächst. Es handelt sich also um anthropologische Aufgaben und Themen, wie sich übrigens noch daran erkennen lässt, dass in allen Gesellschaften der Welt Eltern stets das Beste für Ihre Kinder wünschen und wollen. Selbst verzweifelte Flüchtlinge haben fast immer die Hoffnung, dass es ihren Kindern einmal besser gehen möge als den früheren Generationen. Good parenting lautet der englische Ausdruck dafür, Eltern unterscheiden sich nirgends in diesem Wunsch, gute Eltern für erfolgreiche Kinder zu sein – selbst wenn ihnen dies nicht immer und sogar zunehmend weniger gelingt, meistens weil die sozialen Umstände sie darin hindern. Gleichwohl: Gute Eltern zu sein, das ist ein wichtiges, wenn nicht das zentrale Motiv all jener, die Kinder haben. Und weil dieses Motiv so stark ist, kommen weltweit Menschen mit Kindern fast immer gut ins Gespräch miteinander. Wer Kinder hat, kennt die guten und die schlechten Situationen mit Kindern – und kann sich darüber austauschen. So gesehen sind die Kinder die besten Diplomaten oder Integrationspartner, wobei meist noch die Mütter eine wichtige Rolle spielen. So widersprüchlich das nun klingt:
Zum anderen sollte man jedoch vorsichtig sein mit der Vorstellung, dass es überhaupt typisch deutsche Eigenarten gibt, die sich im pädagogischen Denken und Handeln niederschlagen könnten. Abgesehen nämlich davon, dass Verallgemeinerungen in einem Land ziemlich schwierig sind, das von deutlichen Unterschieden zwischen dem Norden und dem Süden, dem Westen und dem Osten geprägt ist. Zudem zeigen sich bis heute in Deutschland sozial- wie mentalitätsgeschichtlich Spuren seiner kleinstaatlichen Vergangenheit und der damit verbundenen Religionszugehörigkeiten. Als Nationalstaat existiert Deutschland erst 1871, vorher gab es hunderte Kleinstaaten, die sich nicht nur in Religionszugehörigkeit unterschieden haben. In protestantischen Regionen waren Fragen der Erziehung und der Schulbildung wichtiger als in katholischen. Zudem haben sich die jeweiligen Landesfürsten ganz unterschiedlich pädagogisch engagiert, manche Schulgründung vergangener Jahrhunderte zählt heute noch zu den herausragenden pädagogischen Einrichtungen. Diese „langen Geschichten“ wirken vielfach nach: Es kann wichtig sein, ob in einer Region früh die Industrialisierung einsetzte, die Menschen und Arbeitskräfte aus anderen Ländern angezogen hat – wie dies im Ruhrgebiet der Fall war. Oder ob ein Land agrarisch geprägt war und sich daher lange gegen Zuwanderung gesperrt hat; Erziehung und Bildung spielten dann keine große Rolle, weil sich die Welt nur wenig verändert hat – so etwa in Bayern.
Nimmt man nun die Entwicklungen der jüngeren Zeit in den Blick, dann zeigen sich doch einige entscheidende Veränderungen in der Gesellschaft Deutschland; man sollte sie kennen, um zu wissen, worauf man sich als Neuankömmling in diesem Land einlässt:
● Die erste Veränderung vollzieht sich zwar schleichend, sogar schon seit fast einem Jahrhundert. Sie wird aber jetzt im Alltag sichtbar: Deutschland unterliegt dem Demographischen Wandel, die Menschen leben länger und werden älter, die Zahl der Kinder und Jugendlichen geht zurück. Dies gilt ganz besonders in Ostdeutschland. In Westdeutschland stammen hingegen junge Menschen sehr häufig aus Zuwanderungsfamilien. Damit entsteht jedoch gelegentlich eine heikle Situation: Ältere Menschen sind – um es vorsichtig zu formulieren – nicht unbedingt kinderfreundlich, in Deutschland schon gar nicht, wobei in früheren Jahrzehnten tatsächlich massive Kinderfeindlichkeit verbreitet war: Fußballspielen auf dem Rosen verboten, Eltern haften für ihre Kinder – solche Schilder waren häufig anzutreffen, für Kinder und Jugendliche eigentlich ziemlich unverständlich. Heikel ist diese Situation, weil nun Verhaltensweisen, die alterstypisch für Kinder und Jugendliche sind, schnell mit dem Status der Migranten verbunden werden. Wenn junge Menschen laut sind, wenn sie in Gruppen herumlungern und – ich bitte den Ausdruck zu entschuldigen – „Scheiß machen“, Erwachsene schräg anreden oder sich sogar delinquent verhalten – was in der Pubertät ebenfalls völlig normal ist – wird dies schnell mit der Herkunft aus einem anderen Land erklärt. Nur: diese Erklärung ist schlicht falsch, vielmehr hat man zu tun mit Handlungen, die zur Lebenssituation von Kindern oder Jugendlichen einfach dazu gehören.
● Dann eine zweite Veränderung, die meistens übersehen wird: Typisch deutsch? Das ist in der sozialen und pädagogischen Wirklichkeit kein großes Thema mehr. Wer nach Familie und Erziehung in Deutschland fragt, muss sich nämlich darüber im Klaren sein, dass – so der Befund des letzten Kinder- und Jugendberichts – mehr als die Hälfte der Minderjährigen aus Familien stammt, die – wie das so schön heißt – Migrationshintergrund haben. Längst bestimmen also ganz unterschiedliche Traditionen und Lebensgeschichten, was als deutsch im pädagogischen Zusammenhang gelten kann; Typisch deutsch ist dann eher typisch deutsch-italienisch, deutsch-griechisch, deutsch-türkisch, auch deutsch-russisch, um nur ein paar Kombinationen zu nennen.
Interessant ist allerdings ein Phänomen: Geht es um Familie und Erziehung wirken Zuwanderungsfamilien traditioneller und konservativer als die vorgeblich einheimischen Familien – von „vorgeblich einheimisch“ muss deshalb gesprochen werden, weil nicht nur viele ihre frühere Wanderungsgeschichte vergessen oder verdrängt haben, sondern weil spätestens nach zwei Generationen die Unterschiede wenigstens in den pädagogisch relevanten Zusammenhängen fast völlig verschwunden sind; symptomatisch dafür ist, wie sich die Geburtenzahlen in den Familien rasch dem in Deutschland üblichen niedrigen Niveau anpassen. Nicht einfacher wird die Sache dadurch, dass es in Deutschland manchmal ziemlich schwierig ist, überhaupt über Familie zu reden: Auf der einen Seite wünschen sich besonders junge Menschen eine gute Familie, vertrauen ihren eigenen Eltern und wollen selbst eine Familie gründen; vielen gelingt das aber nicht, weil die beruflichen Anforderungen es kaum zulassen, Kinder zu haben, zumal häufig Großeltern und Verwandte als Helfer ausfallen. Auf der anderen Seite lehnen vor allem akademisch ausgebildete Frauen (und zunehmend Männer) Familie als überholtes Lebensmodell ab, wollen nur noch zusammenleben oder verzichten ganz auf eine Familiengründung.
Bemerkenswerterweise zeigt übrigens die Jugendforschung, dass Kinder und Jugendliche in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich besser mit ihren Eltern harmonieren, sensibler geworden sind und eher weniger heroisch sind, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Auch hier steckt ein kleines Problem: Junge Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, haben mit „modernen Familien“ zu tun; die Familienmitglieder sind eher gleichberechtigt und gelassen, die Kinder haben weniger Konflikte mit ihren Eltern, machen sich übrigens auch mehr Sorgen um diese. Kinder aus eben zugewanderten Familien wachsen in traditionelleren Familien mit Lebensmustern auf, die autoritärer wirken, die jungen Menschen müssen sich noch in „klassischen“ Auseinandersetzungen von ihren Eltern ablösen. Sie rebellieren noch – was außerhalb der Familie dann als auffällig oder gar abweichend wahrgenommen wird.
● Allerdings hat sich die deutsche Gesellschaft im letzten Vierteljahrhundert ziemlich radikal verändert. Ein wichtiges Datum ist zunächst die Wiedervereinigung, bei der nun vielleicht zusammen wächst, was aber nur noch bedingt zusammen gehört; ältere Deutschen im Osten denken und handeln anders als die im Westen, insbesondere wenn es um Zuwanderer geht. Sie haben mehr Angst vor Zuwanderern, obwohl in Ostdeutschland viel weniger Migranten leben. Oder: weil in Ostdeutschland viel weniger Migranten leben und daher Erfahrungen mit diesen fehlen. Jüngere Untersuchungen haben gezeigt, dass im Osten diese Irritation durch vorgeblich „Fremde“ kaum zurück geht, weiterhin massive Ängste vor „Ausländern“ bestehen, während im Westen längst Offenheit für interkulturelle Begegnung besteht – vermutlich, weil es sehr viel mehr junge Menschen aus anderen Gesellschaften und Ländern gibt. Wer im Kindergarten und in der Schule gemeinsam aufwächst, hat weniger Schwierigkeiten miteinander; man kennt sich einfach, lebt miteinander, vor allem wissen die Eltern, wie sehr sich die Lebenssituationen mit Kindern und Jugendlichen gleichen; Trotzphasen oder Pubertät – sie kommen in allen Kulturen und Gesellschaften vor, treiben überall Familien in den Wahnsinn, das eint Eltern.
Als ein kritischer Punkt erweist sich jedoch immer wieder, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Regionen zuwandern, die zuweilen selbst in Konflikten miteinander leben; manche Auseinandersetzung wurzelt also gar nicht darin, dass sich Zuwanderer und deutsche Bevölkerung nicht verstehen, sondern Zuwanderer Kontroversen aus ihren Heimatländern mitbringen. Allerdings: insbesondere bei Flüchtlingen versagen die deutsche Politik und die Verwaltung, weil sie zuweilen Menschen zu einem Zusammenleben zwingen, das sie noch nicht ertragen können; wer eben aus seiner Heimat geflohen ist, wird nicht auch noch die eigene Kultur preisgeben oder mit jemandem zusammen leben wollen, der selbst zu einer anderen Konfliktpartei gehört hat.
● Verändert hat sich die deutsche Gesellschaft auch, weil nach der Wiedervereinigung ein Prozess der Modernisierung sich durchgesetzt hat. In diesem sind neue Sozialisationsbedingungen entstanden. Die Lebensbedingungen haben sich massiv verändert, Stichworte wie Risikogesellschaft oder Multioptionsgesellschaft deuten das schon länger an, man könnte auch von einem entfesselten Kapitalismus sprechen, der zunehmend weniger durch sozialstaatliche Sicherheiten eingedämmt wird. Insbesondere die jüngeren neoliberalen Entwicklungen sollten in ihren Effekten nicht unterschätzt werden, die sie auf Familie und Erziehung haben: Verlängerte Arbeitszeiten beispielsweise, der Zwang zur Berufstätigkeit wirken sich nachteilig auf Familien aus, Unsicherheit und Ungewissheit bestehen nicht nur in materieller Hinsicht, sondern auch bei den Lebens- und Wertvorstellungen, die Eltern ihren Kindern weitergeben möchten. Zugleich breitet sich zunehmend Konkurrenzdruck unter Eltern aus: Die Sorge umeinander und füreinander weicht der Vorstellung, dass sie ihre Kinder für die Zukunft optimieren müssen; sie sollen „fit“ werden. Dazu gehört, dass sie besser als die anderen sind – eine Ellbogengesellschaft breitet sich aus, Solidarität schwächt sich hingegen ab.
Verschärft haben sich also die sozialen Unterschiede, Armut und Desintegration sind zu einem herausragenden Thema geworden, wobei ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Beispielhaft steht dafür die Debatte um die sogenannten „Unterschicht“, aber auch andere Begriff denunzieren, so der von der sozial schwachen Familie oder der von der bildungsfernen Familie. Zwar gibt es Streit darüber, ob die Definition von Armut wirklich sachgerecht ist, dennoch hat eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtverbandes kürzlich gezeigt, dass fast zwölf Millionen Menschen in Deutschland schon arm sind oder von Armut bedroht. Das schafft eine massive Unsicherheitssituation und schürt Ängste vor anderen Menschen. Das gilt ebenso für die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse: Das sogenannte deutsche Jobwunder der letzten fünfzehn Jahre hängt entscheidend damit zusammen, dass die Zahl schlecht bezahlter, oft nur befristeter Arbeitsverhältnisse zugenommen hat; man spricht längst von den working poor, von den arbeitenden Armen, die von ihrem Einkommen nicht mehr leben können. Familien, Alleinerziehende sind davon besonders betroffen.
Die integrative Kraft der deutschen Gesellschaft schwächt sich dabei ab, offensichtlich teilt sich die Gesellschaft in eine Vielzahl von Milieus, die sich oft voneinander abgrenzen. Zugleich wirken sich Individualisierungsprozesse aus, die sich nicht zuletzt in den pädagogischen Präferenzen niederschlagen. Insofern wird die Gesellschaft zwar bunter, aber auch unübersichtlicher; auch hier gilt: typisch deutsch gibt es gar nicht mehr, man orientiert sich eher an den sozialen und kulturellen Milieus, in welchen man sich bewegt. Der junge deutsche Rapper kommt allerdings besser mit dem türkischen Rapper aus als mit einer Jugendlichen aus Russland, die klassische Musik liebt. Zudem gehen die großen Sozialisationsagenturen verloren: Für Deutsche ist es inzwischen nur mühsam zu verstehen, wenn für Familien oder junge Menschen Religion und Kirchen wichtig sind; ich vermute, dass ein Teil der Ablehnung des Islam eben darin gründet. Deutsche können sich nicht mehr vorstellen, dass der Glauben eine wichtige Rolle im Leben von Menschen spielt und stehen argwöhnisch jenen gegenüber, für die das noch der Fall ist. So gesehen, sollte man wahrscheinlich gar nicht über Religion diskutieren. Die Zugehörigkeit zu einem Sportverein verliert an Bedeutung, wie insgesamt die Vereine nicht mehr das soziale Gewicht haben, das ihnen in der Vergangenheit zugekommen ist; für das Aufwachsen von Kindern sind Kirchen und Vereine aber immer wichtig gewesen, neben den Familien, neben der Schule. Immerhin: Sport bleibt ein großes Thema: Wer mit Deutschen ins Gespräch kommen will, sollte sich vorher über Fußball kundig gemacht haben. Schwierig wird es nur, wenn die Gesprächspartner den einen oder den anderen Verein nicht mögen: Bayern München oder Borussia Dortmund – man darf sich besser keinen Fehler erlauben. Dennoch zählt das Engagement in Vereinen oder Verbänden; im ländlichen Raum kommen junge Menschen wahrscheinlich am Schnellsten an, wenn sie der Freiwilligen Feuerwehr beitreten.
● Hinzu kommt, dass das Erziehungs- und Bildungssystem sich in den letzten fünfzehn Jahren grundlegend geändert hat; Kinderkrippen und vor allem Kindergärten werden „normal“ für das Aufwachsen – notabene – aller jungen Menschen, die weiterführenden Schulen arbeiten mit Ganztagsangeboten, auch die Hochschulen verändern sich. Auch hier gelten nicht mehr die Vorstellungen, die einmal als typisch deutsch bezeichnet wurden – dabei ist noch völlig offen, wo diese Entwicklung hingehen wird.
Nüchtern betrachtet geht also Einiges ganz schön durcheinander in Deutschland, so dass es eher schwer fällt zu sagen, was typisch deutsch ist, wenn es um Erziehung und Familie geht. Dennoch, allzumal mit einem kleinen Blick auf die Vergangenheit:
Vermutlich entscheidend und schon fast einzigartig ist wohl der Stellenwert, der überhaupt den pädagogischen Fragen in Deutschland zugemessen wird. Das hat eine lange Tradition, die zunächst eng mit dem Protestantismus zu tun hat; immerhin hat Luther den Begriff der Erziehung in den öffentlichen deutschen Sprachgebrauch eingeführt, zudem besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem im Protestantismus geforderten unmittelbar persönlichen Verhältnis zu Gott und dem damit entstandenen Zwang sich als Person streng zu kontrollieren und zu disziplinieren, aber eben auch durch intensive Lernanstrengungen gottgefällig zu leben. Das macht übrigens eine Dimension von Innerlichkeit aus, die bei allen berechtigten Vorbehalten gegenüber diesem Konzept doch maßgebend für die eigene Lebensführung ist: es geht darum, den Anstoß zur Selbsterziehung zu geben. Doch haben sich schon immer – sehr kluge – Spötter über die ihnen dann allerdings typisch deutsche Neigung lustig gemacht, pädagogische Fragen in den Mittelpunkt zu stellen: Johann Friedrich Herbart, der Begründer einer modernen wissenschaftlichen Pädagogik, meinte einmal bissig, wenn es überhaupt angeborene Ideen gäbe, müssten es wohl die pädagogischen sein – andernfalls lasse sich nicht erklären, dass in Sachen Pädagogik alle und dauernd mitreden. Jean Paul (Friedrich Richter), der mit seinem Erziehungsroman Levana für Furore sorgte, vermutete, dass die Deutschen wohl lieber auf politisches Denken und Handeln verzichten, um andere zu erziehen. Und nicht wenige behaupten, dass das Bürgertum im 19. Jahrhundert seine politische und wirtschaftliche Schwäche damit kompensiert hat, dass es sich als Bildungsbürgertum sozusagen veredelt hat.
Zuletzt ist das deutlich geworden an der großen Aufregung darüber, dass Deutschland in den internationalen Vergleichsstudien lange nur mittelmäßig abgeschnitten hat; und wie geradezu jeder Punkt glücklich kommentiert wird, der in späteren large scale assessments dazu gewonnen wird. Dabei weiß niemand wirklich so genau, was da eigentlich gemessen wird. Um Bildung geht es sicher nicht, sondern darum zu prüfen, ob die Menschen im wirtschaftlichen Verwertungsprozess taugen – und selbst da überzeugen die Ergebnisse nicht so ganz. Denn immerhin zählt Deutschland zu den erfolgreichsten Nationen weltweit, so schlichte scheint die Qualifikation der Menschen in diesem Land nicht zu sein. Gleichwohl haben die Befunde getroffen: die Deutschen als das Volk der Dichter und Denker nicht mehr ganz vorne! PISA, so das Akronym für die bekannteste und von der OECD durchgeführte Untersuchung, wurde zum Gesprächsstoff. Darin spiegelt sich der Stellenwert des Themas wieder. Für seine Bedeutung spricht zudem, wie schon lange in der deutschen Sprache eine Vielfalt von Ausdrücken für pädagogische Sachverhalte entstanden ist, die zum Teil gar nicht so recht zu übersetzen sind: Bildung etwa ist ein hoch aufgeladener, bedeutungsvoller Begriff. Zwar wird er heute vorrangig mit dem Lehren und Lernen in der Schule gleichgesetzt, hat aber eine lange religiöse, mithin auch theologische und philosophische Tradition. Sie schwingt immer mit, wenn von Bildung gesprochen wird: Bildung meint dabei ein kompliziertes Geschehen, in dem sich Menschen selbst entwickeln, um zu sich als Person finden und zugleich doch der sie umgebenden Welt kundig und mächtig werden. Im Bildungsbegriff steckt ein hoher Anspruch, der als Leitmotiv und Antrieb für viele wirkt. Anders der Begriff der Erziehung, der darauf abhebt, dass besonders für Kinder Situationen arrangiert werden, in welchen sie sich zugleich ein Verhalten erwerben können, mit dem sie in einer Gesellschaft und Kultur sich gut, aber eben auch unauffällig und verantwortungsvoll bewegen können; Erziehung und Anpassung stehen in Verbindung, doch ist zugleich ein Element von Selbstständigkeit und Freiheit immer mitgedacht. Es ist schon kein Zufall wenn von emanzipatorischer Erziehung gesprochen wird, die Kindern und Jugendlichen Mündigkeit, Selbständigkeit und Autonomie ermöglichen will – und man darf nie vergessen, dass dabei doch noch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anklingt. Weil eben Auschwitz nie mehr wieder sein darf, wie der große Philosoph Theodor W. Adorno gefordert hat, hat Erziehung in Deutschland heute mehr denn mit Freiheit zu tun – und das ist auch wirklich gut so. Schließlich kennt die pädagogische Sprache noch den Unterricht, der Kinder belehrt, sie mit den „Sachen“ der Welt vertraut macht, aber sie zugleich zum Selbstdenken bewegt, ihnen Wissen und Können zugänglich macht, mit dem sie in der sozialen und kulturellen Welt erfolgreich sein können.
Man erkennt sofort: Wenn in Deutschland pädagogische Themen angesprochen werden, sind sie einerseits wichtig, andererseits zugleich immer kompliziert und in sich fast widersprüchlich. Wie soll das zusammen gehen: Anpassung und Selbstständigkeit? Und dann vor allem: was ist konkret damit gemeint? Die sogenannten Sekundärtugenden, also Pünktlichkeit, Höflichkeit, Sauberkeit scheinen nicht mehr so wichtig. Indes: wenn es darauf ankommt, dann sind sie doch wieder gefragt – und man darf sich nichts vormachen: Sie werden besonders dann geltend gemacht, wenn man sich gegenüber jemanden abgrenzen will. Die Sache ist schon ziemlich kompliziert – und dann doch wieder einfach: Wenn es darum geht, anderen zur Seite zu stehen, die mit ihren Kindern auf Unterstützung angewiesen sind, geht das meistens unkompliziert; ob Windel oder Fläschchen, im Normalfall ist die Hilfsbereitschaft ziemlich groß, Eltern und besonders Mütter finden schnell zueinander. Ich formuliere das sehr persönlich, vielleicht ist es nur eine subjektive Vermutung. Ob und wieweit Menschen sich anderen gegenüber leicht öffnen, ist regional recht unterschiedlich; in Franken etwa wird man so schnell keine Freundschaft schließen. Dennoch wird kaum jemand die Unterstützung für neue Nachbarn verweigern, allzumal wenn diese Hilfe für ihre Kinder benötigen.
Jedenfalls darf man als ein soziales Grundmuster der Menschen in Deutschland ansehen, dass ihnen eine gute Erziehung ihrer Kinder und Erfolg in der Schule für diese wichtig sind. Darin unterscheiden sie sich allerdings kaum von den anderen Eltern dieser Welt; sie alle wünschen sich eine gute Zukunft für ihren Nachwuchs. Dennoch zeichnet hier die für Deutschland wichtigen Muster und Erwartungen ein ungewöhnlicher Zug aus: Interessanterweise hat die psychologische Bindungsforschung darauf hingewiesen, dass Mütter und Kinder in Deutschland eher unsicher gebunden sind; in allen anderen Gesellschaften ist die Beziehung zwischen Müttern und Kindern enger und anscheinend fester, was vordergründig dazu führt, dass zumindest kleine Kinder eher „verwöhnt“ erscheinen, ihnen buchstäblich alles erlaubt wird, was ihnen nur in den Kopf kommt. Deutsche beklagen sich dann, dass die Kinder nicht richtig erzogen seien, reagieren ärgerlich und ablehnend.
Das macht allerdings auf ein grundsätzliches und ein historisches Problem aufmerksam: Pädagogische Fragen und Themen werden in Deutschland grundsätzlich mit einem Ernst und einer Tendenz zur (moralischen) Panik verhandelt, dass man schon verzweifeln möchte: Es fehlen Ironie und jene kleine, liebevolle Nachlässigkeit, mit denen man in anderen Gesellschaften Kindern begegnet, weil man ahnt, dass die nicht nur ohnehin das machen, was sie selbst wollen, sondern sich vor allem meistens ganz gut entwickeln. Es gibt sehr schnell eine vordergründige Übereinstimmung darüber, was insbesondere in pädagogischen Fragen als „normal“ zu gelten habe – wobei vorsichtige Nachfragen sehr schnell zu Tage fördern, dass gar nicht so viel Einigkeit über das Normale besteht. Es kann auch kaum bestehen, weil eben, wie gezeigt, die deutsche Gesellschaft viel bunter ist, als sie sich das selbst eingestehen möchte. Um eine eher historische Erbschaft handelt es sich jedoch, wenn in Deutschland bei pädagogischen Fragen sehr schnell nach dem Staat, nach Ordnungsmächten gerufen wird. Beide Modelle spielen eine Rolle, sowohl der kontrollierende, überwachende und disziplinierende Obrigkeitsstaat wie auch der fürsorgliche Staat spielen im Denken der Deutschen (immer noch) eine wichtige Rolle, das private Leben und damit auch die Familie werden in anderen Gesellschaften und Ländern deutlich höher bewertet und verteidigt. Die Bereitschaft fehlt manchmal, die Dinge locker zu regeln und im Gespräch selbst zu klären.
Eine Crux könnte darin liegen, dass Deutsche auszeichnet, gerne zu erziehen, wenigstens zu belehren; als Migrant kommt man schnell in eine Situation, in der man von dem Gegenüber aufgeklärt und informiert wird – das wäre noch harmlos -, häufiger wird man ermahnt oder zurecht gewiesen. Verhaltensweisen im öffentlichen Raum sind schnell Stein des Anstoßes, man gibt besser nach. Vielleicht auch zurecht: Ein Beispiel bietet der Straßenverkehr, wo man sehr schnell aneckt, wenn man – wie im Rest der Welt – ein wenig lockerer mit Regeln umgeht. Das Dilemma besteht darin, dass in Deutschland ziemlich dichter und sehr schneller Verkehr herrscht (nicht schlimmer jedoch als in Rom, Istanbul, Mumbay oder Taipee), Autofahrer sind ziemlich unflexibel, allzumal wenn es um Kinder geht. Nach aller Erfahrung wird weltweit eher vorsichtig gefahren, wenn kleine Menschen unterwegs sind – in Deutschland wird erwartet, dass Eltern aufpassen und streng erziehen. Es ist für beide Seiten eine Überlebensstrategie, lässt aber manchmal Missverständnisse entstehen.
Zu schaffen machen jedem Neuankömmling in Deutschland, dass regelmäßig eine Spannung zwischen den öffentlichen Debatten und ihrer manchmal geradezu nervigen Kritiksucht auf der einen Seite besteht, während auf der anderen Seite dann doch, manchmal sogar eher heimlich und im Privaten geschätzt und praktiziert wird, was man lautstark für über überkommen erklärt hat. Ein Beispiel findet sich wohl im Stellenwert von Familie: Nicht wenige erklären, Familie sei ein Lebensmodell der Vergangenheit, das für die moderne Gesellschaft wenig tauge; die empirischen Daten belegen dann, dass die Zahlen der Trennungen und auch die der Familienauflösung zunehmen, ebenso wie die der Neugründungen. Junge Menschen sehen überwiegend Familie als das Lebensmodell, nach dem sie streben. Nüchtern gesagt sind die Deutschen Familienmenschen – worin sie sich allerdings von Menschen in aller Welt kaum unterscheiden. Nur die Debatte ist aufgeregter – man tut gut daran, sich an ihr nicht zu beteiligen und sich für die eigene familiäre Lebensform und Lebenspraxis zu entscheiden.
Und noch etwas birgt möglicherweise Spannungen, nämlich das Verhältnis zur deutschen Sprache: Wer einwandert, sollte sich verständigen können, sollte schnell wenigstens so gut mit der deutschen Sprache vertraut sein, dass er sich selbst behaupten kann. Viele Deutsche reagieren verunsichert, wenn sie im öffentlichen Raum erleben, dass sie andere Menschen nicht verstehen – nicht wenige haben wohl Angst, dass über sie abwertend gesprochen wird, das Selbstbewusstsein ist wohl nicht wirklich groß. Die bundesdeutsche Politik hat dabei in der Vergangenheit und in der Gegenwart für einigen Unfug gesorgt: Manche wollten Zuwanderern sogar Deutschkurse verweigern, um sie so zur Rückkehr zu motivieren. Kürzlich hat der Vorschlag einer bayerischen Regionalpartei für Aufsehen gesorgt, Zuwanderer sollten in ihrem familiären Kontext gefälligst die deutsche Sprache verwenden; irgendwie wollte man das sogar überwachen. Zurecht haben andere Politiker das als höheren Blödsinn kritisiert. Doch ist da viel Heuchelei im Spiel: Denn oft genug fordert diese Kritiker, dass die Kinder aus Einwanderungsfamilien möglichst frühzeitig in pädagogischen Einrichtungen untergebracht werden sollen, um dort die deutsche Sprache zu lernen. Beide Vorschläge sorgen für Konflikte in den Familien – nötig wäre, dass Erwachsene wie Kinder möglichst rasch den Zugang zur Sprache des Einwanderungslandes gewinnen. (Zugleich hätte ich den wahrscheinlich naiven Wunsch, dass die mitgebrachte Sprache doch auch im Bildungssystem Anerkennung finden könnte. Mir ist ein ziemliches Rätsel, warum die Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht erkannt und gesellschaftlich auch genutzt werden, die Menschen mitbringen.)
Typisch deutsch? Wenn ich es gelassen betrachte, dann ist typisch deutsch, dass ich mein Gemüse in einem türkischen Geschäft einkaufe, meine Hosen bei einem Schneider kürzen lasse, der aus Indien kommt, mit Handwerkern zu tun habe, die aus Polen und Tschechien kommen, mich manchmal über Nachbarn aus Russland wundere, die mit ihren Kindern sehr streng schimpfen. Im Alltag der westdeutschen Städte wenigstens ist typisch deutsch eine ziemlich verrückte und bunte Angelegenheit geworden, in der meine Kinder aufgewachsen, erst recht mein Enkel sich über nichts wirklich wundert. Nur im Straßenverkehr, ich gestehe es, denke ich dann ein wenig typisch deutsch und ärgere mich über jene, die sich an keine Regeln halten. Nur: woher weiß ich eigentlich, dass es sich bei diesen um Zuwanderer handelt? Ich weiß es natürlich nicht und schäme mich ein bisserl für mein Vorurteil – aber so funktionieren eben Gesellschaften auch.