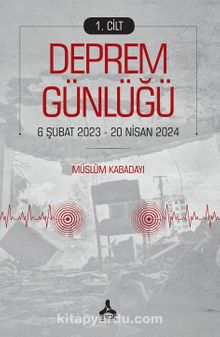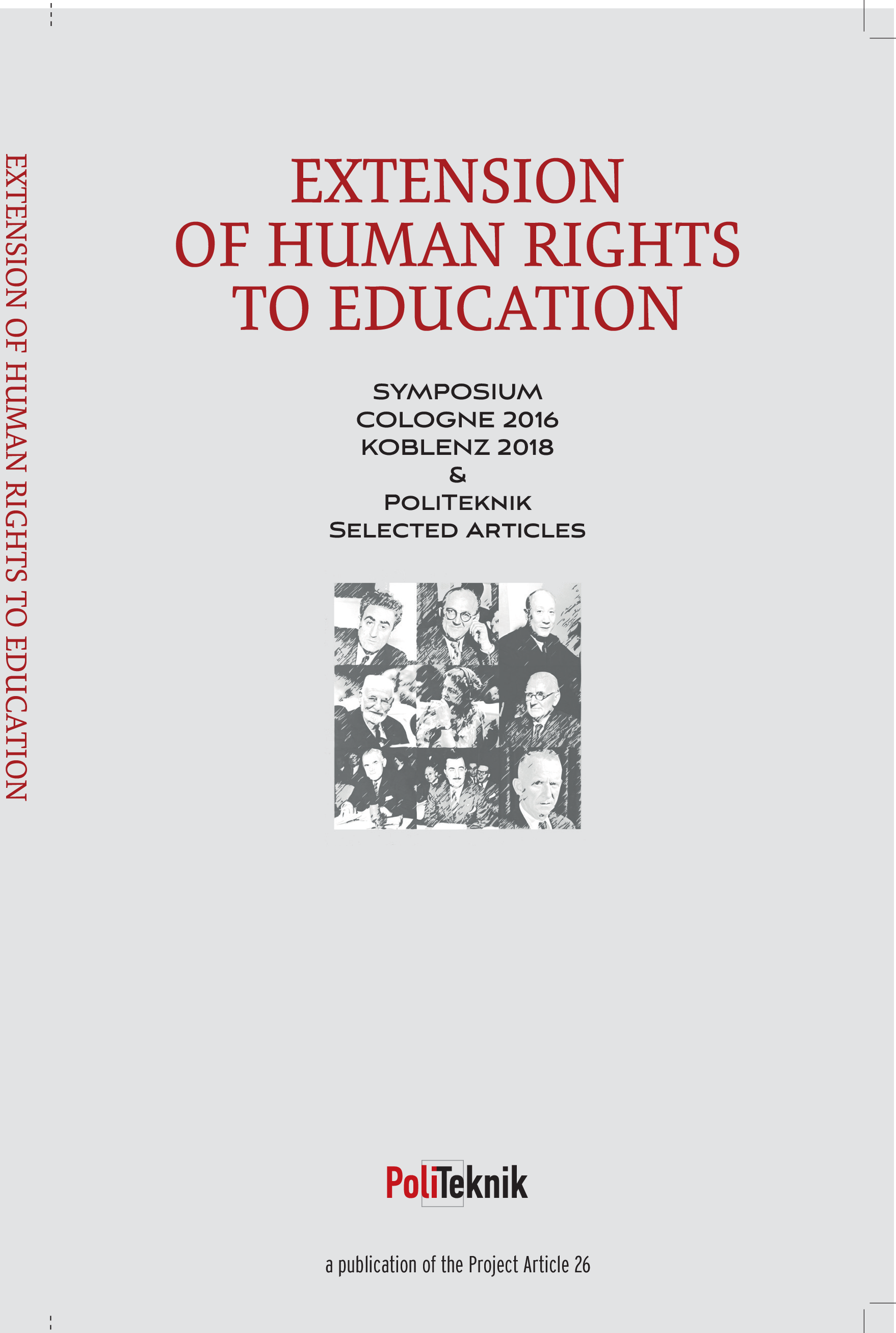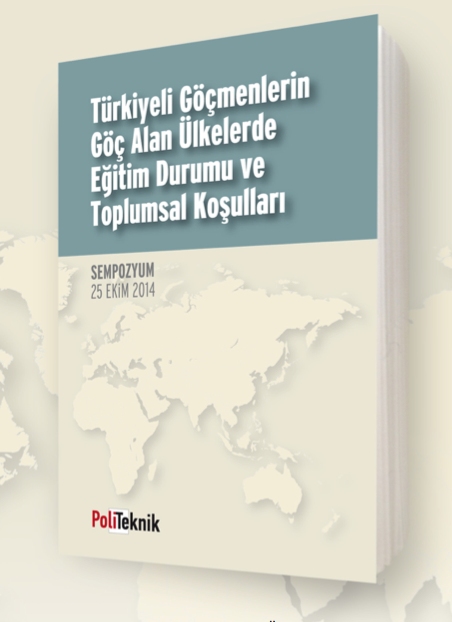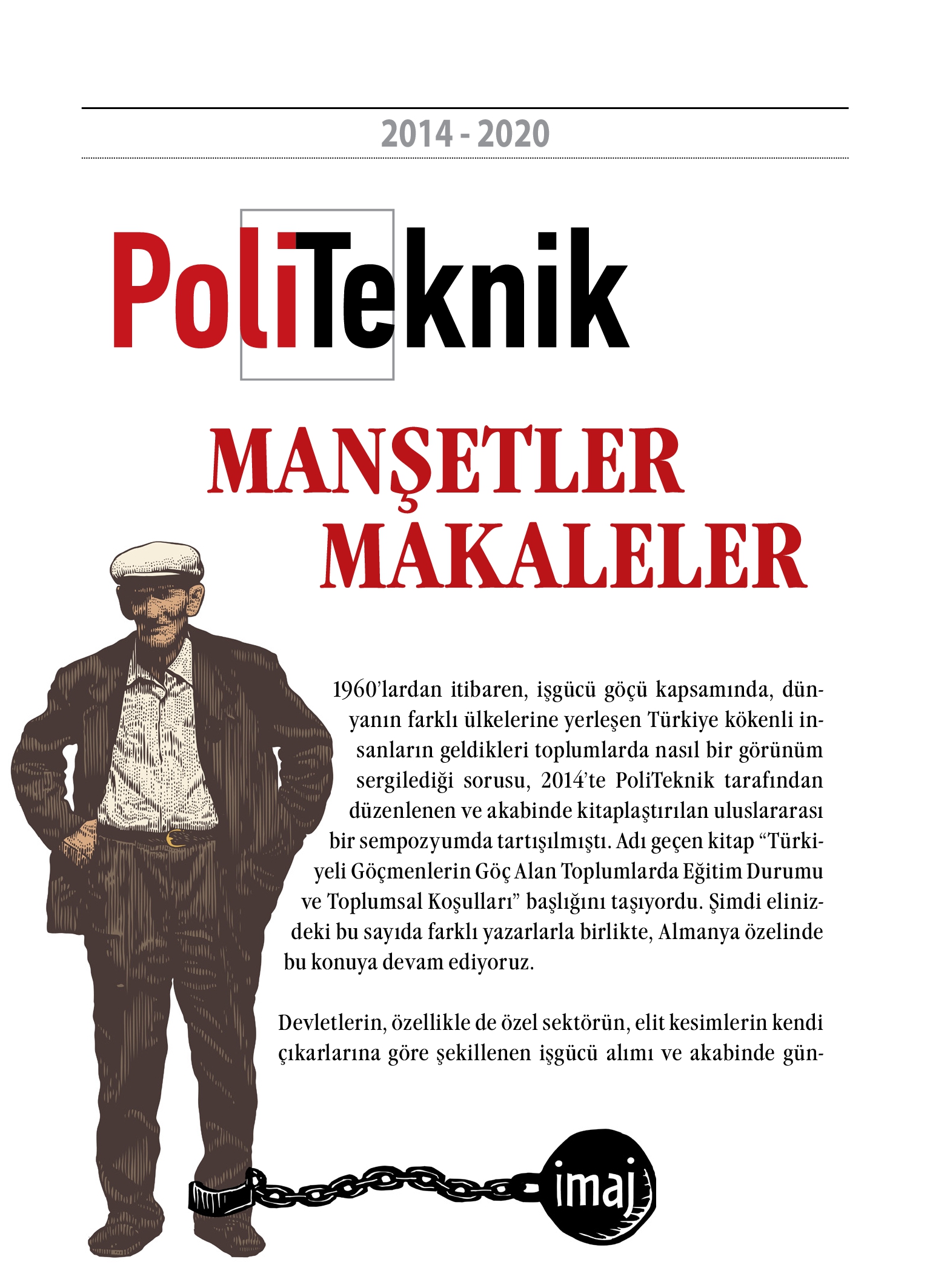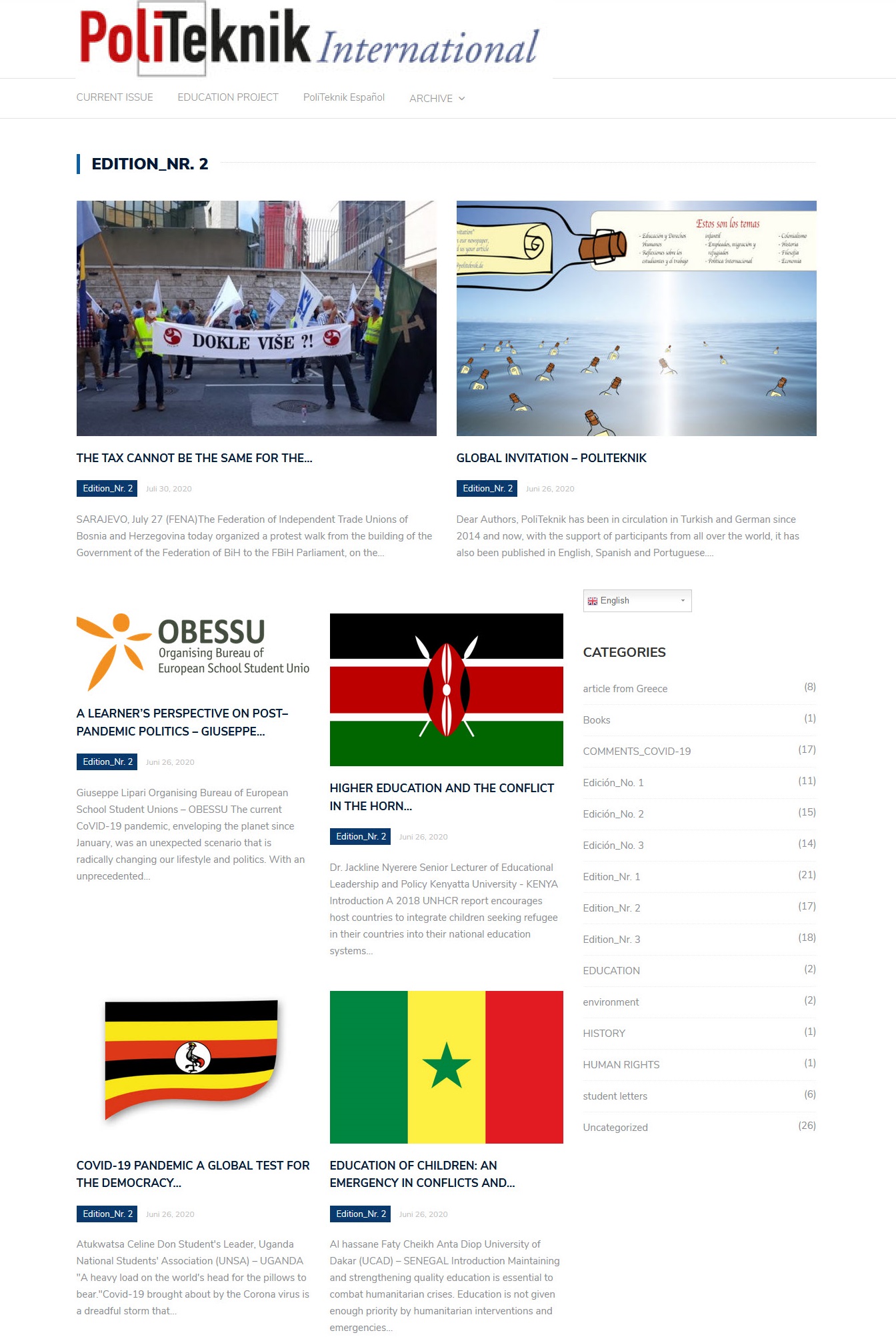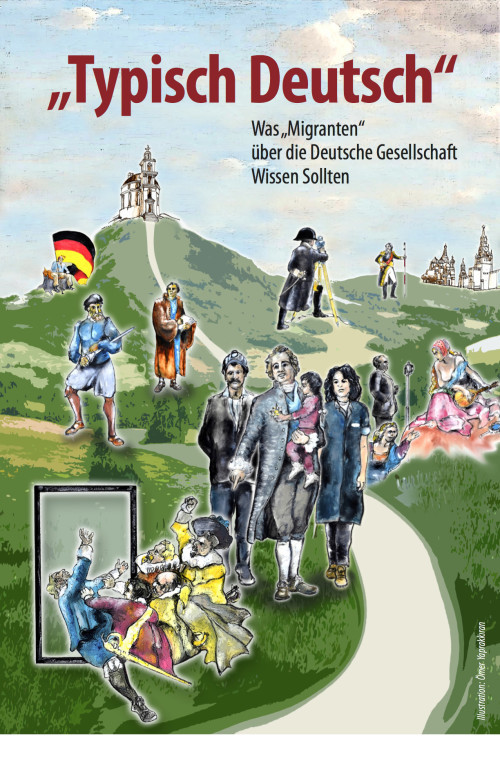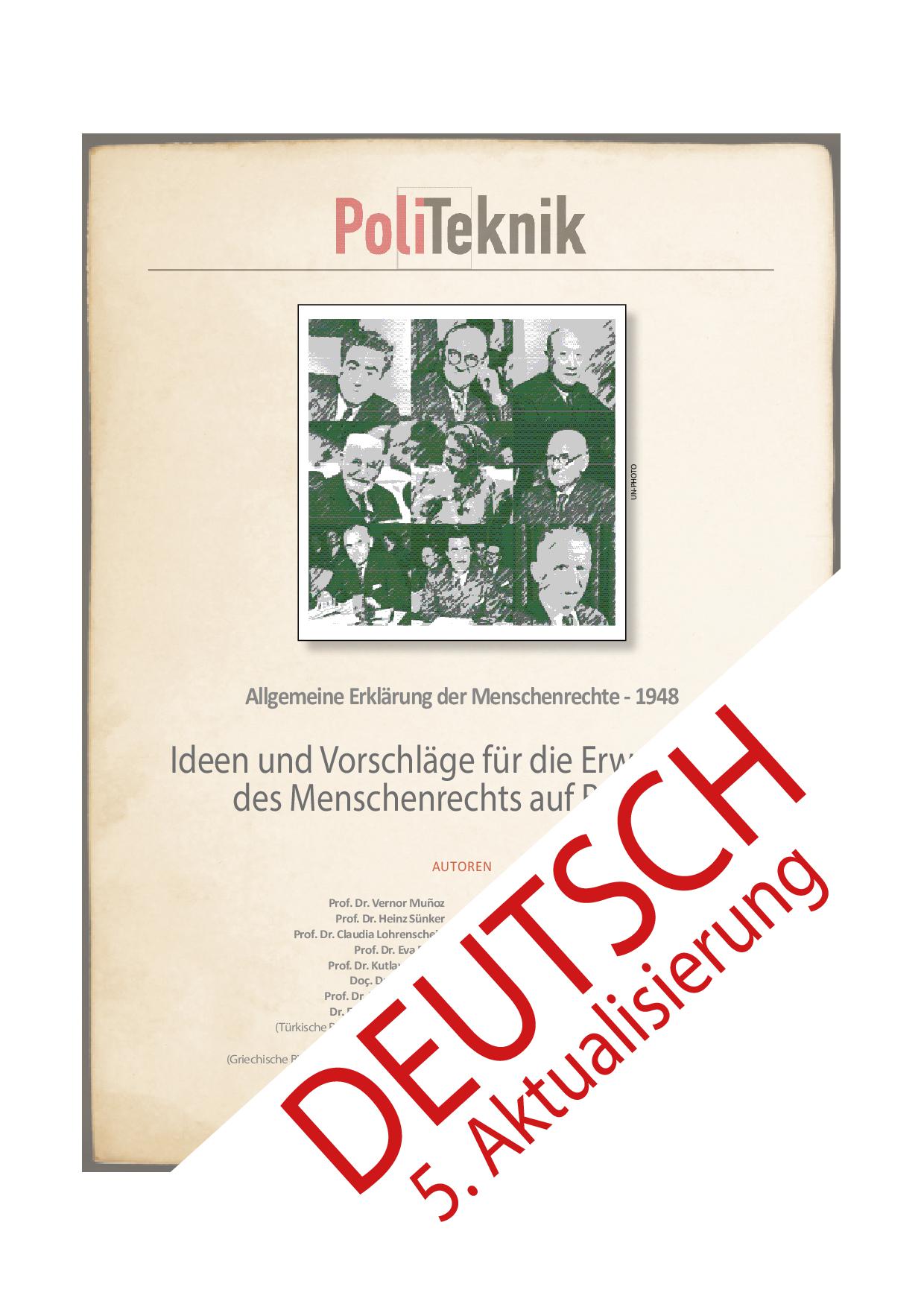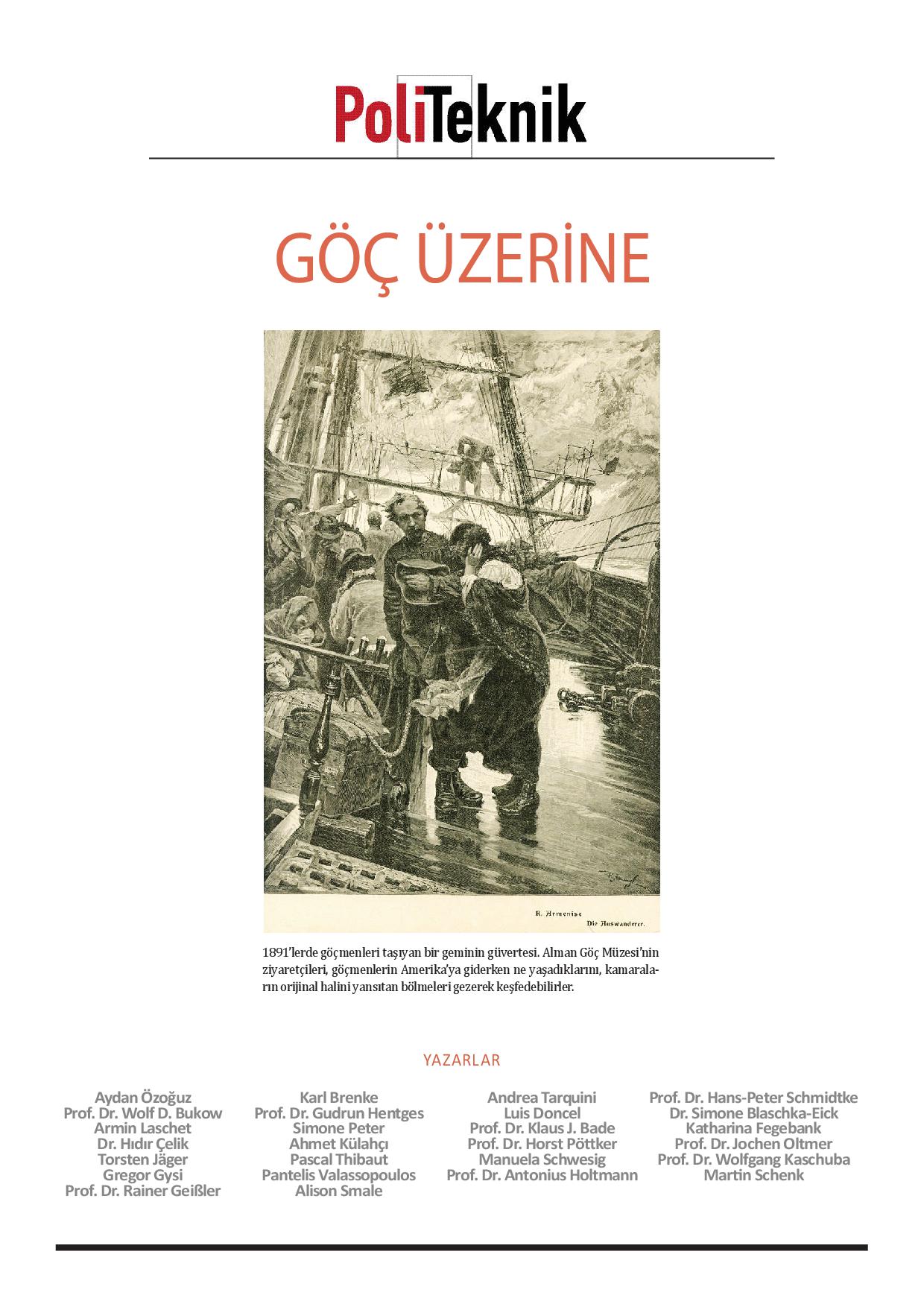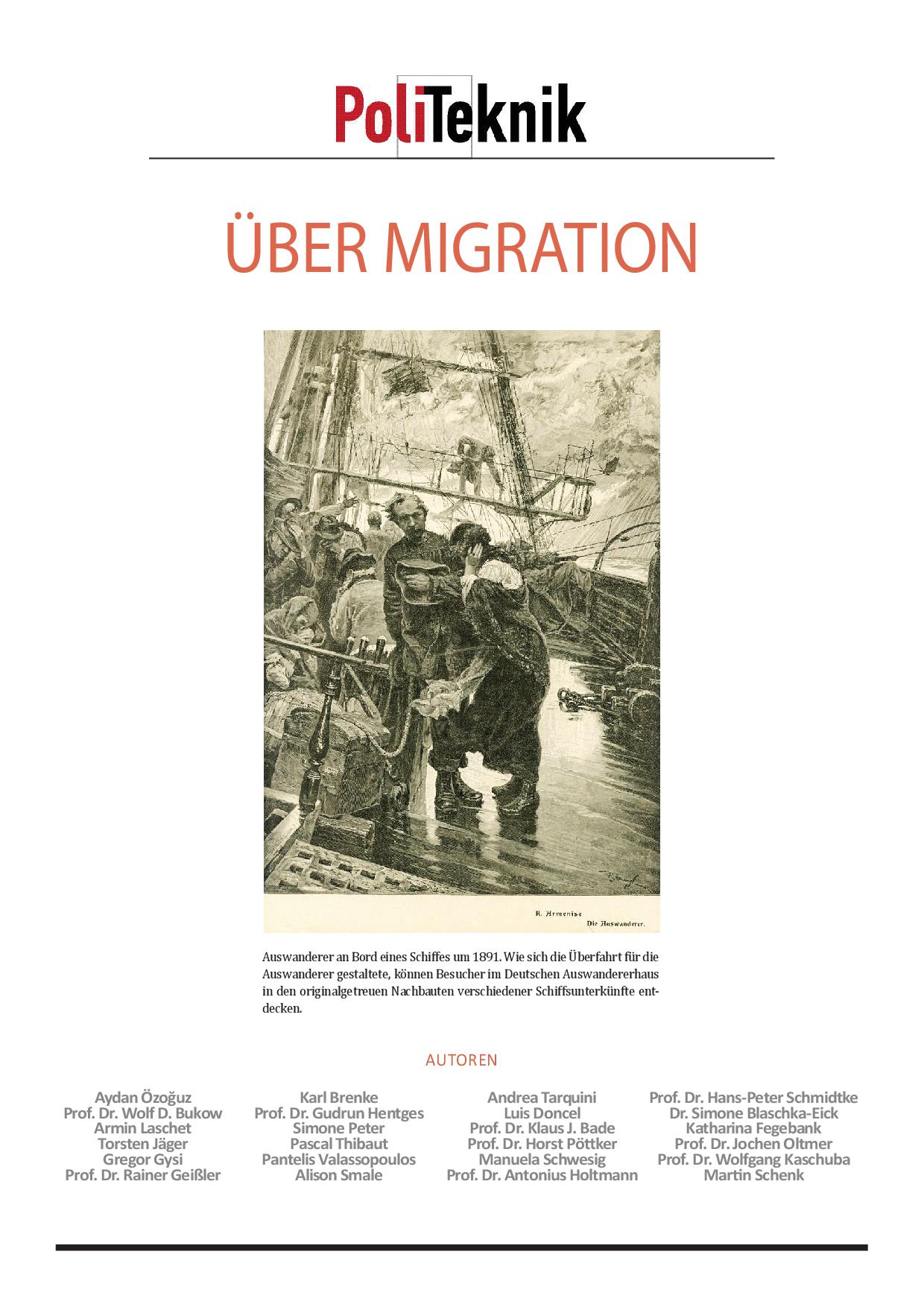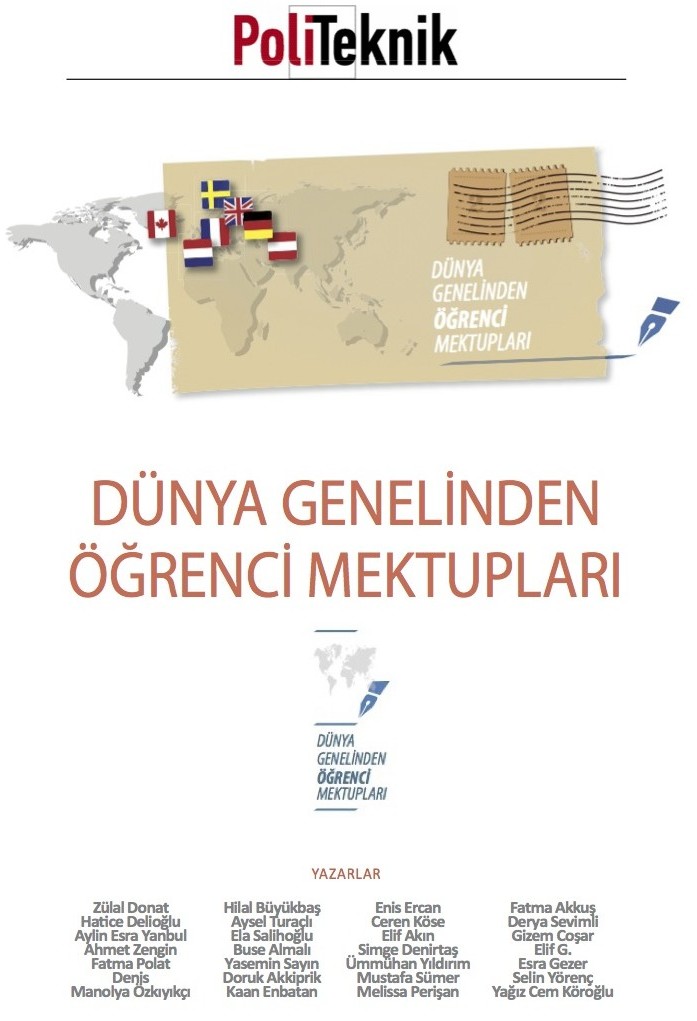Öffentliche Hochschulen sind nach dem Zweiten Weltkrieg als zivile Einrichtungen verfasst worden, deren wissenschaftliche Arbeit zum Aufbau einer friedlichen Gesellschaftsstruktur und friedlichen internationalen Beziehungen beitragen soll. Dieses eindeutig zivilwissenschaftlich bestimmte Feld ist bedroht. Militärisches und militaristisches Denken sind in den letzten Jahren in erschreckender Weise in den gesellschaftlichen Alltag und das zivile Leben vorgedrungen. Mit altbewährten Feindbildern werden eine gigantische Aufrüstung und exorbitante Rüstungsexporte gerechtfertigt. Deutschland, maßgeblich mitverantwortlich für den Ersten, hauptverantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, nimmt ungeniert die Führungsrolle in Europa in Anspruch. Junge Menschen sollen wieder rekrutiert werden, um als Kanonenfutter missbraucht zu werden. Der durch den deutschen Faschismus diskreditierte Begriff der Kriegstüchtigkeit zeigt einen gefährlichen kulturellen Rückfall hinter die Erkenntnisse bundesrepublikanischer Friedensforschung an. Höchste Zeit für die Wissenschaften, sich auf ihre zivilwissenschaftliche Bestimmung rückzubesinnen, die ihnen in einer demokratischen Gesellschaft zukommt.
Die als Kritische Pädagogik sich verstehende Erziehungswissenschaft ist seit Beginn der 1970er Jahre mit Kritischer Friedensforschung verbündet. Sie versteht sich konsequent als eine zivil-antimilitaristische wissenschaftliche Disziplin, die jeglicher Form der Militarisierung diametral ist. Als zivile, antimilitaristische Disziplin ist sie freilich möglich nur auf einer normativ begründeten Basis. Jede Wissenschaft, die im Sinne des Positivismus glaubt, die ethische Dimension wissenschaftlichen Forschens aus ihrem Reflexionshorizont ausklammern zu können, dient stets nur der Stabilisierung der jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Tendenzen, weil sie gleichgültig gegenüber der Verwendung ihrer Forschungsergebnisse ist. Sie ist damit extrem anfällig für den Missbrauch ihrer Forschung durch wirtschaftliche und militärische Interessengruppen. Das pädagogische Mündigkeitspostulat verpflichtet Erziehungswissenschaft dagegen auf Forschungen, die dem friedlichen Zusammenleben in innergesellschaftlicher wie internationaler Hinsicht gewidmet sind. Insofern ist die gesellschaftskritische erziehungswissenschaftliche Forschung stets friedenswissenschaftliche Forschung in pädagogischer Perspektive. Schon der allgemeine pädagogische Auftrag, Menschen mit Potenzialen an Mündigkeit, Selbstbestimmung und Urteilsvermögen auszustatten, widerspricht grundlegend jeder Form nekrophiler militärischer Werbung und Sozialisation, steht erst recht in krassem Widerspruch zu dem perversen Versuch, Menschen kriegstüchtig zu machen.
Erziehungswissenschaftliche Forschung in der gesellschaftskritischen Tradition ist darüber hinaus auf die radikale Beanstandung sämtlicher Formen gesellschaftlicher Friedlosigkeit gerichtet, die in der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft symptomatisch zum Ausdruck kommt. Dieser ethische Grundsatz bestimmt normativ die Grenze des Prinzips der Freiheit von Forschung: Es dürfen keine Forschungsprojekte durchgeführt werden, die in irgendeiner Weise der Perpetuierung gesellschaftlicher Friedlosigkeit, der Abschreckung, der Aufrüstung, der Kriegsvorbereitung dienen. Dazu gehört nicht nur das Verbot einer Forschungskooperation der Erziehungswissenschaft mit Rüstungsfirmen und militärischen Organisationen, sondern auch die konsequente Weigerung, sich an der zivil-militärischen Zusammenarbeit zu beteiligen, wie sie im Grünbuch 2025. Zivil-militärische Zusammenarbeit 4.0 eingefordert wird (Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit 2025).
Bezogen auf die Erziehungswissenschaft, bedeutet diese negative Bestimmung: Sämtliche Forschungen, die der Einbindung der Menschen in diese friedlosen Strukturen, der Mobilisierung der „kollektiven Psyche“ für Aufrüstung und Kriege (Senghaas 1981, S. 261) dienen, muss sie als zivile Wissenschaftsdisziplin kategorisch ablehnen. Das heißt: Sie ist unvereinbar mit Forschungsansätzen und Untersuchungen, die darauf gerichtet sind,
- die gesamtgesellschaftliche und mentale Resilienz der Gesellschaft im Sinne ihrer Kriegsfähigkeit zu stärken;
- Strategien der Cognitive Warfare zu erproben;
- Dispositionen für eine militärische Sozialisation schon im Kindergarten zu erzeugen;
- Bereitschaften für den Dienst an der Waffe herzustellen;
- Feindbilder zu konstruieren, zu verbreiten und zu vertiefen;
- militaristisches Denken und Kriegsmentalität in der Gesellschaft aufzubauen.
Als kritische, zivile Disziplin untersucht Erziehungswissenschaft, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen Mündigkeitspotenziale umgesetzt, kulturelle Abhängigkeitsverhältnisse abgebaut, Emanzipationsprozesse eingeleitet und Urteilsvermögen entwickelt werden können. Hierdurch stellt sie den pädagogischen Professionen nicht ‚nur‘ Erkenntnisse zur Verfügung, die sie für eine emanzipative Subjektwerdung von Menschen nutzen können; sie befähigt die pädagogische Praxis damit zugleich, den manipulativen Tendenzen und der politischen Desinformation entgegenzuwirken, die die Menschen an das System gesellschaftlicher Friedlosigkeit und an militaristische Positionen zu binden versuchen. Indem Pädagogik nämlich die allgemeinen Fähigkeiten für ein emanzipatives mündiges Handeln fördert, befähigt sie die Menschen zugleich, die Rechtfertigungsmuster gesellschaftlicher Friedlosigkeit, wie zum Beispiel Feindbilder, kritisch zu überprüfen und zurückzuweisen.
Stets hat Erziehungswissenschaft sich zu vergewissern, welchen Interessen ihre Forschungen unterliegen und welche politischen Konsequenzen aus ihnen gezogen werden könnten. Denn sie agiert nolens volens in einem politisch umkämpften Feld. Sie muss sich der grundsätzlichen Ambivalenz von Forschung stellen: der Tatsache, dass alle ihre Forschungsergebnisse auch von der ‚gegnerischen‘ Seite genutzt werden können. Das Problem der doppelten Verwendungsfähigkeit (Dual-Use) von Forschungsergebnissen stellt sich auch in der Erziehungswissenschaft, und zwar in zweierlei Hinsicht. So kann sie die in Kriegs– und Militärforschung gewonnenen Forschungsergebnisse kritisch sichten und für die eigenen Ziele nutzen: Die militärsoziologische bzw. -psychologische Fragestellung beispielsweise, wie aus zivilen Menschen Soldatinnen und Soldaten gemacht werden können (vgl. Apelt 2023), kann erziehungswissenschaftliche Friedensforschung umkehren, indem sie die militärsoziologischen und militärpsychologischen Erkenntnisse auf die Frage anwendet, auf welche Weise verhindert werden kann, dass Kinder zu Menschen mit militaristischem Denken sozialisiert werden. Militärische Forschung kann gegen ihre Intention für nicht-militärische Zwecke verwendet werden, wie es etwa die Forschungen zur „Cognitive Warfare“ der NATO eindrucksvoll zeigen (Tögel 2023).
Komplizierter stellt sich die umgekehrte Variante der doppelten Verwendungsfähigkeit dar, denn auch die Forschungsergebnisse einer zivil orientierten Wissenschaft sind selbstverständlich nicht davor gefeit, für militärische Zwecke instrumentalisiert zu werden. Die Ausbildungsinhalte an Bundeswehrhochschulen machen deutlich, dass das Militär zivil gedachte Ansätze mit emanzipatorischem Gehalt nutzt, um seinen hegemonischen Einfluss in der Gesellschaft auszuweiten. Um dieser Gefahr zu entgehen, reicht es nicht aus, das eigene Erkenntnisinteresse klar und deutlich herauszustellen. Vielmehr ist Erziehungswissenschaft gehalten, den zivilen Gehalt ihrer Forschungen über Mediatoren populärwissenschaftlich der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu verdolmetschen, sie nicht exklusiv im akademischen Feld zu belassen. Auch wenn ein hundertprozentiger Schutz nicht möglich ist, so kann das Risiko des Missbrauchs durch den militärisch-industriellen Komplex durch eine derartige Popularisierungsstrategie zumindest minimiert werden.
Als zivile wissenschaftlich Disziplin ist Erziehungswissenschaft in kritischer Perspektive dem Internationalismus und der Völkerverständigung verpflichtet. Ihre politische Partnerin ist die Friedensbewegung. Diese Grundorientierung bedeutet auch, dass sie sich politischen Restriktionen zu widersetzen hat, die diese Prinzipien aushebeln. Die Blockierung der wissenschaftlichen und kulturellen Kontakte zur Russischen Föderation, die durch die Hochschulleitungen 2022 als Antwort auf den Krieg in der Ukraine verhängt wurde, zeigte eine gefährliche Schwäche nicht nur der Erziehungswissenschaft an, die unbedingt überwunden werden muss. Anstatt gegen diese Direktive aufzubegehren, ließen die Wissenschaftsdisziplinen sie widerstandslos über sich ergehen. Eine zivil-antimilitaristische Erziehungswissenschaft hat aber in Krisen- und Kriegszeiten erst recht die Verpflichtung, das Gespräch, den Dialog und die Kooperation fortzuführen, zumal, wenn die Politik, bar jeglicher Entspannungsversuche, ausschließlich auf Konfrontation ausgerichtet ist. Damit trägt Erziehungswissenschaft zum systematischen Abbau von Feindbildern ebenso bei wie zum Perspektivenwechsel, der einen bestehenden Konflikt auch aus der ‚gegnerischen‘ Perspektive zu sehen versucht – eine notwendige Bedingung vertrauensbildender Maßnahmen und der intergesellschaftlichen Verständigung.
Literatur
Apelt, M. (2023): Militärische Sozialisation. In: Leonhard, N./Werkner, I.-J. (Hrsg.): Militärsoziologie – Eine Einführung. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer
Senghaas, D. (1981): Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit. Frankfurt a. M.
Tögel, J. (2023). Kognitive Kriegsführung. Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Frankfurt am Main: Westend
Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (Hrsg.) (2025): Grünbuch 2025. Zivil-militärische Zusammenarbeit im militärischen Krisenfall. 4.0. Berlin
Bild mit Hilfe von KI generiert