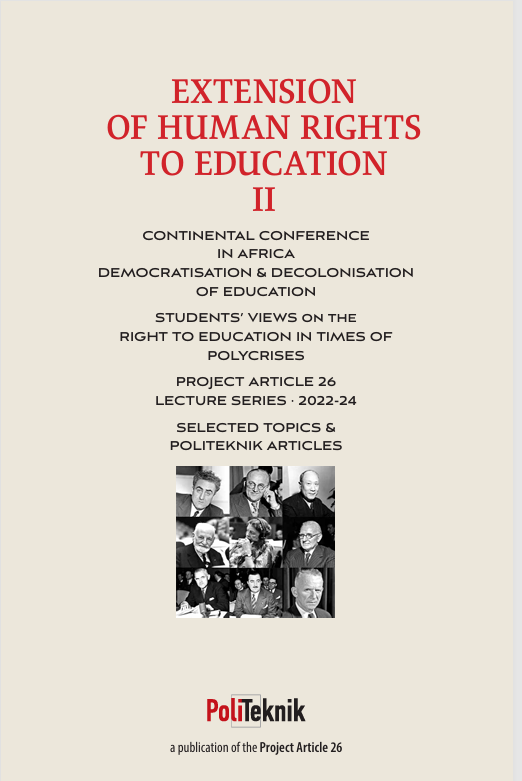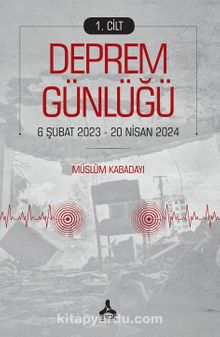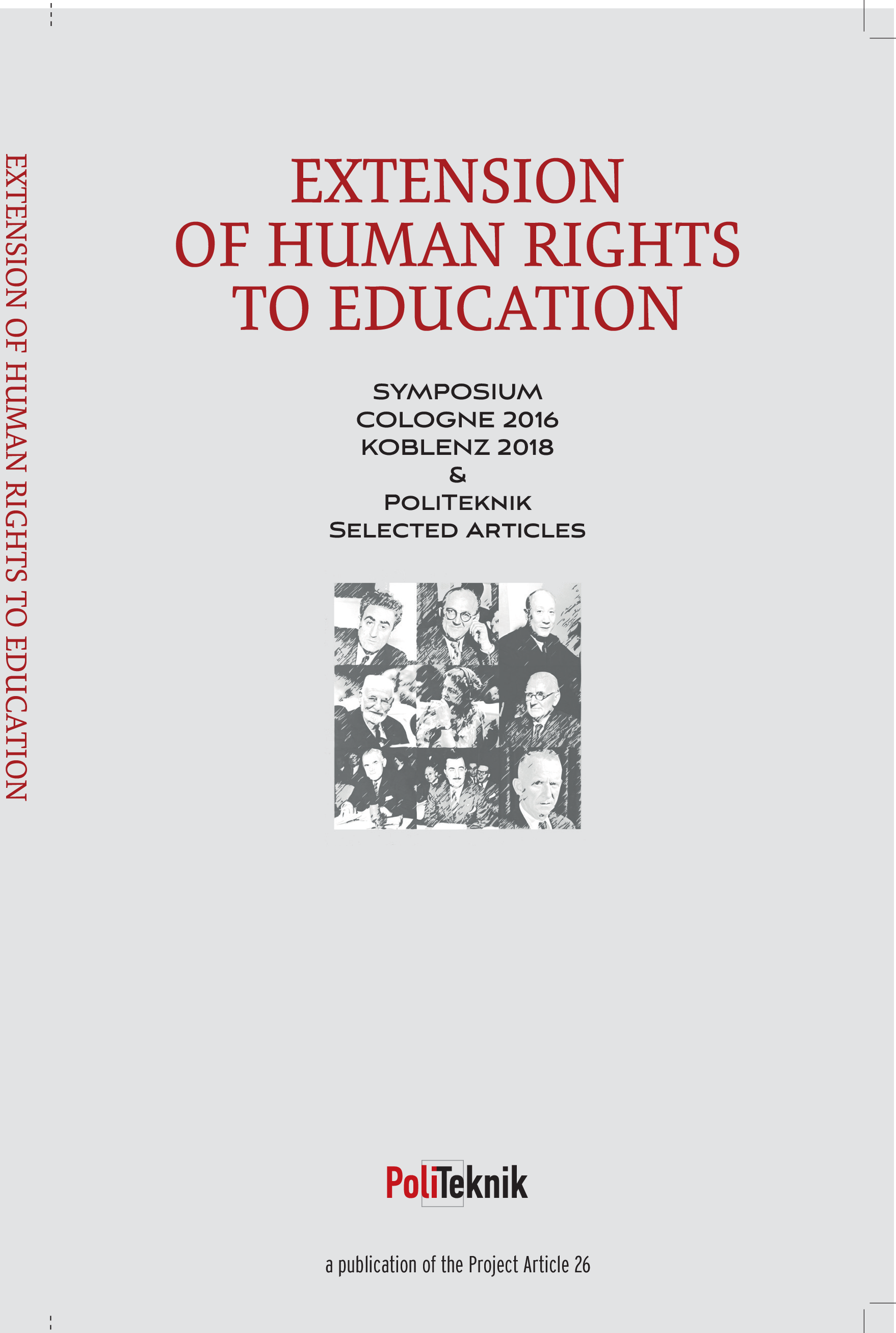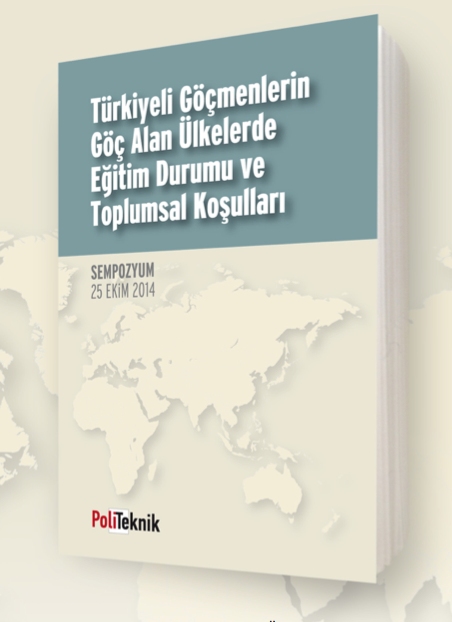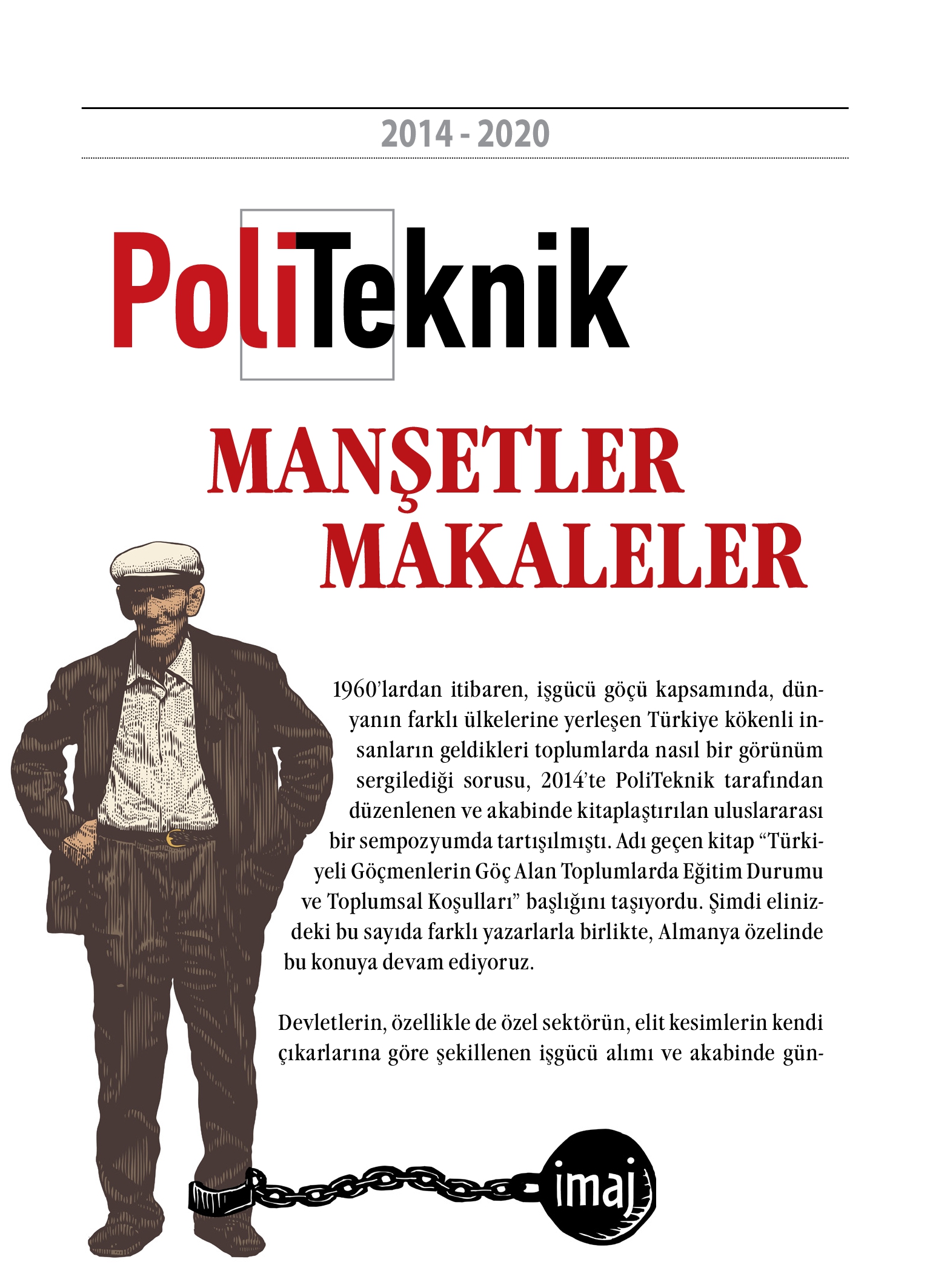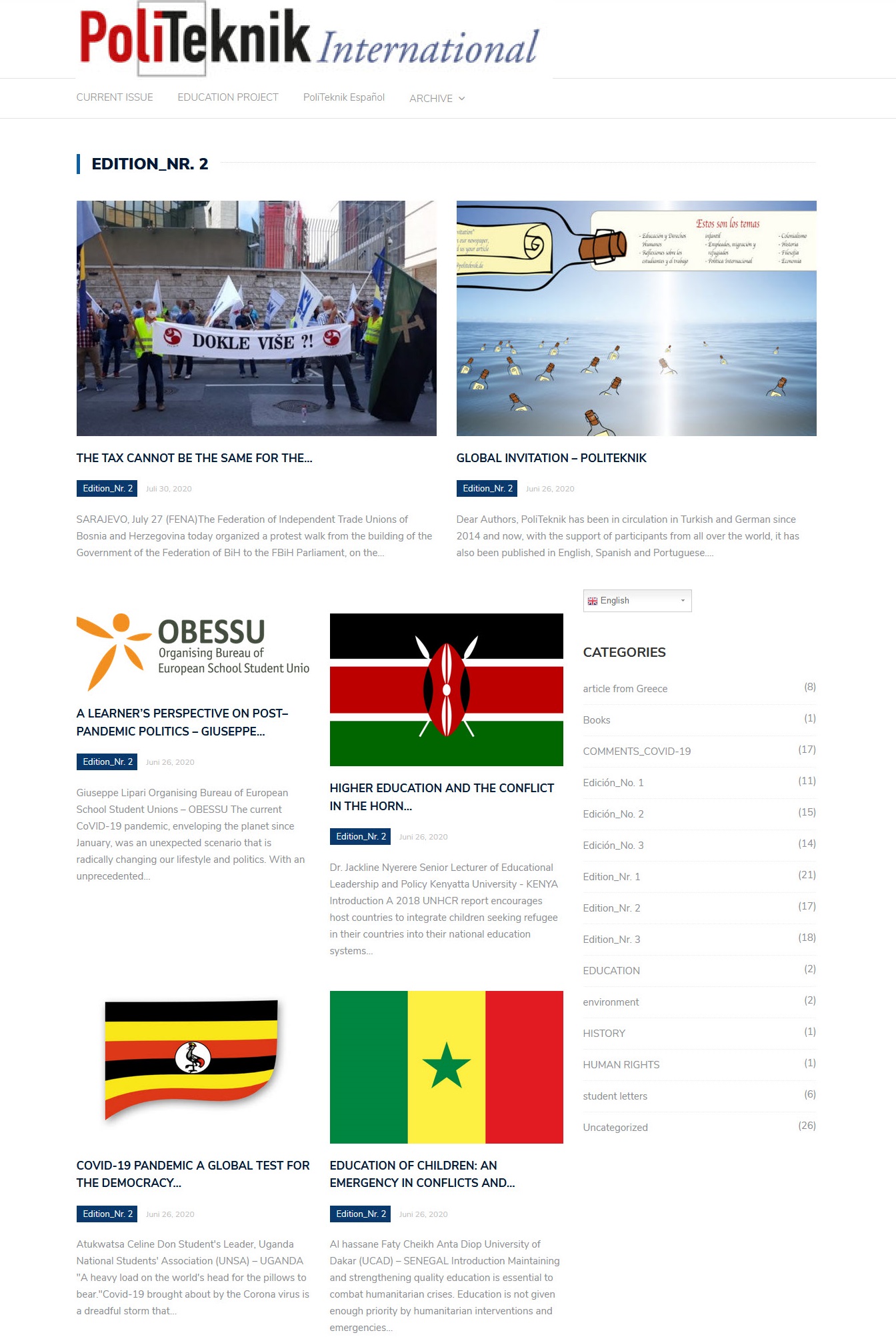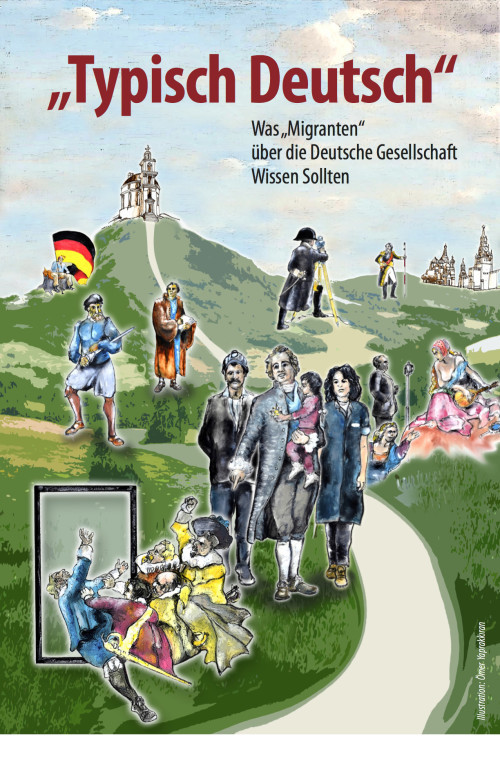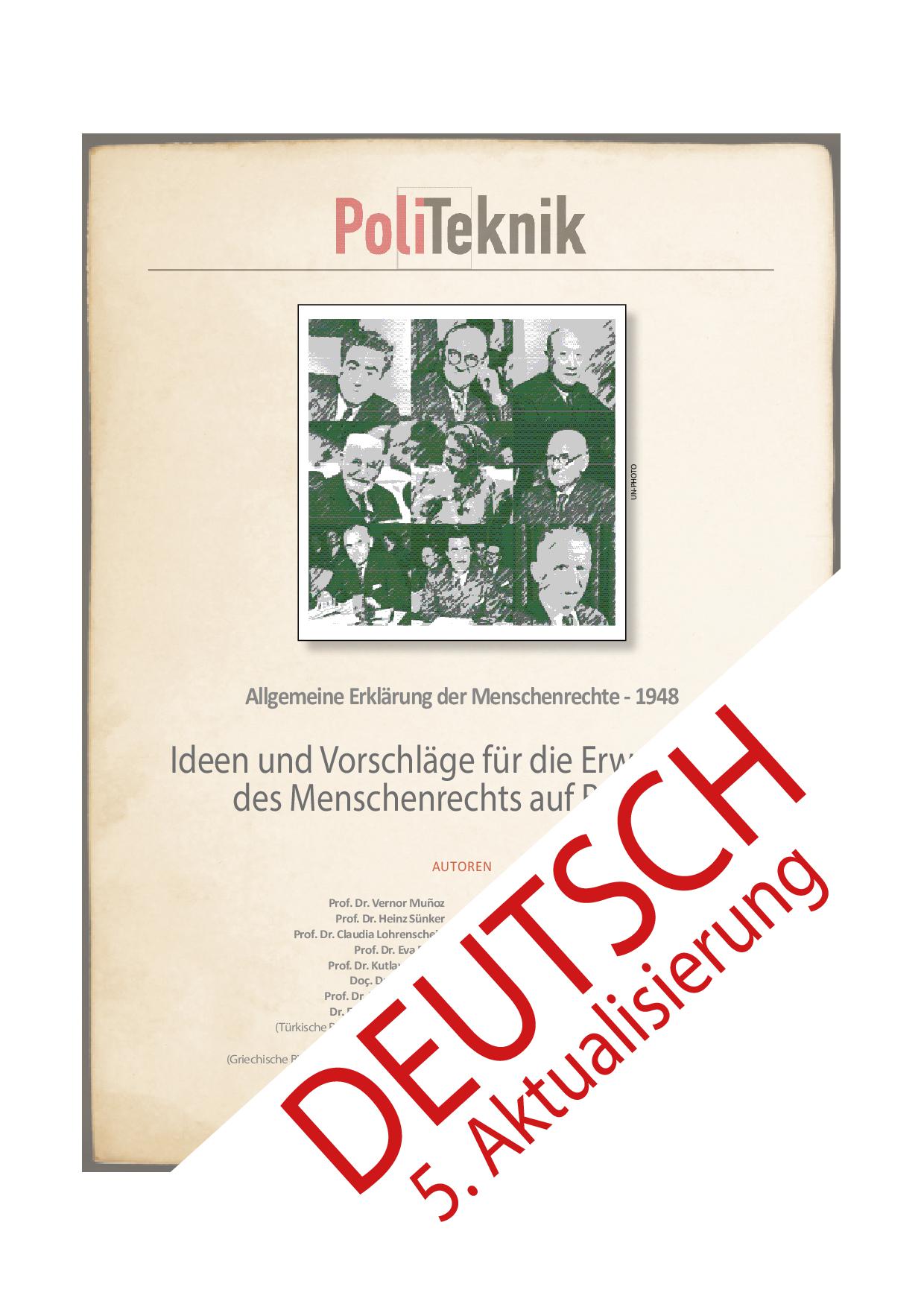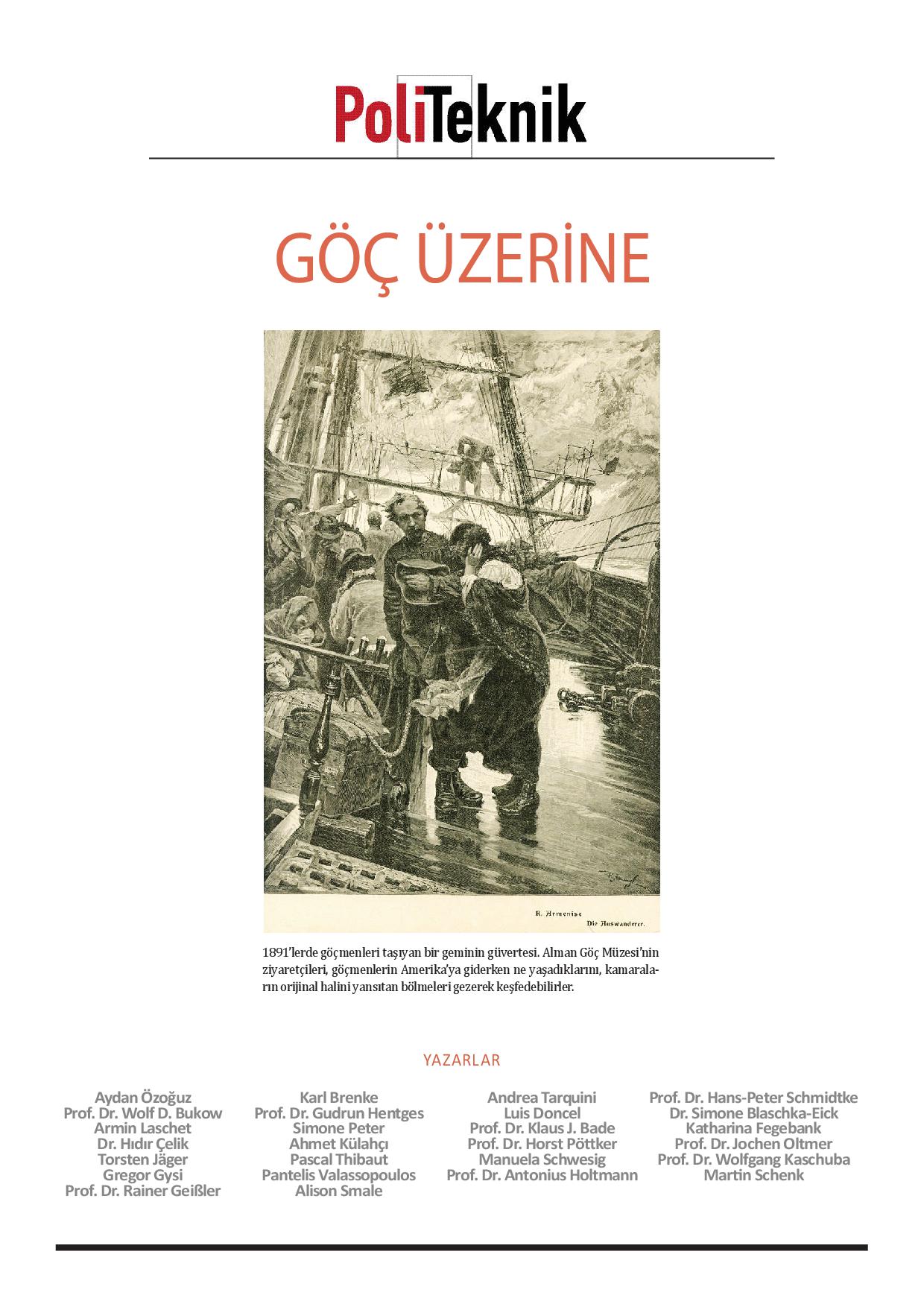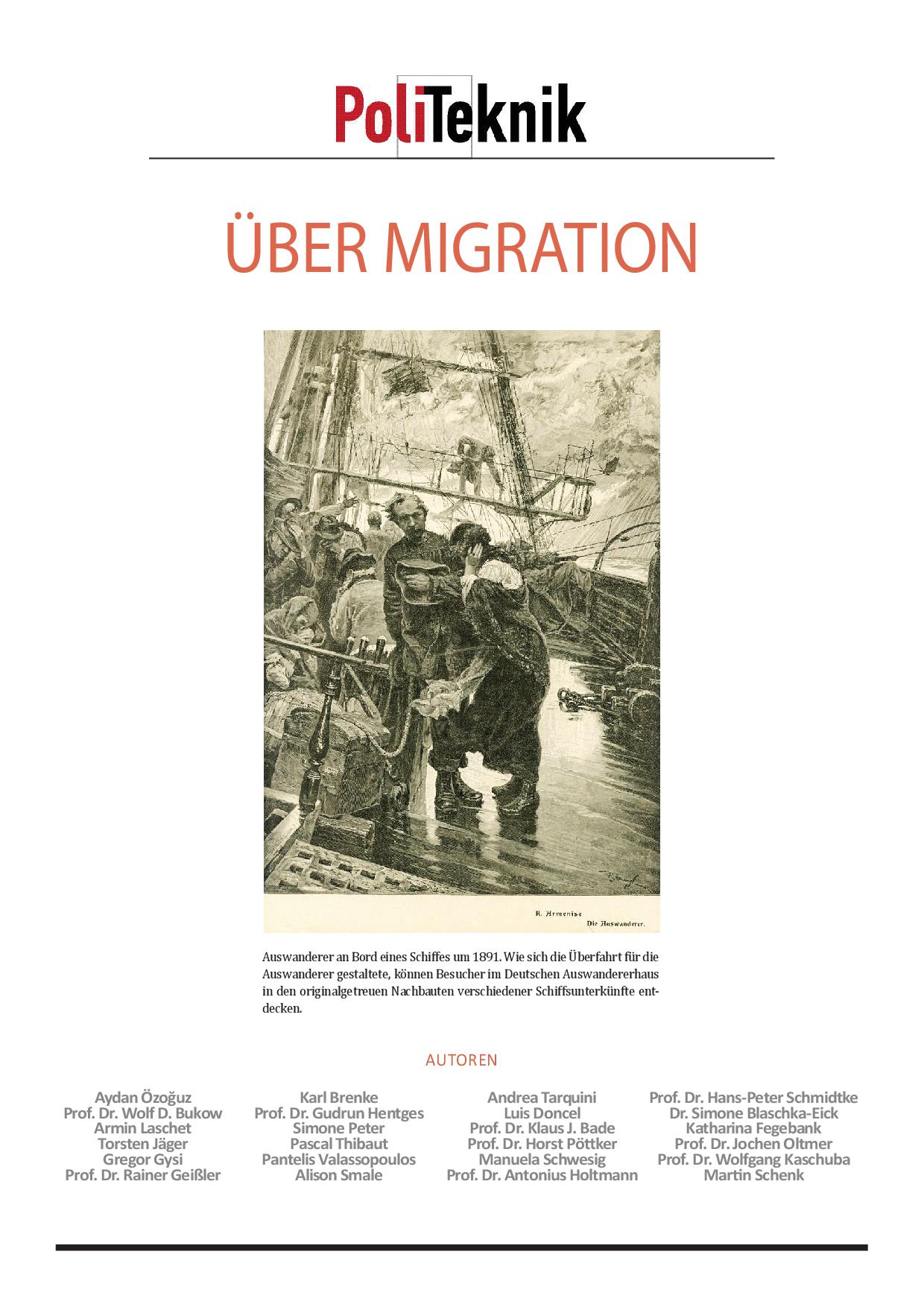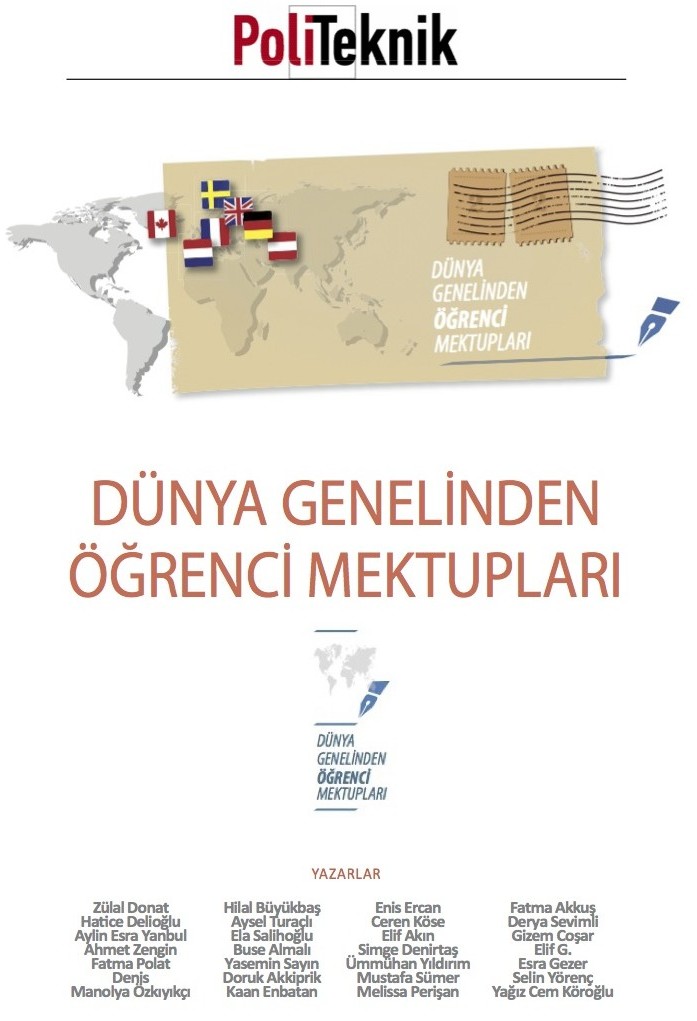PD Dr. Daniel Schönpflug ist ein Berliner Historiker und Stellvertretender Direktor des Centre Marc Bloch
Sébastien Vannier hat an der Eliteuniversität „Institut d´études politiques“ in Rennes und Straßburg studiert und ist Pressesprecher des Centre Marc Bloch.
Am Eingang unseres Instituts hängt ein „Schwarzes Brett“. Die französischen Wissenschaftler, die hier arbeiten, nennen es „le Schwarzes Brett“. Keiner von ihnen würde auf die Idee kommen, „tableau noir“ zu sagen oder irgendeine andere riskante Übersetzung zu verwenden. Umgekehrt nennen auch alle deutschen Mitarbeiter unser Institut „Centre Marc Bloch“ und testen lieber ihren Akzent an dem französischen Wort „Centre“ als vom „Marc Bloch Zentrum“ zu sprechen. Und so entsteht hier unter uns eine merkwürdige Sprache, die wir für gewöhnlich “frallemand” nennen.
Die deutsch-französischen Beziehungen haben im Jahr 742 nach Christus ihren Anfang genommen, als Karl der Große sein europäisches Reich unter seinen Söhnen aufteilte. Sie waren niemals einfach, oder gar selbstverständlich, und sie sind es auch heute nicht. Mit Napoleons Kriegen begann die Zeit der “Erbfeindschaft”, in der sich Deutschland und Frankreich blutig bekämpften. Diese traurige Ära ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der auf beiden Seiten so viele Tote forderte, zu Ende gegangen. Doch auch die Ära der „Erbfreundschaft“, die mit einer historischen Umarmung und einem Vertrag zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Jahr 1963 begann, ist nie ganz frei von unterschiedlichen Interessen, Missverständnissen und Reibungen gewesen.
Das Centre Marc Bloch, in der Friedrichstraße in Berlins quirliger Mitte, ist ein Ergebnis dieser spannungsvollen Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Gegründet wurde das Forschungsinstitut kurz nach dem Fall der Berliner Mauer. Die deutsche und die französische Regierung hatten damals beschlossen, ein deutsch-französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften ins Leben zu rufen, das auch zu anderen europäischen Ländern hin geöffnet sein sollte. Feierlich eröffnet am 8. September 1994, erhielt es den Namen des französischen Historikers Marc Bloch (1886-1944), selbst ein Wanderer zwischen beiden Ländern – und 1944 von der Geheimen Staatspolizei der Nationalsozialisten erschossen. Mit circa zwanzig Wissenschaftlern, ebenso vielen assoziierten Forschern und vierzig Doktoranden aus der ganzen Welt (darunter auch zwei aus der Türkei!) und aus allen Fachbereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften ist das Centre Marc Bloch mehr als zwanzig Jahre nach seiner Gründung ein dynamischer Ort internationaler Forschung und Lehre – und ein idealer Beobachtungsposten, um einen Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen auf verschiedenen Ebenen zu werfen: vom Staatsbesuch bis zu den Begegnungen im Alltag.
Im letzten Jahr durften wir als Vertreter des Centre Marc Bloch an die Feierlichkeiten zum fünfzigsten Jahrestag des berühmten Elysee-Vertrages von 1963 teilnehmen. Wir durchlitten eine nicht abreißende Kette offiziöser Staatszeremonien, aber erlebten auch wunderbare Momente deutsch-französischer Komplexität. Am 21. Januar 2013 trafen sich im Kanzleramt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande mit Schülern und Studenten aus beiden Ländern zu einer Diskussion. Europas Schicksal stand nach wie vor auf der Kippe. Hollande hatte wenige Monate zuvor das Präsidentenamt angetreten. Viele seiner Wahlversprechen waren Kampfansagen an die von Deutschland verfolgte Politik der Krisenbewältigung. Doch statt mit den üblichen kühlen Politikerfloskeln begegneten sich die beiden mit einem Lächeln und schließlich sogar mit einem frechen Humor, den man weder ihr noch ihm zugetraut hätte. Als Hollande von den Errungenschaften des französischen Sozialstaates – 35 Stundenwoche, früher Renteneintritt – berichtete, fragte Merkel unschuldig nach, ob er ihr eventuell eine Arbeitsstelle in Frankreich verschaffen könnte… Die beiden Staatsoberhäupter hatten sich kurz zuvor bei einem Abendessen das “Du” angeboten. So nannte der Präsident die Kanzlerin “Angéla” – und dank seines Akzents klang der vertraute Vorname plötzlich als entstamme er einem französischen Chanson.
Zum Glück sind die wissenschaftlichen Beziehungen, die sich hier im Centre Marc Bloch entfalten, viel unkomplizierter als die politischen. Sie sind Teil eines dicht gewebten Netzwerks zwischen Frankreich und Deutschland, das auf der Welt einzigartig ist. Neben dem Centre Marc Bloch existieren Tausende deutsch-französischer Institutionen. Die vielen Städtepartnerschaften, die seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gegründet wurden, haben eine Vorreiterrolle gespielt, und den Kontakt zwischen den einst verfeindeten Gesellschaften befördert. Austausch und Begegnung zwischen jungen Menschen stehen im Kern der Arbeit des Deutsch-Französischen Jugendwerks, das mit dem Elysee-Vertrag 1963 gegründet wurde. Im Hochschul- und Forschungsbereich läuft die Zusammenarbeit seit den 1980er Jahren auf Hochtouren. Dank der Deutsch-Französischen Hochschule wurden circa 150 deutsch-französische Studiengänge gegründet, die es den Studenten beider Länder erlauben, ihre Erfahrungen in zwei Kulturen zu machen. Eine Reihe anderer Institutionen erlauben einen täglichen kulturellen und wissenschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern: z.B. die Instituts français in Deutschland, die Goethe Institute in Frankreich, das Deutsche Historische Institut Paris und das Centre interdisciplinaire d´études et de la recherche sur l´Allemagne.
Darüber hinaus sind Wissenschaftler bekanntlich Kosmopoliten! Sprachbarrieren sind für sie kein Hindernis und interkulturelle Kompetenz haben sie schließlich an den Universitäten studiert! So sollte man zumindest meinen. Doch im Alltag kann es ganz ordentlich klemmen. So beginnen französische Seminare immer zur vollen Stunde; die Deutschen, die fleißigen Musterschüler in Europa, gönnen sich hingegen das “cum tempore”, d.h. sie eröffnen ihre Veranstaltungen eine Viertelstunde später. Als Zeitsparer erweisen sich die Deutschen auch bei den Mittagessen im Kollegenkreis. Wenn für die Franzosen das Mahl mit dem Hauptgang gerade erst richtig in Fahrt gekommen ist, scharren die Deutschen schon nervös mit den Füßen. Während die Franzosen Nachtisch und Kaffee ordern, träumen die Deutschen unruhig von der Rückkehr an ihre geliebten Schreibtische. Dafür aber scheint das Wort “Feierabend” im Französischen nicht zu existieren.
Zu Komplikationen führt auch die Verwendung der Titel. In Deutschland gehört der akademische Grad zur Identität. Er findet sich auf der Visitenkarte, auf der Klingel, auf dem Personalausweis. Je länger der Titel, desto wichtiger ist die Person, deren Namen rechts davon steht. In Frankreich würde man sich mit solchen Zeichen akademischer Exzellenz eher der Hochstapelei verdächtig machen. Dort gilt: Wer kein Stethoskop bedienen kann, ist kein Doktor. Und dennoch reagieren manche französischen Kollegen beleidigt, wenn – etwa auf einem Tagungsprogramm – die Präsentation des deutschen Kollegen doppelt so lang ist wie die eigene.
Doch schwieriger als die Tücken des Alltags ist es, nicht nur miteinander zu sprechen, sondern sich wirklich zu verstehen. Bei “Le Schwarzes Brett” hält sich das Risiko für Missverständnisse noch in Grenzen. Aber es ist gar nicht so einfach, sich auf “frallemand” auf wissenschaftlichem Niveau über Politik, Gesellschaft, Geschichte und Kultur zu verständigen. Tückisch sind die sogenannten “falschen Freunde” oder “faux amis”: Das deutsche Wort “Demonstration” klingt beispielsweise fast so, als müsste man es nur nasal aussprechen, um daraus ein Französisches zu machen. Tatsächlich heißt das französische Pendant aber “manifestation”. Wer sich das französische Wort für “Ausstellung” aus dem Englischen erschließt und von einer “belle exhibition” berichtet, macht sich unweigerlich merkwürdiger sexueller Vorlieben verdächtig. Der korrekte französische Begriff heißt übrigens “exposition”. Noch schwieriger sind wissenschaftliche Termini, die in beiden Sprachen fast gleich klingen, aber doch unterschiedliche Bedeutungen haben. So bezeichnet der deutsche Begriff “Gewalt” gleichermaßen einen körperlichen Angriff auf eine Person, aber auch die Autorität eines Staates (etwa im Begriff der “Gewaltenteilung”); im Französischen gibt es hingegen zwei Wörter “violence” und “pouvoir”. In ähnlich verwirrender Weise kann das französische Wort “homme” im Deutschen gleichermaßen “Mann” wie “Mensch” heißen. Ganz zu schweigen, von den schlechtbeleuchteten Tiefen des philosophischen Vokabulars – von Martin Heideggers “Eigentlichkeit” bis zu Jacques Derridas “différance”. Gegen Missverständnisse hilft nur Geduld. Sprechen und Zuhören, Erklären und Diskutieren bis der andere wirklich verstanden hat. Die Sitzungen im Centre Marc Bloch dauern entsprechend manchmal ein bisschen länger. Das ist mühselig, aber auch überaus anregend – und kann sogar süchtig machen.
Das Schwarze Brett des Centre Marc Bloch beweist, dass viele vom Denken und Arbeiten, vom Leben in zwei Kulturen gar nicht genug bekommen können. Es ist übersät mit immer neuen Vortragseinladungen, Colloquiumsprogrammen und Diskussionen. Und dazwischen hängen immer wieder Fotografien von süßen Neugeborenen. Sie heißen “Johann” oder “Jean”, “Lea” oder “Léa” und viele von ihnen haben einen französischen Vater und eine deutsche Mutter … oder umgekehrt. Die deutsch-französischen Beziehungen können also – auch wenn sie ganz schön kompliziert sind – überaus fruchtbar sein.